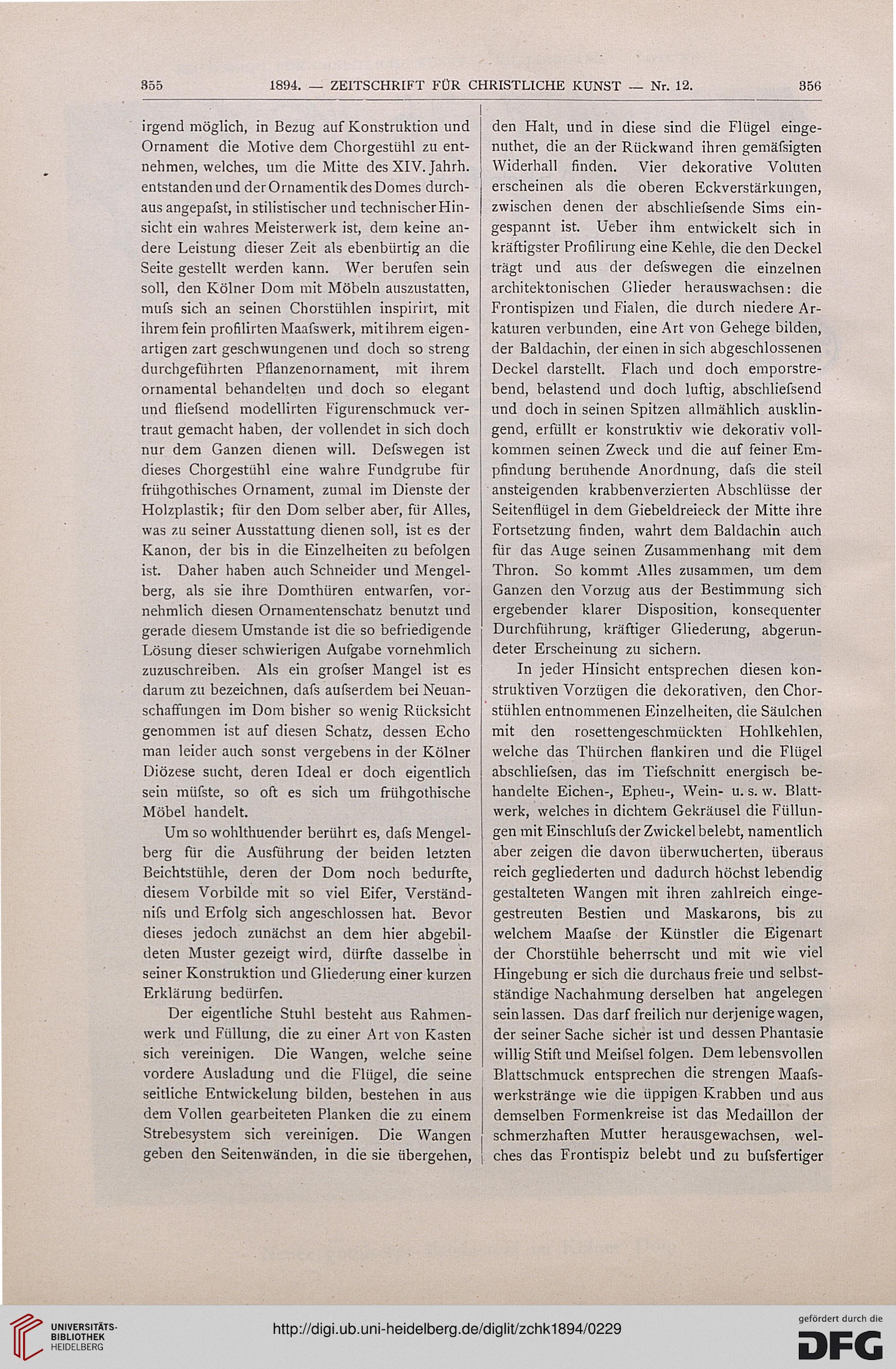355
1894.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
356
I
irgend möglich, in Bezug auf Konstruktion und
Ornament die Motive dem Chorgestühl zu ent-
nehmen, welches, um die Mitte des XIV. Jahrh.
entstanden und der Ornamentik des Domes durch-
aus angepafst, in stilistischer und technischer Hin-
sicht ein wahres Meisterwerk ist, dem keine an-
dere Leistung dieser Zeit als ebenbürtig an die
Seite gestellt werden kann. Wer berufen sein
soll, den Kölner Dom mit Möbeln auszustatten,
mufs sich an seinen Chorstühlen inspirirt, mit
ihrem fein profilirten Maafswerk, mitihrem eigen-
artigen zart geschwungenen und doch so streng
durchgeführten Pflanzenornament, mit ihrem
ornamental behandelten und doch so elegant
und fliefsend modellirten Figurenschmuck ver-
traut gemacht haben, der vollendet in sich doch
nur dem Ganzen dienen will. Defswegen ist
dieses Chorgestühl eine wahre Fundgrube für
frühgothisches Ornament, zumal im Dienste der
Holzplastik; für den Dom selber aber, für Alles,
was zu seiner Ausstattung dienen soll, ist es der
Kanon, der bis in die Einzelheiten zu befolgen
ist. Daher haben auch Schneider und Mengel-
berg, als sie ihre Domthüren entwarfen, vor-
nehmlich diesen Ornamentenschatz benutzt und
gerade diesem Umstände ist die so befriedigende
Lösung dieser schwierigen Aufgabe vornehmlich
zuzuschreiben. Als ein grofser Mangel ist es
darum zu bezeichnen, dafs aufserdem bei Neuan-
schaffungen im Dom bisher so wenig Rücksicht
genommen ist auf diesen Schatz, dessen Echo
man leider auch sonst vergebens in der Kölner
Diözese sucht, deren Ideal er doch eigentlich
sein müfste, so oft es sich um frühgothische
Möbel handelt.
Um so wohlthuender berührt es, dafs Mengel-
berg für die Ausführung der beiden letzten
Beichtstühle, deren der Dom noch bedurfte,
diesem Vorbilde mit so viel Eifer, Verständ-
nifs und Erfolg sich angeschlossen hat. Bevor
dieses jedoch zunächst an dem hier abgebil-
deten Muster gezeigt wird, dürfte dasselbe in
seiner Konstruktion und Gliederung einer kurzen
Erklärung bedürfen.
Der eigentliche Stuhl besteht aus Rahmen-
werk und Füllung, die zu einer Art von Kasten
sich vereinigen. Die Wangen, welche seine
vordere Ausladung und die Flügel, die seine
seitliche Entwickelung bilden, bestehen in aus
dem Vollen gearbeiteten Planken die zu einem
Strebesystem sich vereinigen. Die Wangen
geben den Seitenwänden, in die sie übergehen,
den Halt, und in diese sind die Flügel einge-
nuthet, die an der Rückwand ihren gemäfsigten
Widerhall finden. Vier dekorative Voluten
erscheinen als die oberen Eckverstärkungen,
zwischen denen der abschliefsende Sims ein-
gespannt ist. Ueber ihm entwickelt sich in
kräftigster Profilirung eine Kehle, die den Deckel
trägt und aus der defswegen die einzelnen
architektonischen Glieder herauswachsen: die
Frontispizen und Fialen, die durch niedere Ar-
katuren verbunden, eine Art von Gehege bilden,
der Baldachin, der einen in sich abgeschlossenen
Deckel darstellt. Flach und doch emporstre-
bend, belastend und doch luftig, abschliefsend
und doch in seinen Spitzen allmählich ausklin-
gend, erfüllt er konstruktiv wie dekorativ voll-
kommen seinen Zweck und die auf feiner Em-
pfindung beruhende Anordnung, dafs die steil
ansteigenden krabbenverzierten Abschlüsse der
Seitenflügel in dem Giebeldreieck der Mitte ihre
Fortsetzung finden, wahrt dem Baldachin auch
für das Auge seinen Zusammenhang mit dem
Thron. So kommt Alles zusammen, um dem
Ganzen den Vorzug aus der Bestimmung sich
ergebender klarer Disposition, konsequenter
Durchführung, kräftiger Gliederung, abgerun-
deter Erscheinung zu sichern.
In jeder Hinsicht entsprechen diesen kon-
struktiven Vorzügen die dekorativen, den Chor-
stühlen entnommenen Einzelheiten, die Säulc.hen
mit den rosettengeschmückten Hohlkehlen,
welche das Thürchen flankiren und die Flügel
abschliefsen, das im Tiefschnitt energisch be-
handelte Eichen-, Epheu-, Wein- u. s. w. Blatt-
werk, welches in dichtem Gekräusel die Füllun-
gen mit Einschlufs der Zwickel belebt, namentlich
aber zeigen die davon überwucherten, überaus
reich gegliederten und dadurch höchst lebendig
gestalteten Wangen mit ihren zahlreich einge-
gestreuten Bestien und Maskarons, bis zu
welchem Maafse der Künstler die Eigenart
der Chorstühle beherrscht und mit wie viel
Hingebung er sich die durchaus freie und selbst-
ständige Nachahmung derselben hat angelegen
sein lassen. Das darf freilich nur derjenige wagen,
der seiner Sache sicher ist und dessen Phantasie
willig Stift und Meifsel folgen. Dem lebensvollen
Blattschmuck entsprechen die strengen Maafs-
werkstränge wie die üppigen Krabben und aus
demselben Formenkreise ist das Medaillon der
schmerzhaften Mutter herausgewachsen, wel-
ches das Frontispiz belebt und zu bufsfertiger
1894.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
356
I
irgend möglich, in Bezug auf Konstruktion und
Ornament die Motive dem Chorgestühl zu ent-
nehmen, welches, um die Mitte des XIV. Jahrh.
entstanden und der Ornamentik des Domes durch-
aus angepafst, in stilistischer und technischer Hin-
sicht ein wahres Meisterwerk ist, dem keine an-
dere Leistung dieser Zeit als ebenbürtig an die
Seite gestellt werden kann. Wer berufen sein
soll, den Kölner Dom mit Möbeln auszustatten,
mufs sich an seinen Chorstühlen inspirirt, mit
ihrem fein profilirten Maafswerk, mitihrem eigen-
artigen zart geschwungenen und doch so streng
durchgeführten Pflanzenornament, mit ihrem
ornamental behandelten und doch so elegant
und fliefsend modellirten Figurenschmuck ver-
traut gemacht haben, der vollendet in sich doch
nur dem Ganzen dienen will. Defswegen ist
dieses Chorgestühl eine wahre Fundgrube für
frühgothisches Ornament, zumal im Dienste der
Holzplastik; für den Dom selber aber, für Alles,
was zu seiner Ausstattung dienen soll, ist es der
Kanon, der bis in die Einzelheiten zu befolgen
ist. Daher haben auch Schneider und Mengel-
berg, als sie ihre Domthüren entwarfen, vor-
nehmlich diesen Ornamentenschatz benutzt und
gerade diesem Umstände ist die so befriedigende
Lösung dieser schwierigen Aufgabe vornehmlich
zuzuschreiben. Als ein grofser Mangel ist es
darum zu bezeichnen, dafs aufserdem bei Neuan-
schaffungen im Dom bisher so wenig Rücksicht
genommen ist auf diesen Schatz, dessen Echo
man leider auch sonst vergebens in der Kölner
Diözese sucht, deren Ideal er doch eigentlich
sein müfste, so oft es sich um frühgothische
Möbel handelt.
Um so wohlthuender berührt es, dafs Mengel-
berg für die Ausführung der beiden letzten
Beichtstühle, deren der Dom noch bedurfte,
diesem Vorbilde mit so viel Eifer, Verständ-
nifs und Erfolg sich angeschlossen hat. Bevor
dieses jedoch zunächst an dem hier abgebil-
deten Muster gezeigt wird, dürfte dasselbe in
seiner Konstruktion und Gliederung einer kurzen
Erklärung bedürfen.
Der eigentliche Stuhl besteht aus Rahmen-
werk und Füllung, die zu einer Art von Kasten
sich vereinigen. Die Wangen, welche seine
vordere Ausladung und die Flügel, die seine
seitliche Entwickelung bilden, bestehen in aus
dem Vollen gearbeiteten Planken die zu einem
Strebesystem sich vereinigen. Die Wangen
geben den Seitenwänden, in die sie übergehen,
den Halt, und in diese sind die Flügel einge-
nuthet, die an der Rückwand ihren gemäfsigten
Widerhall finden. Vier dekorative Voluten
erscheinen als die oberen Eckverstärkungen,
zwischen denen der abschliefsende Sims ein-
gespannt ist. Ueber ihm entwickelt sich in
kräftigster Profilirung eine Kehle, die den Deckel
trägt und aus der defswegen die einzelnen
architektonischen Glieder herauswachsen: die
Frontispizen und Fialen, die durch niedere Ar-
katuren verbunden, eine Art von Gehege bilden,
der Baldachin, der einen in sich abgeschlossenen
Deckel darstellt. Flach und doch emporstre-
bend, belastend und doch luftig, abschliefsend
und doch in seinen Spitzen allmählich ausklin-
gend, erfüllt er konstruktiv wie dekorativ voll-
kommen seinen Zweck und die auf feiner Em-
pfindung beruhende Anordnung, dafs die steil
ansteigenden krabbenverzierten Abschlüsse der
Seitenflügel in dem Giebeldreieck der Mitte ihre
Fortsetzung finden, wahrt dem Baldachin auch
für das Auge seinen Zusammenhang mit dem
Thron. So kommt Alles zusammen, um dem
Ganzen den Vorzug aus der Bestimmung sich
ergebender klarer Disposition, konsequenter
Durchführung, kräftiger Gliederung, abgerun-
deter Erscheinung zu sichern.
In jeder Hinsicht entsprechen diesen kon-
struktiven Vorzügen die dekorativen, den Chor-
stühlen entnommenen Einzelheiten, die Säulc.hen
mit den rosettengeschmückten Hohlkehlen,
welche das Thürchen flankiren und die Flügel
abschliefsen, das im Tiefschnitt energisch be-
handelte Eichen-, Epheu-, Wein- u. s. w. Blatt-
werk, welches in dichtem Gekräusel die Füllun-
gen mit Einschlufs der Zwickel belebt, namentlich
aber zeigen die davon überwucherten, überaus
reich gegliederten und dadurch höchst lebendig
gestalteten Wangen mit ihren zahlreich einge-
gestreuten Bestien und Maskarons, bis zu
welchem Maafse der Künstler die Eigenart
der Chorstühle beherrscht und mit wie viel
Hingebung er sich die durchaus freie und selbst-
ständige Nachahmung derselben hat angelegen
sein lassen. Das darf freilich nur derjenige wagen,
der seiner Sache sicher ist und dessen Phantasie
willig Stift und Meifsel folgen. Dem lebensvollen
Blattschmuck entsprechen die strengen Maafs-
werkstränge wie die üppigen Krabben und aus
demselben Formenkreise ist das Medaillon der
schmerzhaften Mutter herausgewachsen, wel-
ches das Frontispiz belebt und zu bufsfertiger