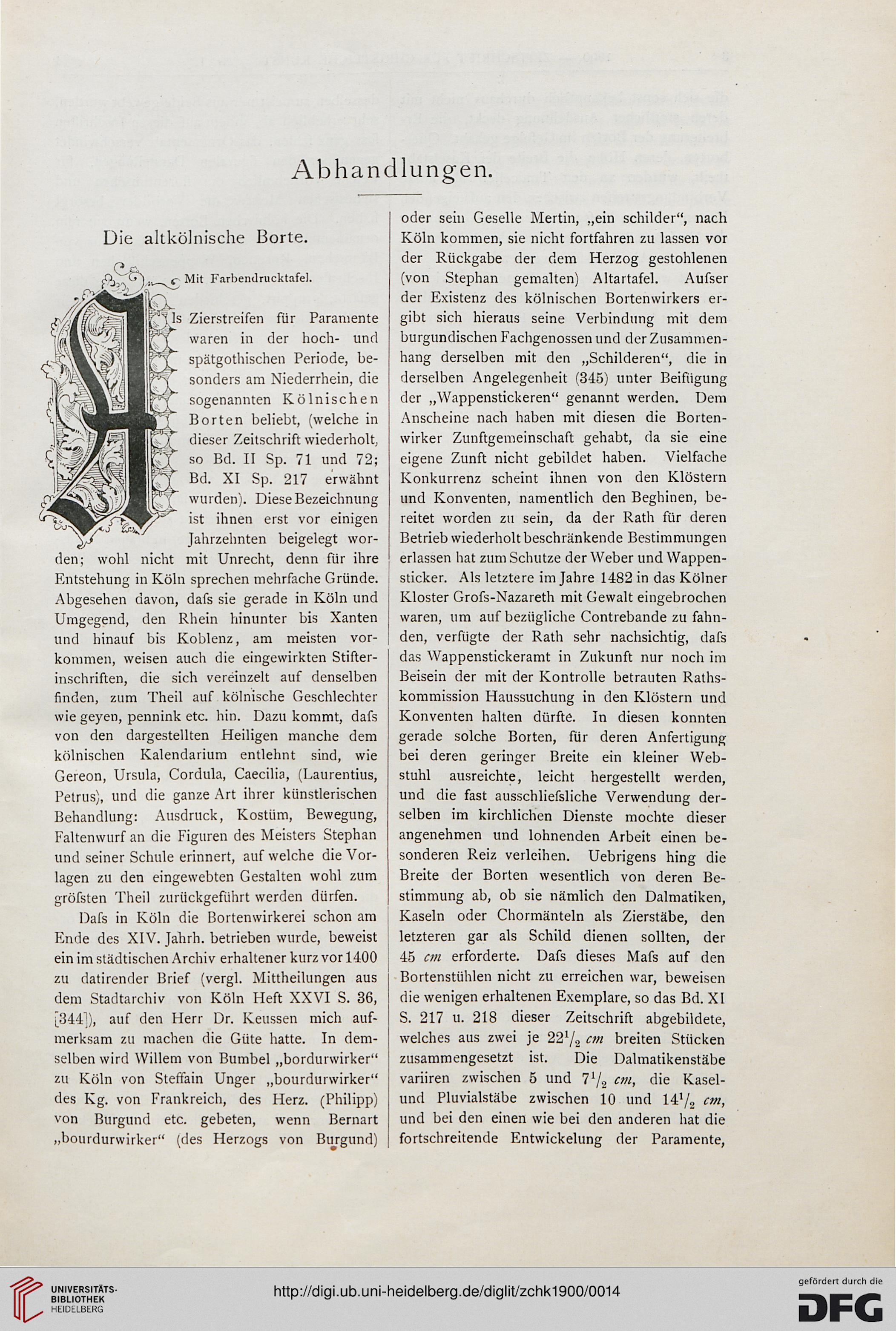Abhandlungen.
den: wohl nicht
Die akkölnische Borte.
<- Mit Farbendrucktafel.
Is Zierstreifen für Paramente
waren in der hoch- und
spätgothischen Periode, be-
sonders am Niederrhein, die
sogenannten Kölnischen
Borten beliebt, (welche in
dieser Zeitschrift wiederholt,
so Bd. II Sp. 71 und 72;
Bd. XI Sp. 217 erwähnt
wurden). Diese Bezeichnung
ist ihnen erst vor einigen
Jahrzehnten beigelegt wor-
mit Unrecht, denn für ihre
Entstehung in Köln sprechen mehrfache Gründe.
Abgesehen davon, dafs sie gerade in Köln und
Umgegend, den Rhein hinunter bis Xanten
und hinauf bis Koblenz, am meisten vor-
kommen, weisen auch die eingewirkten Stifter-
inschriften, die sich vereinzelt auf denselben
finden, zum Theil auf kölnische Geschlechter
wie geyen, pennink etc. hin. Dazu kommt, dafs
von den dargestellten Heiligen manche dem
kölnischen Kalendarium entlehnt sind, wie
Gereon, Ursula, Cordula, Caecilia, (Laurentius,
Petrus), und die ganze Art ihrer künstlerischen
Behandlung: Ausdruck, Kostüm, Bewegung,
Faltenwurf an die Figuren des Meisters Stephan
und seiner Schule erinnert, auf welche die Vor-
lagen zu den eingewebten Gestalten wohl zum
gröfsten Theil zurückgeführt werden dürfen.
Dafs in Köln die Bortenwirkerei schon am
Ende des XIV. Jahrh. betrieben wurde, beweist
ein im städtischen Archiv erhaltener kurz vor 1400
zu datirender Brief (vergl. Mittheilungen aus
dem Stadtarchiv von Köln Heft XXVI S. 36,
[344"!), auf den Herr Dr. Keussen mich auf-
merksam zu machen die Güte hatte. In dem-
selben wird Willem von Bumbel „bordurwirker"
zu Köln von Steffain Unger „bourdurwirker"
des Kg. von Frankreich, des Herz. (Philipp)
von Burgund etc. gebeten, wenn Bernart
„bourdurwirker" (des Herzogs von Burgund)
oder sein Geselle Mertin, „ein schilder", nach
Köln kommen, sie nicht fortfahren zu lassen vor
der Rückgabe der dem Herzog gestohlenen
(von Stephan gemalten) Altartafel. Aufser
der Existenz des kölnischen Bortenwirkers er-
gibt sich hieraus seine Verbindung mit dem
burgundischen Fachgenossen und der Zusammen-
hang derselben mit den „Schilderen", die in
derselben Angelegenheit (345) unter Beifügung
der „Wappenstickeren" genannt werden. Dem
Anscheine nach haben mit diesen die Borten-
wirker Zunftgemeinschaft gehabt, da sie eine
eigene Zunft nicht gebildet haben. Vielfache
Konkurrenz scheint ihnen von den Klöstern
und Konventen, namentlich den Beghinen, be-
reitet worden zu sein, da der Rath für deren
Betrieb wiederholt beschränkende Bestimmungen
erlassen hat zum Schutze der Weber und Wappen-
sticker. Als letztere im Jahre 1482 in das Kölner
Kloster Grofs-Nazareth mit Gewalt eingebrochen
waren, um auf bezügliche Contrebande zu fahn-
den, verfügte der Rath sehr nachsichtig, dafs
das Wappenstickeramt in Zukunft nur noch im
Beisein der mit der Kontrolle betrauten Raths-
kommission Haussuchung in den Klöstern und
Konventen halten dürfte. In diesen konnten
gerade solche Borten, für deren Anfertigung
bei deren geringer Breite ein kleiner Web-
stuhl ausreichte, leicht hergestellt werden,
und die fast ausschliefsliche Verwendung der-
selben im kirchlichen Dienste mochte dieser
angenehmen und lohnenden Arbeit einen be-
sonderen Reiz verleihen. Uebrigens hing die
Breite der Borten wesentlich von deren Be-
stimmung ab, ob sie nämlich den Dalmatiken,
Kasein oder Chormänteln als Zierstäbe, den
letzteren gar als Schild dienen sollten, der
45 cm erforderte. Dafs dieses Mafs auf den
Bortenstühlen nicht zu erreichen war, beweisen
die wenigen erhaltenen Exemplare, so das Bd. XI
S. 217 u. 218 dieser Zeitschrift abgebildete,
welches aus zwei je 2272 cm breiten Stücken
zusammengesetzt ist. Die Dalmatikenstäbe
variiren zwischen 5 und 7'/2 "", die Kasel-
und Pluvialstäbe zwischen 10 und 141/,, cm,
und bei den einen wie bei den anderen hat die
fortschreitende Entwickelung der Paramente,
den: wohl nicht
Die akkölnische Borte.
<- Mit Farbendrucktafel.
Is Zierstreifen für Paramente
waren in der hoch- und
spätgothischen Periode, be-
sonders am Niederrhein, die
sogenannten Kölnischen
Borten beliebt, (welche in
dieser Zeitschrift wiederholt,
so Bd. II Sp. 71 und 72;
Bd. XI Sp. 217 erwähnt
wurden). Diese Bezeichnung
ist ihnen erst vor einigen
Jahrzehnten beigelegt wor-
mit Unrecht, denn für ihre
Entstehung in Köln sprechen mehrfache Gründe.
Abgesehen davon, dafs sie gerade in Köln und
Umgegend, den Rhein hinunter bis Xanten
und hinauf bis Koblenz, am meisten vor-
kommen, weisen auch die eingewirkten Stifter-
inschriften, die sich vereinzelt auf denselben
finden, zum Theil auf kölnische Geschlechter
wie geyen, pennink etc. hin. Dazu kommt, dafs
von den dargestellten Heiligen manche dem
kölnischen Kalendarium entlehnt sind, wie
Gereon, Ursula, Cordula, Caecilia, (Laurentius,
Petrus), und die ganze Art ihrer künstlerischen
Behandlung: Ausdruck, Kostüm, Bewegung,
Faltenwurf an die Figuren des Meisters Stephan
und seiner Schule erinnert, auf welche die Vor-
lagen zu den eingewebten Gestalten wohl zum
gröfsten Theil zurückgeführt werden dürfen.
Dafs in Köln die Bortenwirkerei schon am
Ende des XIV. Jahrh. betrieben wurde, beweist
ein im städtischen Archiv erhaltener kurz vor 1400
zu datirender Brief (vergl. Mittheilungen aus
dem Stadtarchiv von Köln Heft XXVI S. 36,
[344"!), auf den Herr Dr. Keussen mich auf-
merksam zu machen die Güte hatte. In dem-
selben wird Willem von Bumbel „bordurwirker"
zu Köln von Steffain Unger „bourdurwirker"
des Kg. von Frankreich, des Herz. (Philipp)
von Burgund etc. gebeten, wenn Bernart
„bourdurwirker" (des Herzogs von Burgund)
oder sein Geselle Mertin, „ein schilder", nach
Köln kommen, sie nicht fortfahren zu lassen vor
der Rückgabe der dem Herzog gestohlenen
(von Stephan gemalten) Altartafel. Aufser
der Existenz des kölnischen Bortenwirkers er-
gibt sich hieraus seine Verbindung mit dem
burgundischen Fachgenossen und der Zusammen-
hang derselben mit den „Schilderen", die in
derselben Angelegenheit (345) unter Beifügung
der „Wappenstickeren" genannt werden. Dem
Anscheine nach haben mit diesen die Borten-
wirker Zunftgemeinschaft gehabt, da sie eine
eigene Zunft nicht gebildet haben. Vielfache
Konkurrenz scheint ihnen von den Klöstern
und Konventen, namentlich den Beghinen, be-
reitet worden zu sein, da der Rath für deren
Betrieb wiederholt beschränkende Bestimmungen
erlassen hat zum Schutze der Weber und Wappen-
sticker. Als letztere im Jahre 1482 in das Kölner
Kloster Grofs-Nazareth mit Gewalt eingebrochen
waren, um auf bezügliche Contrebande zu fahn-
den, verfügte der Rath sehr nachsichtig, dafs
das Wappenstickeramt in Zukunft nur noch im
Beisein der mit der Kontrolle betrauten Raths-
kommission Haussuchung in den Klöstern und
Konventen halten dürfte. In diesen konnten
gerade solche Borten, für deren Anfertigung
bei deren geringer Breite ein kleiner Web-
stuhl ausreichte, leicht hergestellt werden,
und die fast ausschliefsliche Verwendung der-
selben im kirchlichen Dienste mochte dieser
angenehmen und lohnenden Arbeit einen be-
sonderen Reiz verleihen. Uebrigens hing die
Breite der Borten wesentlich von deren Be-
stimmung ab, ob sie nämlich den Dalmatiken,
Kasein oder Chormänteln als Zierstäbe, den
letzteren gar als Schild dienen sollten, der
45 cm erforderte. Dafs dieses Mafs auf den
Bortenstühlen nicht zu erreichen war, beweisen
die wenigen erhaltenen Exemplare, so das Bd. XI
S. 217 u. 218 dieser Zeitschrift abgebildete,
welches aus zwei je 2272 cm breiten Stücken
zusammengesetzt ist. Die Dalmatikenstäbe
variiren zwischen 5 und 7'/2 "", die Kasel-
und Pluvialstäbe zwischen 10 und 141/,, cm,
und bei den einen wie bei den anderen hat die
fortschreitende Entwickelung der Paramente,