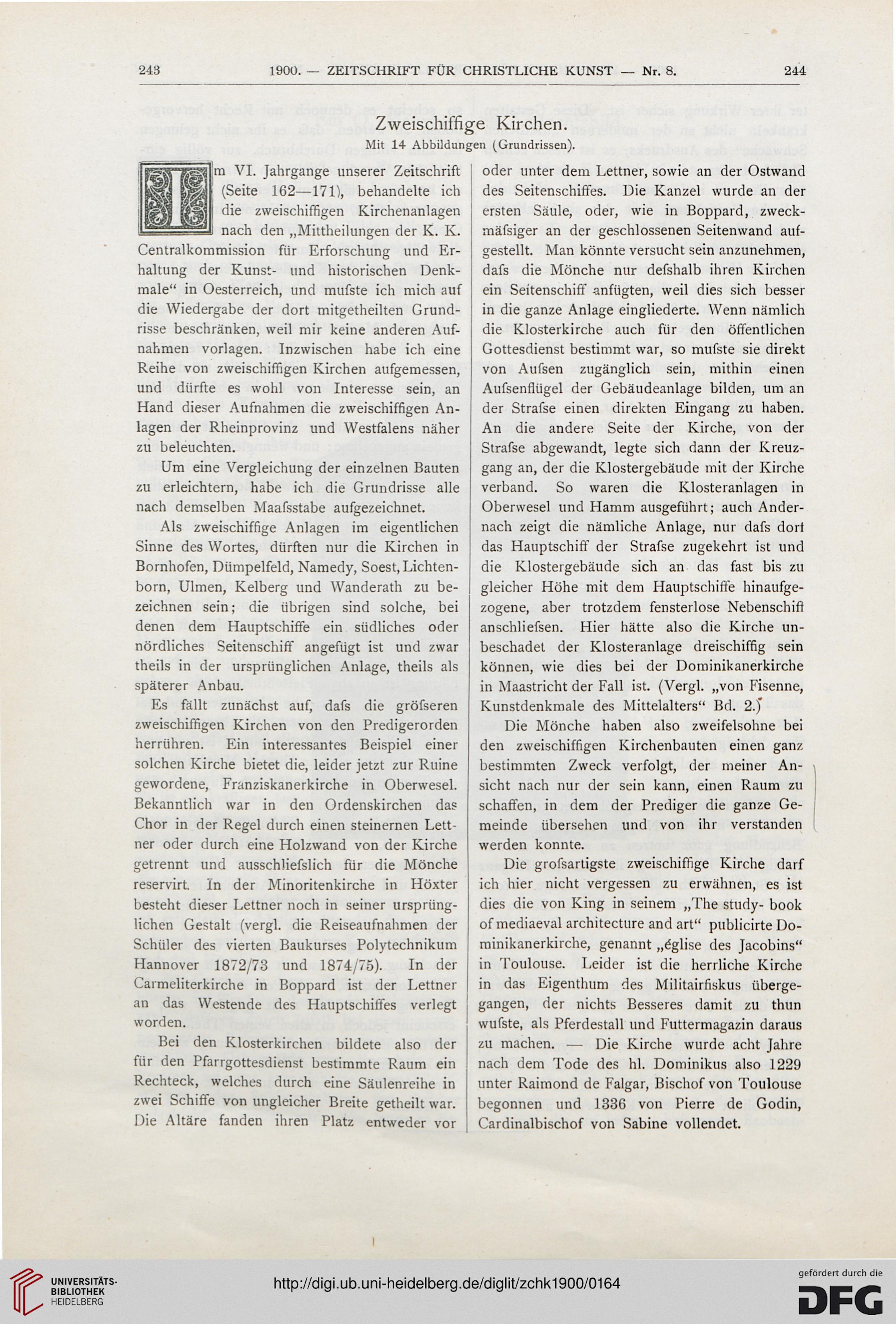243
1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
244
Zweischiffige Kirchen.
Mit 14- Abbildungen (Grundrissen).
m VI. Jahrgange unserer Zeitschrift
(Seite 162—171), behandelte ich
die zweischiffigen Kirchenanlagen
nach den „Mittheilungen der K. K.
Centralkommission für Erforschung und Er-
haltung der Kunst- und historischen Denk-
male" in Oesterreich, und mufste ich mich auf
die Wiedergabe der dort mitgetheilten Grund-
risse beschränken, weil mir keine anderen Auf-
nahmen vorlagen. Inzwischen habe ich eine
Reihe von zweischiffigen Kirchen aufgemessen,
und dürfte es wohl von Interesse sein, an
Hand dieser Aufnahmen die zweischiffigen An-
lagen der Rheinprovinz und Westfalens näher
zu beleuchten.
Um eine Vergleichung der einzelnen Bauten
zu erleichtern, habe ich die Grundrisse alle
nach demselben Maafsstabe aufgezeichnet.
Als zweischiffige Anlagen im eigentlichen
Sinne des Wortes, dürften nur die Kirchen in
Bornhofen, Dümpelfeld, Namedy, Soest, Lichten-
born, Ulmen, Kelberg und Wanderath zu be-
zeichnen sein; die übrigen sind solche, bei
denen dem Hauptschiffe ein südliches oder
nördliches Seitenschiff angefügt ist und zwar
theils in der ursprünglichen Anlage, theils als
späterer Anbau.
Es fällt zunächst auf, dafs die gröfseren
zweischiffigen Kirchen von den Predigerorden
herrühren. Ein interessantes Beispiel einer
solchen Kirche bietet die, leider jetzt zur Ruine
gewordene, Franziskanerkirche in Oberwesel.
Bekanntlich war in den Ordenskirchen das
Chor in der Regel durch einen steinernen Lett-
ner oder durch eine Holzwand von der Kirche
getrennt und ausschliefslich für die Mönche
reservirt. in der Minoritenkirche in Höxter
besteht dieser Lettner noch in seiner ursprüng-
lichen Gestalt (vergl. die Reiseaufnahmen der
Schüler des vierten Baukurses Polytechnikum
Hannover 1872/73 und 1874/75). In der
Carmeliterkirche in Boppard ist der Lettner
an das Westende des Hauptschiffes verlegt
worden.
Bei den Klosterkirchen bildete also der
für den Pfarrgottesdienst bestimmte Raum ein
Rechteck, welches durch eine Säulenreihe in
zwei Schiffe von ungleicher Breite getheilt war.
Die Altäre fanden ihren Platz entweder vor
oder unter dem Lettner, sowie an der Ostwand
des Seitenschiffes. Die Kanzel wurde an der
ersten Säule, oder, wie in Boppard, zweck-
mäfsiger an der geschlossenen Seitenwand auf-
gestellt. Man könnte versucht sein anzunehmen,
dafs die Mönche nur defshalb ihren Kirchen
ein Seitenschiff anfügten, weil dies sich besser
in die ganze Anlage eingliederte. Wenn nämlich
die Klosterkirche auch für den öffentlichen
Gottesdienst bestimmt war, so mufste sie direkt
von Aufsen zugänglich sein, mithin einen
Aufsenflügel der Gebäudeanlage bilden, um an
der Strafse einen direkten Eingang zu haben.
An die andere Seite der Kirche, von der
Strafse abgewandt, legte sich dann der Kreuz-
gang an, der die Klostergebäude mit der Kirche
verband. So waren die Klosteranlagen in
Oberwesel und Hamm ausgeführt; auch Ander-
nach zeigt die nämliche Anlage, nur dafs dort
das Hauptschiff der Strafse zugekehrt ist und
die Klostergebäude sich an das fast bis zu
gleicher Höhe mit dem Hauptschiffe hinaufge-
zogene, aber trotzdem fensterlose Nebenschifl
anschliefsen. Hier hätte also die Kirche un-
beschadet der Klosteranlage dreischiffig sein
können, wie dies bei der Dominikanerkirche
in Maastricht der Fall ist. (Vergl. „von Fisenne,
Kunstdenkmale des Mittelalters" Bd. 2.)*
Die Mönche haben also zweifelsohne bei
den zweischiffigen Kirchenbauten einen ganz
bestimmten Zweck verfolgt, der meiner An-
sicht nach nur der sein kann, einen Raum zu
schaffen, in dem der Prediger die ganze Ge-
meinde übersehen und von ihr verstanden
werden konnte.
Die grofsartigste zweischiffige Kirche darf
ich hier nicht vergessen zu erwähnen, es ist
dies die von King in seinem „The study- book
of mediaeval architecture and art" publicirte Do-
minikanerkirche, genannt „eglise des Jacobins"
in Toulouse. Leider ist die herrliche Kirche
in das Eigenthum des Militairfiskus überge-
gangen, der nichts Besseres damit zu thun
wufste, als Pferdestall und Futtermagazin daraus
zu machen. — Die Kirche wurde acht Jahre
nach dem Tode des hl. Dominikus also 1229
unter Raimond de Falgar, Bischof von Toulouse
begonnen und 1336 von Pierre de Godin,
Cardinalbischof von Sabine vollendet.
1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
244
Zweischiffige Kirchen.
Mit 14- Abbildungen (Grundrissen).
m VI. Jahrgange unserer Zeitschrift
(Seite 162—171), behandelte ich
die zweischiffigen Kirchenanlagen
nach den „Mittheilungen der K. K.
Centralkommission für Erforschung und Er-
haltung der Kunst- und historischen Denk-
male" in Oesterreich, und mufste ich mich auf
die Wiedergabe der dort mitgetheilten Grund-
risse beschränken, weil mir keine anderen Auf-
nahmen vorlagen. Inzwischen habe ich eine
Reihe von zweischiffigen Kirchen aufgemessen,
und dürfte es wohl von Interesse sein, an
Hand dieser Aufnahmen die zweischiffigen An-
lagen der Rheinprovinz und Westfalens näher
zu beleuchten.
Um eine Vergleichung der einzelnen Bauten
zu erleichtern, habe ich die Grundrisse alle
nach demselben Maafsstabe aufgezeichnet.
Als zweischiffige Anlagen im eigentlichen
Sinne des Wortes, dürften nur die Kirchen in
Bornhofen, Dümpelfeld, Namedy, Soest, Lichten-
born, Ulmen, Kelberg und Wanderath zu be-
zeichnen sein; die übrigen sind solche, bei
denen dem Hauptschiffe ein südliches oder
nördliches Seitenschiff angefügt ist und zwar
theils in der ursprünglichen Anlage, theils als
späterer Anbau.
Es fällt zunächst auf, dafs die gröfseren
zweischiffigen Kirchen von den Predigerorden
herrühren. Ein interessantes Beispiel einer
solchen Kirche bietet die, leider jetzt zur Ruine
gewordene, Franziskanerkirche in Oberwesel.
Bekanntlich war in den Ordenskirchen das
Chor in der Regel durch einen steinernen Lett-
ner oder durch eine Holzwand von der Kirche
getrennt und ausschliefslich für die Mönche
reservirt. in der Minoritenkirche in Höxter
besteht dieser Lettner noch in seiner ursprüng-
lichen Gestalt (vergl. die Reiseaufnahmen der
Schüler des vierten Baukurses Polytechnikum
Hannover 1872/73 und 1874/75). In der
Carmeliterkirche in Boppard ist der Lettner
an das Westende des Hauptschiffes verlegt
worden.
Bei den Klosterkirchen bildete also der
für den Pfarrgottesdienst bestimmte Raum ein
Rechteck, welches durch eine Säulenreihe in
zwei Schiffe von ungleicher Breite getheilt war.
Die Altäre fanden ihren Platz entweder vor
oder unter dem Lettner, sowie an der Ostwand
des Seitenschiffes. Die Kanzel wurde an der
ersten Säule, oder, wie in Boppard, zweck-
mäfsiger an der geschlossenen Seitenwand auf-
gestellt. Man könnte versucht sein anzunehmen,
dafs die Mönche nur defshalb ihren Kirchen
ein Seitenschiff anfügten, weil dies sich besser
in die ganze Anlage eingliederte. Wenn nämlich
die Klosterkirche auch für den öffentlichen
Gottesdienst bestimmt war, so mufste sie direkt
von Aufsen zugänglich sein, mithin einen
Aufsenflügel der Gebäudeanlage bilden, um an
der Strafse einen direkten Eingang zu haben.
An die andere Seite der Kirche, von der
Strafse abgewandt, legte sich dann der Kreuz-
gang an, der die Klostergebäude mit der Kirche
verband. So waren die Klosteranlagen in
Oberwesel und Hamm ausgeführt; auch Ander-
nach zeigt die nämliche Anlage, nur dafs dort
das Hauptschiff der Strafse zugekehrt ist und
die Klostergebäude sich an das fast bis zu
gleicher Höhe mit dem Hauptschiffe hinaufge-
zogene, aber trotzdem fensterlose Nebenschifl
anschliefsen. Hier hätte also die Kirche un-
beschadet der Klosteranlage dreischiffig sein
können, wie dies bei der Dominikanerkirche
in Maastricht der Fall ist. (Vergl. „von Fisenne,
Kunstdenkmale des Mittelalters" Bd. 2.)*
Die Mönche haben also zweifelsohne bei
den zweischiffigen Kirchenbauten einen ganz
bestimmten Zweck verfolgt, der meiner An-
sicht nach nur der sein kann, einen Raum zu
schaffen, in dem der Prediger die ganze Ge-
meinde übersehen und von ihr verstanden
werden konnte.
Die grofsartigste zweischiffige Kirche darf
ich hier nicht vergessen zu erwähnen, es ist
dies die von King in seinem „The study- book
of mediaeval architecture and art" publicirte Do-
minikanerkirche, genannt „eglise des Jacobins"
in Toulouse. Leider ist die herrliche Kirche
in das Eigenthum des Militairfiskus überge-
gangen, der nichts Besseres damit zu thun
wufste, als Pferdestall und Futtermagazin daraus
zu machen. — Die Kirche wurde acht Jahre
nach dem Tode des hl. Dominikus also 1229
unter Raimond de Falgar, Bischof von Toulouse
begonnen und 1336 von Pierre de Godin,
Cardinalbischof von Sabine vollendet.