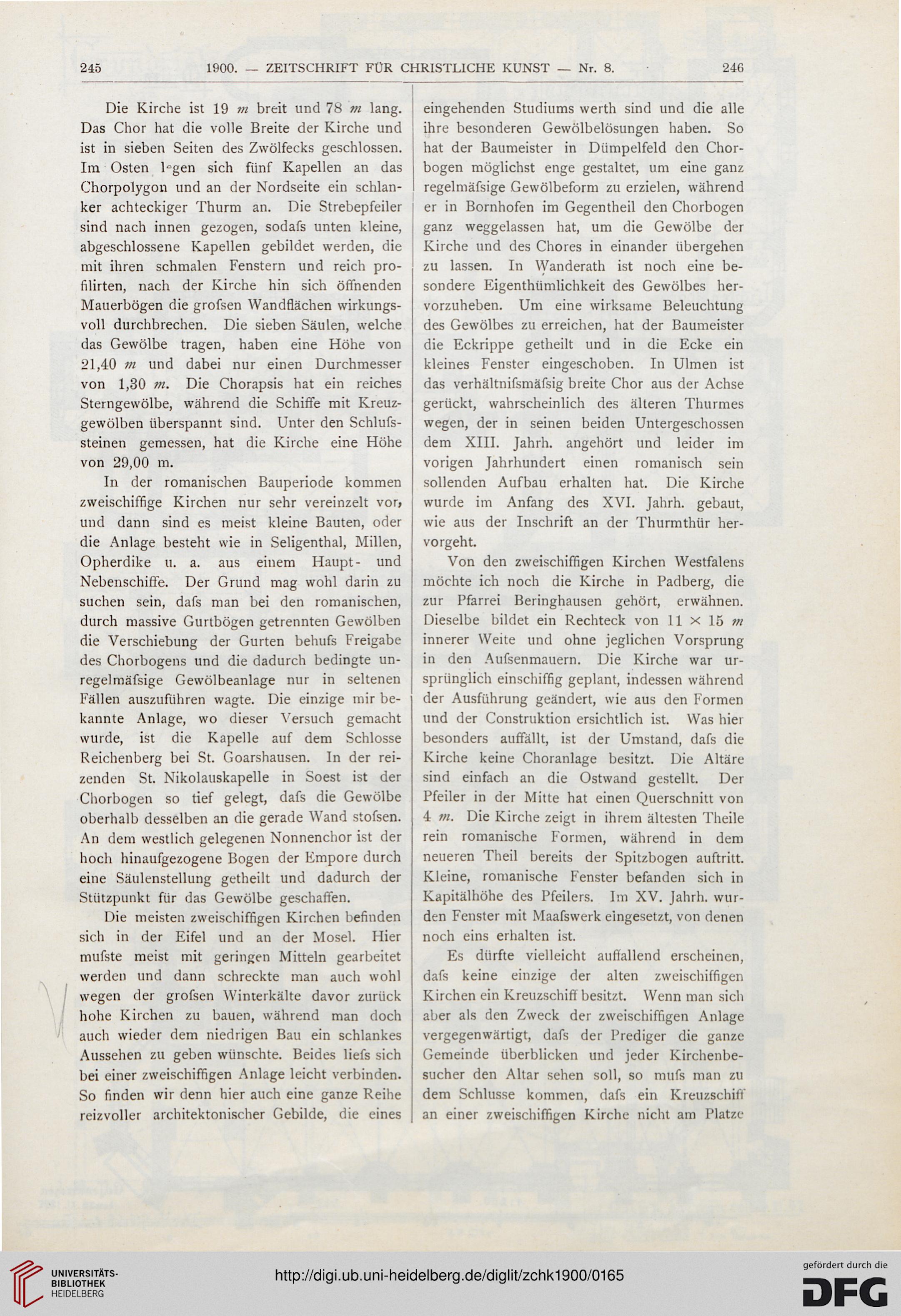245
1900.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
246
Die Kirche ist 19 m breit und 78 vi lang.
Das Chor hat die volle Breite der Kirche und
ist in sieben Seiten des Zwölfecks geschlossen.
Im Osten lcgen sich fünf Kapellen an das
Chorpolygon und an der Nordseite ein schlan-
ker achteckiger Thurm an. Die Strebepfeiler
sind nach innen gezogen, sodafs unten kleine,
abgeschlossene Kapellen gebildet werden, die
mit ihren schmalen Fenstern und reich pro-
filirten, nach der Kirche hin sich öffnenden
Mauerbögen die grofsen Wandflächen wirkungs-
voll durchbrechen. Die sieben Säulen, welche
das Gewölbe tragen, haben eine Höhe von
21,40 m und dabei nur einen Durchmesser
von 1,30 m. Die Chorapsis hat ein reiches
Sterngewölbe, während die Schiffe mit Kreuz-
gewölben überspannt sind. Unter den Schlufs-
steinen gemessen, hat die Kirche eine Höhe
von 29,00 m.
In der romanischen Bauperiode kommen
zweischiffige Kirchen nur sehr vereinzelt vor»
und dann sind es meist kleine Bauten, oder
die Anlage besteht wie in Seligenthal, Milien,
Opherdike u. a. aus einem Haupt- und
Nebenschiffe. Der Grund mag wohl darin zu
suchen sein, dafs man bei den romanischen,
durch massive Gurtbögen getrennten Gewölben
die Verschiebung der Gurten behufs Freigabe
des Chorbogens und die dadurch bedingte un-
regelmäfsige Gewölbeanlage nur in seltenen
Fällen auszuführen wagte. Die einzige mir be-
kannte Anlage, wo dieser Versuch gemacht
wurde, ist die Kapelle auf dem Schlosse
Reichenberg bei St. Goarshausen. In der rei-
zenden St. Nikolauskapelle in Soest ist der
Chorbogen so tief gelegt, dafs die Gewölbe
oberhalb desselben an die gerade Wand stofsen.
An dem westlich gelegenen Nonnenchor ist der
hoch hinaufgezogene Bogen der Empore durch
eine Säulenstellung getheilt und dadurch der
Stützpunkt für das Gewölbe geschaffen.
Die meisten zweischiffigen Kirchen befinden
sich in der Eifel und an der Mosel. Hier
mufste meist mit geringen Mitteln gearbeitet
werden und dann schreckte man auch wohl
wegen der grofsen Winterkälte davor zurück
hohe Kirchen zu bauen, während man doch
auch wieder dem niedrigen Bau ein schlankes
Aussehen zu geben wünschte. Beides liefs sich
bei einer zweischiffigen Anlage leicht verbinden.
So finden wir denn hier auch eine ganze Reihe
reizvoller architektonischer Gebilde, die eines
eingehenden Studiums werth sind und die alle
ihre besonderen Gewölbelösungen haben. So
hat der Baumeister in Dümpelfeld den Chor-
bogen möglichst enge gestaltet, um eine ganz
regelmäfsige Gewölbeform zu erzielen, während
er in Bornhofen im Gegentheil den Chorbogen
ganz weggelassen hat, um die Gewölbe der
Kirche und des Chores in einander übergehen
zu lassen. In Wanderath ist noch eine be-
sondere Eigenthümlichkeit des Gewölbes her-
vorzuheben. Um eine wirksame Beleuchtung
des Gewölbes zu erreichen, hat der Baumeister
die Eckrippe getheilt und in die Ecke ein
kleines Fenster eingeschoben. In Ulmen ist
das verhältnifsmäfsig breite Chor aus der Achse
gerückt, wahrscheinlich des älteren Thurmes
wegen, der in seinen beiden Untergeschossen
dem XIII. Jahrh. angehört und leider im
vorigen Jahrhundert einen romanisch sein
sollenden Aufbau erhalten hat. Die Kirche
wurde im Anfang des XVI. Jahrh. gebaut,
wie aus der Inschrift an der Thurmthür her-
vorgeht.
Von den zweischiffigen Kirchen Westfalens
möchte ich noch die Kirche in Padberg, die
zur Pfarrei Beringhausen gehört, erwähnen.
Dieselbe bildet ein Rechteck von 11 x 15 m
innerer Weite und ohne jeglichen Vorsprung
in den Aufsenmauern. Die Kirche war ur-
sprünglich einschiffig geplant, indessen während
der Ausführung geändert, wie aus den Formen
und der Construktion ersichtlich ist. Was hier
besonders auffällt, ist der Umstand, dafs die
Kirche keine Choranlage besitzt. Die Altäre
sind einfach an die Ostwand gestellt. Der
Pfeiler in der Mitte hat einen Querschnitt von
4 m. Die Kirche zeigt in ihrem ältesten Theile
rein romanische Formen, während in dem
neueren Theil bereits der Spitzbogen auftritt.
Kleine, romanische Fenster befanden sich in
Kapitälhöhe des Pfeilers. Im XV. Jahrh. wur-
den Fenster mit Maafswerk eingesetzt, von denen
noch eins erhalten ist.
Es dürfte vielleicht auffallend erscheinen,
dafs keine einzige der alten zweischiffigen
Kirchen ein Kreuzschifl besitzt. Wenn man sich
aber als den Zweck der zweischiffigen Anlage
vergegenwärtigt, dafs der Prediger die ganze
Gemeinde überblicken und jeder Kirchenbe-
sucher den Altar sehen soll, so mufs man zu
dem Schlüsse kommen, dafs ein Kreuzschifl
an einer zweischiffigen Kirche nicht am Platze
1900.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
246
Die Kirche ist 19 m breit und 78 vi lang.
Das Chor hat die volle Breite der Kirche und
ist in sieben Seiten des Zwölfecks geschlossen.
Im Osten lcgen sich fünf Kapellen an das
Chorpolygon und an der Nordseite ein schlan-
ker achteckiger Thurm an. Die Strebepfeiler
sind nach innen gezogen, sodafs unten kleine,
abgeschlossene Kapellen gebildet werden, die
mit ihren schmalen Fenstern und reich pro-
filirten, nach der Kirche hin sich öffnenden
Mauerbögen die grofsen Wandflächen wirkungs-
voll durchbrechen. Die sieben Säulen, welche
das Gewölbe tragen, haben eine Höhe von
21,40 m und dabei nur einen Durchmesser
von 1,30 m. Die Chorapsis hat ein reiches
Sterngewölbe, während die Schiffe mit Kreuz-
gewölben überspannt sind. Unter den Schlufs-
steinen gemessen, hat die Kirche eine Höhe
von 29,00 m.
In der romanischen Bauperiode kommen
zweischiffige Kirchen nur sehr vereinzelt vor»
und dann sind es meist kleine Bauten, oder
die Anlage besteht wie in Seligenthal, Milien,
Opherdike u. a. aus einem Haupt- und
Nebenschiffe. Der Grund mag wohl darin zu
suchen sein, dafs man bei den romanischen,
durch massive Gurtbögen getrennten Gewölben
die Verschiebung der Gurten behufs Freigabe
des Chorbogens und die dadurch bedingte un-
regelmäfsige Gewölbeanlage nur in seltenen
Fällen auszuführen wagte. Die einzige mir be-
kannte Anlage, wo dieser Versuch gemacht
wurde, ist die Kapelle auf dem Schlosse
Reichenberg bei St. Goarshausen. In der rei-
zenden St. Nikolauskapelle in Soest ist der
Chorbogen so tief gelegt, dafs die Gewölbe
oberhalb desselben an die gerade Wand stofsen.
An dem westlich gelegenen Nonnenchor ist der
hoch hinaufgezogene Bogen der Empore durch
eine Säulenstellung getheilt und dadurch der
Stützpunkt für das Gewölbe geschaffen.
Die meisten zweischiffigen Kirchen befinden
sich in der Eifel und an der Mosel. Hier
mufste meist mit geringen Mitteln gearbeitet
werden und dann schreckte man auch wohl
wegen der grofsen Winterkälte davor zurück
hohe Kirchen zu bauen, während man doch
auch wieder dem niedrigen Bau ein schlankes
Aussehen zu geben wünschte. Beides liefs sich
bei einer zweischiffigen Anlage leicht verbinden.
So finden wir denn hier auch eine ganze Reihe
reizvoller architektonischer Gebilde, die eines
eingehenden Studiums werth sind und die alle
ihre besonderen Gewölbelösungen haben. So
hat der Baumeister in Dümpelfeld den Chor-
bogen möglichst enge gestaltet, um eine ganz
regelmäfsige Gewölbeform zu erzielen, während
er in Bornhofen im Gegentheil den Chorbogen
ganz weggelassen hat, um die Gewölbe der
Kirche und des Chores in einander übergehen
zu lassen. In Wanderath ist noch eine be-
sondere Eigenthümlichkeit des Gewölbes her-
vorzuheben. Um eine wirksame Beleuchtung
des Gewölbes zu erreichen, hat der Baumeister
die Eckrippe getheilt und in die Ecke ein
kleines Fenster eingeschoben. In Ulmen ist
das verhältnifsmäfsig breite Chor aus der Achse
gerückt, wahrscheinlich des älteren Thurmes
wegen, der in seinen beiden Untergeschossen
dem XIII. Jahrh. angehört und leider im
vorigen Jahrhundert einen romanisch sein
sollenden Aufbau erhalten hat. Die Kirche
wurde im Anfang des XVI. Jahrh. gebaut,
wie aus der Inschrift an der Thurmthür her-
vorgeht.
Von den zweischiffigen Kirchen Westfalens
möchte ich noch die Kirche in Padberg, die
zur Pfarrei Beringhausen gehört, erwähnen.
Dieselbe bildet ein Rechteck von 11 x 15 m
innerer Weite und ohne jeglichen Vorsprung
in den Aufsenmauern. Die Kirche war ur-
sprünglich einschiffig geplant, indessen während
der Ausführung geändert, wie aus den Formen
und der Construktion ersichtlich ist. Was hier
besonders auffällt, ist der Umstand, dafs die
Kirche keine Choranlage besitzt. Die Altäre
sind einfach an die Ostwand gestellt. Der
Pfeiler in der Mitte hat einen Querschnitt von
4 m. Die Kirche zeigt in ihrem ältesten Theile
rein romanische Formen, während in dem
neueren Theil bereits der Spitzbogen auftritt.
Kleine, romanische Fenster befanden sich in
Kapitälhöhe des Pfeilers. Im XV. Jahrh. wur-
den Fenster mit Maafswerk eingesetzt, von denen
noch eins erhalten ist.
Es dürfte vielleicht auffallend erscheinen,
dafs keine einzige der alten zweischiffigen
Kirchen ein Kreuzschifl besitzt. Wenn man sich
aber als den Zweck der zweischiffigen Anlage
vergegenwärtigt, dafs der Prediger die ganze
Gemeinde überblicken und jeder Kirchenbe-
sucher den Altar sehen soll, so mufs man zu
dem Schlüsse kommen, dafs ein Kreuzschifl
an einer zweischiffigen Kirche nicht am Platze