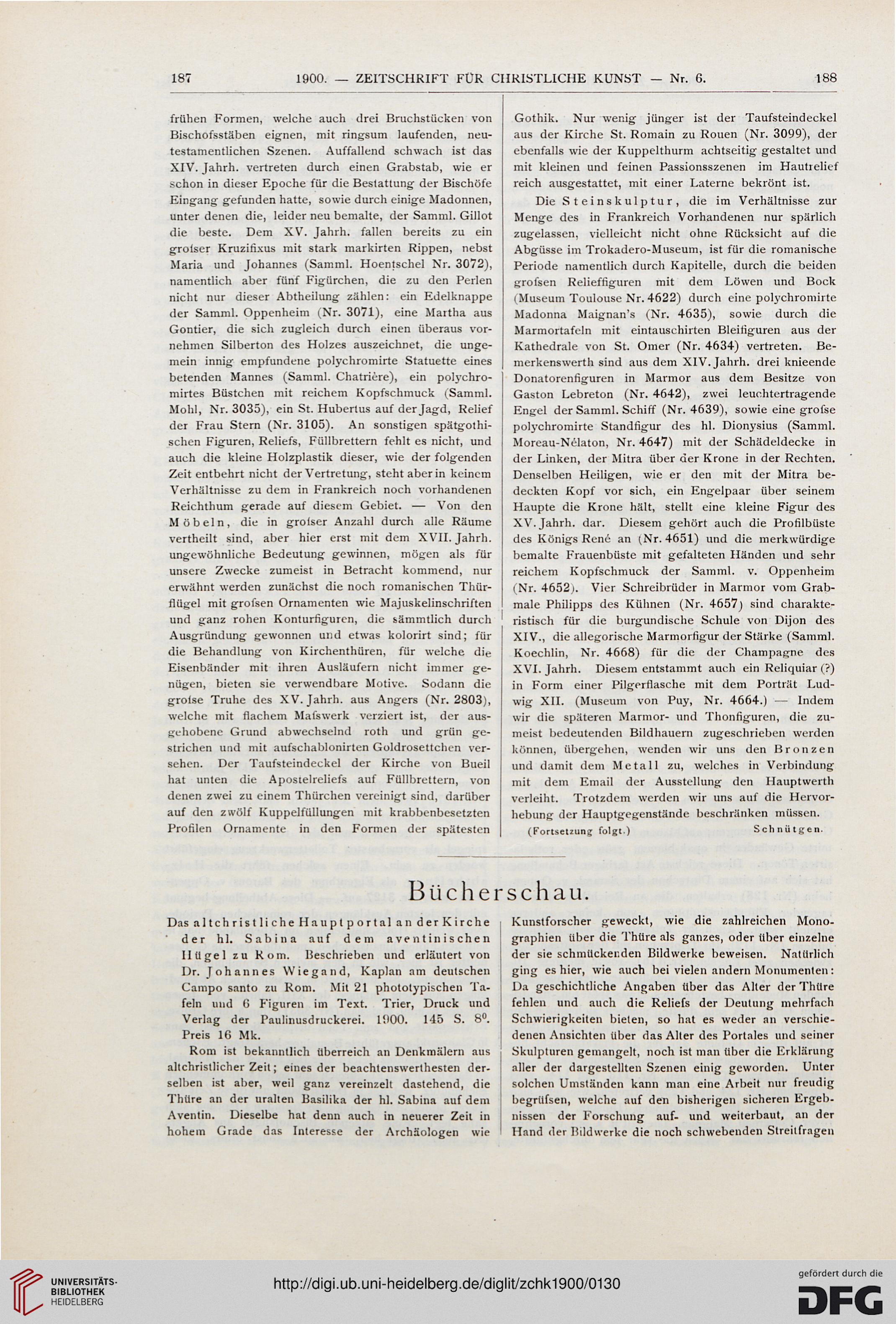187
1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
frühen Formen, welche auch drei Bruchstücken von
Bischofsstäben eignen, mit ringsum laufenden, neu-
testamentlichen Szenen. Auffallend schwach ist das
XIV. Jahrh. vertreten durch einen Grabstab, wie er
schon in dieser Epoche für die Bestattung der Bischöfe
Eingang gefunden hatte, sowie durch einige Madonnen,
unter denen die, leider neu bemalte, der Samml. Gillot
die beste. Dem XV. Jahrh. fallen bereits zu ein
grolser Kruzifixus mit stark markirten Rippen, nebst
Maria und Johannes (Samml. Hoentschel Nr. 3072),
namentlich aber fünf Figürchen, die zu den Perlen
nicht nur dieser Abtheilung zählen: ein Edelknappe
der Samml. Oppenheim (Nr. 3071), eine Martha aus
Gontier, die sich zugleich durch einen überaus vor-
nehmen Silberton des Holzes auszeichnet, die unge-
mein innig empfundene polychromirte Statuette eines
betenden Mannes (Samml. Chatriere), ein polychro-
mirtes Büstchen mit reichem Kopfschmuck (Samml.
Moh!, Nr. 3035), ein St. Hubertus auf der Jagd, Relief
der Frau Stern (Nr. 3105). An sonstigen spätgothi-
schen Figuren, Reliefs, Füllbrettern fehlt es nicht, und
auch die kleine Holzplastik dieser, wie der folgenden
Zeit entbehrt nicht der Vertretung, steht aber in keinem
Verhältnisse zu dem in Frankreich noch vorhandenen
Reichthum gerade auf diesem Gebiet. — Von den
Möbeln, die in grolser Anzahl durch alle Räume
vertheilt sind, aber hier erst mit dem XVII. Jahrh.
ungewöhnliche Bedeutung gewinnen, mögen als für
unsere Zwecke zumeist in Betracht kommend, nur
erwähnt werden zunächst die noch romanischen Thür-
flügel mit grofsen Ornamenten wie Majuskelinschriften
und ganz rohen Konturfiguren, die sämmtlich durch
Ausgründung gewonnen und etwas kolorirt sind; für
die Behandlung von Kirchenthüren, für welche die
Eisenbänder mit ihren Ausläufern nicht immer ge-
nügen, bieten sie verwendbare Motive. Sodann die
groise Truhe des XV. Jahrh. aus Angers (Nr. 2803),
welche mit flachem Mafswerk verziert ist, der aus-
gehobene Grund abwechselnd roth und grün ge-
strichen und mit aufschablonirten Goldrosettchen ver-
sehen. Der Taufsteindeckel der Kirche von Bueil
hat unten die Apostelreliefs auf Füllbrettern, von
denen zwei zu einem Thürchen vereinigt sind, darüber
auf den zwölf Kuppelfüllungen mit krabbenbesetzten
Profilen Ornamente in den Formen der spätesten
Gothik. Nur wenig jünger ist der Taufsteindeckel
aus der Kirche St. Romain zu Rouen (Nr. 3099), der
ebenfalls wie der Kuppelthurm achtseitig gestaltet und
mit kleinen und feinen Passionsszenen im Hautrelief
reich ausgestattet, mit einer Laterne bekrönt ist.
Die Steinskulptur, die im Verhältnisse zur
Menge des in Frankreich Vorhandenen nur spärlich
zugelassen, vielleicht nicht ohne Rücksicht auf die
Abgüsse im Trokadero-Museum, ist für die romanische
Periode namentlich durch Kapitelle, durch die beiden
grofsen Relieffiguren mit dem Löwen und Bock
(Museum Toulouse Nr. 4622) durch eine polychromirte
Madonna Maignan's (Nr. 4635), sowie durch die
Marmortafeln mit eintauschirten Bleifiguren aus der
Kathedrale von St. Omer (Nr. 4634) vertreten. Be-
merkenswerth sind aus dem XIV. Jahrh. drei knieende
Donatorenfiguren in Marmor aus dem Besitze von
Gaston Lebreton (Nr. 4642), zwei leuchtertragende
Engel der Samml. Schiff (Nr. 4639), sowie eine grofse
polychromirte Standfigur des hl. Dionysius (Samml.
Moreau-Nelaton, Nr. 4647) mit der Schädeldecke in
der Linken, der Mitra über der Krone in der Rechten.
Denselben Heiligen, wie er den mit der Mitra be-
deckten Kopf vor sich, ein Engelpaar über seinem
Haupte die Krone hält, stellt eine kleine Figur des
XV. Jahrh. dar. Diesem gehört auch die Profilbüste
des Königs Rene an (Nr. 4651) und die merkwürdige
bemalte F'rauenbüste mit gefalteten Händen und sehr
reichem Kopfschmuck der Samml. v. Oppenheim
(Nr. 46521. Vier Schreibrüder in Marmor vom Grab-
male Philipps des Kühnen (Nr. 4657) sind charakte-
ristisch für die burgundische Schule von Dijon des
XIV., die allegorische Marmorfigur der Stärke (Samml.
Koechlin, Nr. 4668) für die der Champagne des
XVI. Jahrh. Diesem entstammt auch ein Reliquiar (?)
in Form einer Pilgerflasche mit dem Porträt Lud-
wig XII. (Museum von Puy, Nr. 4664.) — Indem
wir die späteren Marmor- und Thonfiguren, die zu-
meist bedeutenden Bildhauern zugeschrieben werden
können, übergehen, wenden wir uns den Bronzen
und damit dem Metall zu, welches in Verbindung
mit dem Email der Ausstellung den Hauptwerth
verleiht. Trotzdem werden wir uns auf die Hervor-
hebung der Hauptgegenstände beschränken müssen.
(Fortsetzung folgt.) Schniitgen.
B ü c 11 e r s c h a u.
Das altchristliche Hauplportal an derKirche
der hl. Sabina auf dem aventinischen
Hügel zu Korn. Iieschrieben und erläutert von
Dr. Johannes Wiegand, Kaplan am deutschen
Campo santo zu Rom. Mit 21 phototypischen Ta-
feln und 6 Figuren im Text. Trier, Druck und
Verlag der Paulinusdruckerei. 11)00. 145 S. 8°.
Preis 16 Mk.
Rom ist bekannllich überreich an Denkmälern aus
altchristlicher Zeit; eines der beachtenswerthesten der-
selben ist aber, weil ganz vereinzelt dastehend, die
Thüre an der uralten Basilika der hl. Sabina auf dem
Aventin. Dieselbe hat denn auch in neuerer Zeil in
hohem Grade das Interesse der Archäologen wie
Kunstforscher geweckt, wie die zahlreichen Mono-
graphien über die Thüre als ganzes, oder über einzelne
der sie schmückenden Bildwerke beweisen. Natürlich
ging es hier, wie auch bei vielen andern Monumenten :
Da geschichtliche Angaben über das Aller der Thüre
fehlen und auch die Reliefs der Deutung mehrfach
Schwierigkeiten bieten, so hat es weder an verschie-
denen Ansichten über das Alter des Portales und seiner
I Skulpturen gemangelt, noch ist man über die Erklärung
aller der dargestellten Szenen einig geworden. Unter
solchen Umständen kann man eine Arbeit nur freudig
begrüfsen, welche auf den bisherigen sicheren Ergeb-
nissen der Forschung auf- und weiterbaut, an der
Hand der Bildwerke die noch schwebenden Streitfragen
1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
frühen Formen, welche auch drei Bruchstücken von
Bischofsstäben eignen, mit ringsum laufenden, neu-
testamentlichen Szenen. Auffallend schwach ist das
XIV. Jahrh. vertreten durch einen Grabstab, wie er
schon in dieser Epoche für die Bestattung der Bischöfe
Eingang gefunden hatte, sowie durch einige Madonnen,
unter denen die, leider neu bemalte, der Samml. Gillot
die beste. Dem XV. Jahrh. fallen bereits zu ein
grolser Kruzifixus mit stark markirten Rippen, nebst
Maria und Johannes (Samml. Hoentschel Nr. 3072),
namentlich aber fünf Figürchen, die zu den Perlen
nicht nur dieser Abtheilung zählen: ein Edelknappe
der Samml. Oppenheim (Nr. 3071), eine Martha aus
Gontier, die sich zugleich durch einen überaus vor-
nehmen Silberton des Holzes auszeichnet, die unge-
mein innig empfundene polychromirte Statuette eines
betenden Mannes (Samml. Chatriere), ein polychro-
mirtes Büstchen mit reichem Kopfschmuck (Samml.
Moh!, Nr. 3035), ein St. Hubertus auf der Jagd, Relief
der Frau Stern (Nr. 3105). An sonstigen spätgothi-
schen Figuren, Reliefs, Füllbrettern fehlt es nicht, und
auch die kleine Holzplastik dieser, wie der folgenden
Zeit entbehrt nicht der Vertretung, steht aber in keinem
Verhältnisse zu dem in Frankreich noch vorhandenen
Reichthum gerade auf diesem Gebiet. — Von den
Möbeln, die in grolser Anzahl durch alle Räume
vertheilt sind, aber hier erst mit dem XVII. Jahrh.
ungewöhnliche Bedeutung gewinnen, mögen als für
unsere Zwecke zumeist in Betracht kommend, nur
erwähnt werden zunächst die noch romanischen Thür-
flügel mit grofsen Ornamenten wie Majuskelinschriften
und ganz rohen Konturfiguren, die sämmtlich durch
Ausgründung gewonnen und etwas kolorirt sind; für
die Behandlung von Kirchenthüren, für welche die
Eisenbänder mit ihren Ausläufern nicht immer ge-
nügen, bieten sie verwendbare Motive. Sodann die
groise Truhe des XV. Jahrh. aus Angers (Nr. 2803),
welche mit flachem Mafswerk verziert ist, der aus-
gehobene Grund abwechselnd roth und grün ge-
strichen und mit aufschablonirten Goldrosettchen ver-
sehen. Der Taufsteindeckel der Kirche von Bueil
hat unten die Apostelreliefs auf Füllbrettern, von
denen zwei zu einem Thürchen vereinigt sind, darüber
auf den zwölf Kuppelfüllungen mit krabbenbesetzten
Profilen Ornamente in den Formen der spätesten
Gothik. Nur wenig jünger ist der Taufsteindeckel
aus der Kirche St. Romain zu Rouen (Nr. 3099), der
ebenfalls wie der Kuppelthurm achtseitig gestaltet und
mit kleinen und feinen Passionsszenen im Hautrelief
reich ausgestattet, mit einer Laterne bekrönt ist.
Die Steinskulptur, die im Verhältnisse zur
Menge des in Frankreich Vorhandenen nur spärlich
zugelassen, vielleicht nicht ohne Rücksicht auf die
Abgüsse im Trokadero-Museum, ist für die romanische
Periode namentlich durch Kapitelle, durch die beiden
grofsen Relieffiguren mit dem Löwen und Bock
(Museum Toulouse Nr. 4622) durch eine polychromirte
Madonna Maignan's (Nr. 4635), sowie durch die
Marmortafeln mit eintauschirten Bleifiguren aus der
Kathedrale von St. Omer (Nr. 4634) vertreten. Be-
merkenswerth sind aus dem XIV. Jahrh. drei knieende
Donatorenfiguren in Marmor aus dem Besitze von
Gaston Lebreton (Nr. 4642), zwei leuchtertragende
Engel der Samml. Schiff (Nr. 4639), sowie eine grofse
polychromirte Standfigur des hl. Dionysius (Samml.
Moreau-Nelaton, Nr. 4647) mit der Schädeldecke in
der Linken, der Mitra über der Krone in der Rechten.
Denselben Heiligen, wie er den mit der Mitra be-
deckten Kopf vor sich, ein Engelpaar über seinem
Haupte die Krone hält, stellt eine kleine Figur des
XV. Jahrh. dar. Diesem gehört auch die Profilbüste
des Königs Rene an (Nr. 4651) und die merkwürdige
bemalte F'rauenbüste mit gefalteten Händen und sehr
reichem Kopfschmuck der Samml. v. Oppenheim
(Nr. 46521. Vier Schreibrüder in Marmor vom Grab-
male Philipps des Kühnen (Nr. 4657) sind charakte-
ristisch für die burgundische Schule von Dijon des
XIV., die allegorische Marmorfigur der Stärke (Samml.
Koechlin, Nr. 4668) für die der Champagne des
XVI. Jahrh. Diesem entstammt auch ein Reliquiar (?)
in Form einer Pilgerflasche mit dem Porträt Lud-
wig XII. (Museum von Puy, Nr. 4664.) — Indem
wir die späteren Marmor- und Thonfiguren, die zu-
meist bedeutenden Bildhauern zugeschrieben werden
können, übergehen, wenden wir uns den Bronzen
und damit dem Metall zu, welches in Verbindung
mit dem Email der Ausstellung den Hauptwerth
verleiht. Trotzdem werden wir uns auf die Hervor-
hebung der Hauptgegenstände beschränken müssen.
(Fortsetzung folgt.) Schniitgen.
B ü c 11 e r s c h a u.
Das altchristliche Hauplportal an derKirche
der hl. Sabina auf dem aventinischen
Hügel zu Korn. Iieschrieben und erläutert von
Dr. Johannes Wiegand, Kaplan am deutschen
Campo santo zu Rom. Mit 21 phototypischen Ta-
feln und 6 Figuren im Text. Trier, Druck und
Verlag der Paulinusdruckerei. 11)00. 145 S. 8°.
Preis 16 Mk.
Rom ist bekannllich überreich an Denkmälern aus
altchristlicher Zeit; eines der beachtenswerthesten der-
selben ist aber, weil ganz vereinzelt dastehend, die
Thüre an der uralten Basilika der hl. Sabina auf dem
Aventin. Dieselbe hat denn auch in neuerer Zeil in
hohem Grade das Interesse der Archäologen wie
Kunstforscher geweckt, wie die zahlreichen Mono-
graphien über die Thüre als ganzes, oder über einzelne
der sie schmückenden Bildwerke beweisen. Natürlich
ging es hier, wie auch bei vielen andern Monumenten :
Da geschichtliche Angaben über das Aller der Thüre
fehlen und auch die Reliefs der Deutung mehrfach
Schwierigkeiten bieten, so hat es weder an verschie-
denen Ansichten über das Alter des Portales und seiner
I Skulpturen gemangelt, noch ist man über die Erklärung
aller der dargestellten Szenen einig geworden. Unter
solchen Umständen kann man eine Arbeit nur freudig
begrüfsen, welche auf den bisherigen sicheren Ergeb-
nissen der Forschung auf- und weiterbaut, an der
Hand der Bildwerke die noch schwebenden Streitfragen