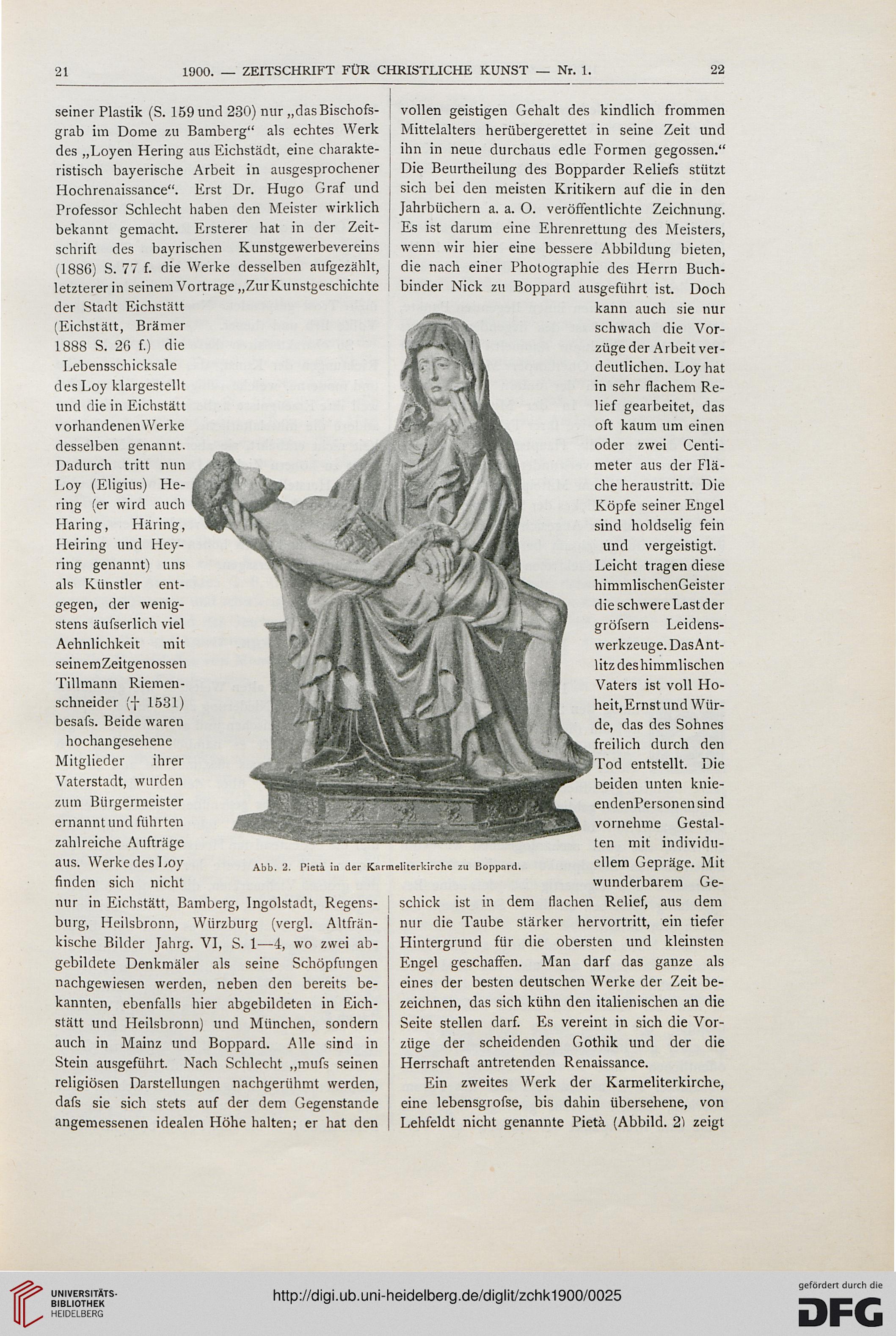21
1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
22
seiner Plastik (S. 159 und 230) nur „dasBisehofs-
grab im Dome zu Bamberg" als echtes Werk
des „Loyen Hering aus Eichstädt, eine charakte-
ristisch bayerische Arbeit in ausgesprochener
Hochrenaissance". Erst Dr. Hugo Graf und
Professor Schlecht haben den Meister wirklich
bekannt gemacht. Ersterer hat in der Zeit-
schrift des bayrischen Kunstgewerbevereins
(1886) S. 77 f. die Werke desselben aufgezählt,
letzterer in seinem Vortrage „Zur Kunstgeschichte
der Stadt Eichstätt
(Eichstätt, Brämer
1888 S. 2G f.) die
Lebensschicksale
desLoy klargestellt
und die in Eichstätt
vorhandenen Werke
desselben genannt.
Dadurch tritt nun
Loy (Eligius) He-
ring (er wird auch
Haring, Häring,
Heiring und Hey-
ring genannt) uns
als Künstler ent-
gegen, der wenig-
stens äufserlich viel
Aehnlichkeit mit
seinemZeitgenossen
Tillmann Riemen-
schneider (+ 1531)
besafs. Beide waren
hochangesehene
Mitglieder ihrer
Vaterstadt, wurden
zum Bürgermeister
ernannt und führten
zahlreiche Aufträge
aus. Werke des Loy
finden sich nicht
nur in Eichstätt, Bamberg, Ingolstadt, Regens-
burg, Heilsbronn, Würzburg (vergl. Altfrän-
kische Bilder Jahrg. VI, S. 1—4, wo zwei ab-
gebildete Denkmäler als seine Schöpfungen
nachgewiesen werden, neben den bereits be-
kannten, ebenfalls hier abgebildeten in Eich-
stätt und Heilsbronn) und München, sondern
auch in Mainz und Boppard. Alle sind in
Stein ausgeführt. Nach Schlecht „mufs seinen
religiösen Darstellungen nachgerühmt werden,
dafs sie sich stets auf der dem Gegenstande
angemessenen idealen Höhe halten; er hat den
Abb.
vollen geistigen Gehalt des kindlich frommen
Mittelalters herübergerettet in seine Zeit und
ihn in neue durchaus edle Formen gegossen."
Die Beurtheilung des Bopparder Reliefs stützt
sich bei den meisten Kritikern auf die in den
Jahrbüchern a. a. O. veröffentlichte Zeichnung.
Es ist darum eine Ehrenrettung des Meisters,
wenn wir hier eine bessere Abbildung bieten,
die nach einer Photographie des Herrn Buch-
binder Nick zu Boppard ausgeführt ist. Doch
kann auch sie nur
schwach die Vor-
züge der Arbeit ver-
deutlichen. Loy hat
in sehr flachem Re-
lief gearbeitet, das
oft kaum um einen
oder zwei Centi-
meter aus der Flä-
che heraustritt. Die
Köpfe seiner Engel
sind holdselig fein
und vergeistigt.
Leicht tragen diese
himmlischenGeister
die schwereLastder
gröfsern Leidens-
werkzeuge. DasAnt-
litz des himmlischen
Vaters ist voll Ho-
heit, Ernst und Wür-
de, das des Sohnes
freilich durch den
Tod entstellt. Die
beiden unten knie-
endenPersonen sind
vornehme Gestal-
ten mit individu-
ellem Gepräge. Mit
wunderbarem Ge-
schick ist in dem flachen Relief, aus dem
nur die Taube stärker hervortritt, ein tiefer
Hintergrund für die obersten und kleinsten
Engel geschaffen. Man darf das ganze als
eines der besten deutschen Werke der Zeit be-
zeichnen, das sich kühn den italienischen an die
Seite stellen darf. Es vereint in sich die Vor-
züge der scheidenden Gothik und der die
Herrschaft antretenden Renaissance.
Ein zweites Werk der Karmeliterkirche,
eine lebensgrofse, bis dahin übersehene, von
Lehfeldt nicht genannte Pietä (Abbild. 2) zeigt
Pietä in der Karmeliterkirche zu Boppnrd
1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
22
seiner Plastik (S. 159 und 230) nur „dasBisehofs-
grab im Dome zu Bamberg" als echtes Werk
des „Loyen Hering aus Eichstädt, eine charakte-
ristisch bayerische Arbeit in ausgesprochener
Hochrenaissance". Erst Dr. Hugo Graf und
Professor Schlecht haben den Meister wirklich
bekannt gemacht. Ersterer hat in der Zeit-
schrift des bayrischen Kunstgewerbevereins
(1886) S. 77 f. die Werke desselben aufgezählt,
letzterer in seinem Vortrage „Zur Kunstgeschichte
der Stadt Eichstätt
(Eichstätt, Brämer
1888 S. 2G f.) die
Lebensschicksale
desLoy klargestellt
und die in Eichstätt
vorhandenen Werke
desselben genannt.
Dadurch tritt nun
Loy (Eligius) He-
ring (er wird auch
Haring, Häring,
Heiring und Hey-
ring genannt) uns
als Künstler ent-
gegen, der wenig-
stens äufserlich viel
Aehnlichkeit mit
seinemZeitgenossen
Tillmann Riemen-
schneider (+ 1531)
besafs. Beide waren
hochangesehene
Mitglieder ihrer
Vaterstadt, wurden
zum Bürgermeister
ernannt und führten
zahlreiche Aufträge
aus. Werke des Loy
finden sich nicht
nur in Eichstätt, Bamberg, Ingolstadt, Regens-
burg, Heilsbronn, Würzburg (vergl. Altfrän-
kische Bilder Jahrg. VI, S. 1—4, wo zwei ab-
gebildete Denkmäler als seine Schöpfungen
nachgewiesen werden, neben den bereits be-
kannten, ebenfalls hier abgebildeten in Eich-
stätt und Heilsbronn) und München, sondern
auch in Mainz und Boppard. Alle sind in
Stein ausgeführt. Nach Schlecht „mufs seinen
religiösen Darstellungen nachgerühmt werden,
dafs sie sich stets auf der dem Gegenstande
angemessenen idealen Höhe halten; er hat den
Abb.
vollen geistigen Gehalt des kindlich frommen
Mittelalters herübergerettet in seine Zeit und
ihn in neue durchaus edle Formen gegossen."
Die Beurtheilung des Bopparder Reliefs stützt
sich bei den meisten Kritikern auf die in den
Jahrbüchern a. a. O. veröffentlichte Zeichnung.
Es ist darum eine Ehrenrettung des Meisters,
wenn wir hier eine bessere Abbildung bieten,
die nach einer Photographie des Herrn Buch-
binder Nick zu Boppard ausgeführt ist. Doch
kann auch sie nur
schwach die Vor-
züge der Arbeit ver-
deutlichen. Loy hat
in sehr flachem Re-
lief gearbeitet, das
oft kaum um einen
oder zwei Centi-
meter aus der Flä-
che heraustritt. Die
Köpfe seiner Engel
sind holdselig fein
und vergeistigt.
Leicht tragen diese
himmlischenGeister
die schwereLastder
gröfsern Leidens-
werkzeuge. DasAnt-
litz des himmlischen
Vaters ist voll Ho-
heit, Ernst und Wür-
de, das des Sohnes
freilich durch den
Tod entstellt. Die
beiden unten knie-
endenPersonen sind
vornehme Gestal-
ten mit individu-
ellem Gepräge. Mit
wunderbarem Ge-
schick ist in dem flachen Relief, aus dem
nur die Taube stärker hervortritt, ein tiefer
Hintergrund für die obersten und kleinsten
Engel geschaffen. Man darf das ganze als
eines der besten deutschen Werke der Zeit be-
zeichnen, das sich kühn den italienischen an die
Seite stellen darf. Es vereint in sich die Vor-
züge der scheidenden Gothik und der die
Herrschaft antretenden Renaissance.
Ein zweites Werk der Karmeliterkirche,
eine lebensgrofse, bis dahin übersehene, von
Lehfeldt nicht genannte Pietä (Abbild. 2) zeigt
Pietä in der Karmeliterkirche zu Boppnrd