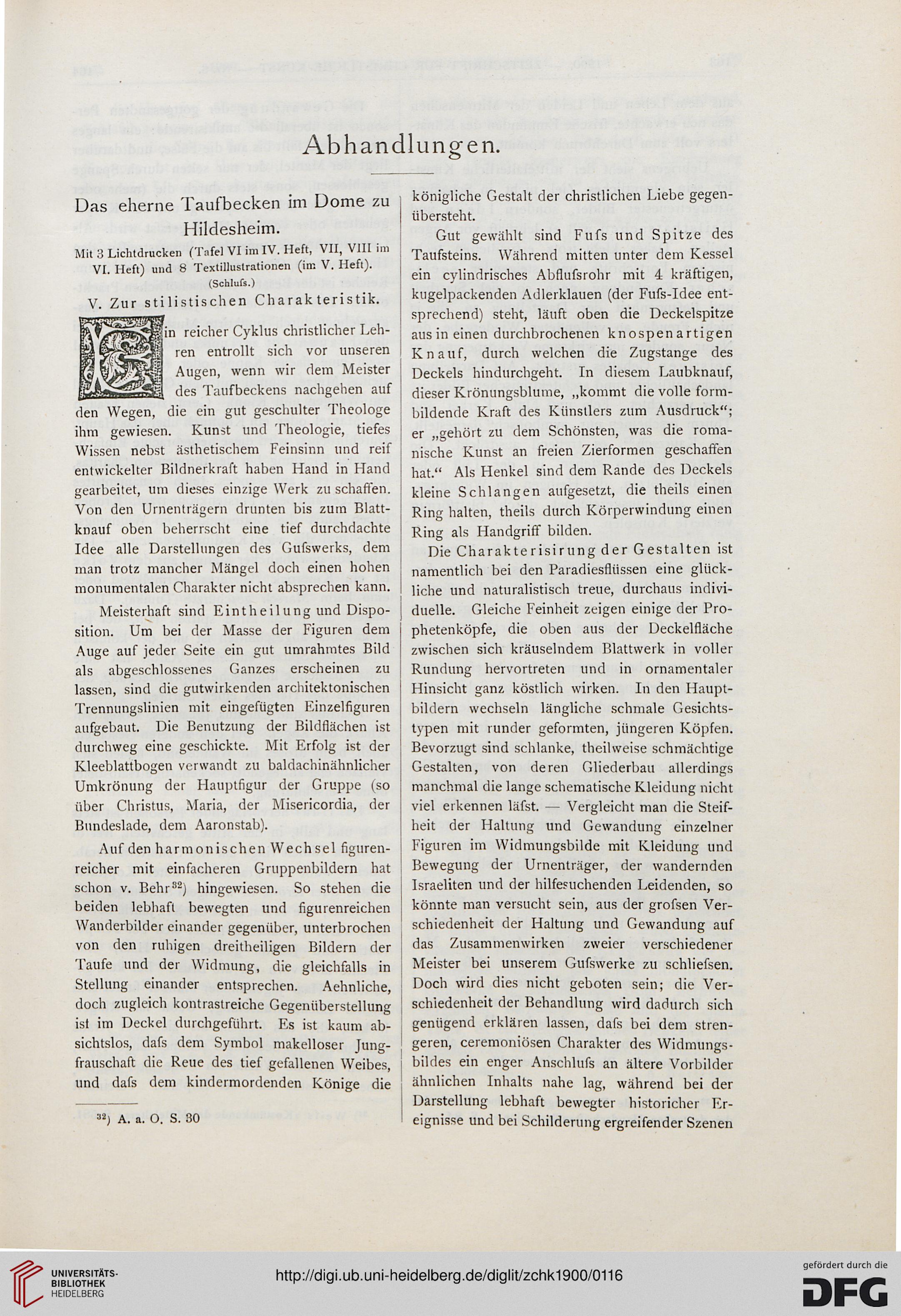Abhandlungen.
Das eherne Taufbecken im Dome zu
Hildesheim.
Mit 3 Lichtdrucken (Tafel VI im IV. Heft, VII, VIII im
VI. Heft) und 8 Textilluslrationen (im V. Heft).
(Schlufs.)
V. Zur stilistischen Charakteristik.
in reicher Cyklus christlicher Leh-
ren entrollt sich vor unseren
Augen, wenn wir dem Meister
des Taufbeckens nachgehen auf
den Wegen, die ein gut geschulter Theologe
ihm gewiesen. Kunst und Theologie, tiefes
Wissen nebst ästhetischem Feinsinn und reif
entwickelter Bildnerkraft haben Hand in Hand
gearbeitet, um dieses einzige Werk zu schaffen.
Von den Urnenträgern drunten bis zum Blatt-
knauf oben beherrscht eine tief durchdachte
Idee alle Darstellungen des Gufswerks, dem
man trotz mancher Mängel doch einen hohen
monumentalen Charakter nicht absprechen kann.
Meisterhaft sind Eintheilung und Dispo-
sition. Um bei der Masse der Figuren dem
Auge auf jeder Seite ein gut umrahmtes Bild
als abgeschlossenes Ganzes erscheinen zu
lassen, sind die gutwirkenden architektonischen
Trennungslinien mit eingefügten Einzelfiguren
aufgebaut. Die Benutzung der Bildflächen ist
durchweg eine geschickte. Mit Erfolg ist der
Kleeblattbogen verwandt zu baldachinähnlicher
Umkrönung der Hauptfigur der Gruppe (so
über Christus, Maria, der Misericordia, der
Bundeslade, dem Aaronstab).
Auf den harmonischen Wechsel figuren-
reicher mit einfacheren Gruppenbildern hat
schon v. Behr32) hingewiesen. So stehen die
beiden lebhaft bewegten und figurenreichen
Wanderbilder einander gegenüber, unterbrochen
von den ruhigen dreitheiligen Bildern der
Taufe und der Widmung, die gleichfalls in
Stellung einander entsprechen. Aehnliche,
doch zugleich kontrastreiche Gegenüberstellung
ist im Deckel durchgeführt. Es ist kaum ab-
sichtslos, dafs dem Symbol makelloser Jung-
frauschaft die Reue des tief gefallenen Weibes,
und dafs dem kindermordenden Könige die
») A. a. O. S. 30
königliche Gestalt der christlichen Liebe gegen-
übersteht.
Gut gewählt sind Fufs und Spitze des
Taufsteins. Während mitten unter dem Kessel
ein cylindrisches Abflufsrohr mit 4 kräftigen,
kugelpackenden Adlerklauen (der Fufs-Idee ent-
sprechend) steht, läuft oben die Deckelspitze
aus in einen durchbrochenen knospen artigen
Knauf, durch welchen die Zugstange des
Deckels hindurchgeht. In diesem Laubknauf,
dieser Krönungsblume, „kommt die volle form-
bildende Kraft des Künstlers zum Ausdruck";
er „gehört zu dem Schönsten, was die roma-
nische Kunst an freien Zierformen geschaffen
hat." Als Henkel sind dem Rande des Deckels
kleine Schlangen aufgesetzt, die theils einen
Ring halten, theils durch Körperwindung einen
Ring als Handgriff bilden.
Die Charakterisirung der Gestalten ist
namentlich bei den Paradiesflüssen eine glück-
liche und naturalistisch treue, durchaus indivi-
duelle. Gleiche Feinheit zeigen einige der Pro-
phetenköpfe, die oben aus der Deckelfläche
zwischen sich kräuselndem Blattwerk in voller
Rundung hervortreten und in ornamentaler
Hinsicht ganz köstlich wirken. In den Haupt-
bildern wechseln längliche schmale Gesichts-
typen mit runder geformten, jüngeren Köpfen.
Bevorzugt sind schlanke, theilweise schmächtige
Gestalten, von deren Gliederbau allerdings
manchmal die lange schematische Kleidung nicht
viel erkennen läfst. — Vergleicht man die Steif-
heit der Haltung und Gewandung einzelner
Figuren im Widmungsbilde mit Kleidung und
Bewegung der Urnenträger, der wandernden
Israeliten und der hilfesuchenden Leidenden, so
könnte man versucht sein, aus der grofsen Ver-
schiedenheit der Haltung und Gewandung auf
das Zusammenwirken zweier verschiedener
Meister bei unserem Gufswerke zu schliefsen.
Doch wird dies nicht geboten sein; die Ver-
schiedenheit der Behandlung wird dadurch sich
genügend erklären lassen, dafs bei dem stren-
geren, ceremoniösen Charakter des Widmungs-
bildes ein enger Anschlufs an ältere Vorbilder
ähnlichen Inhalts nahe lag, während bei der
Darstellung lebhaft bewegter historicher Er-
eignisse und bei Schilderung ergreifender Szenen
Das eherne Taufbecken im Dome zu
Hildesheim.
Mit 3 Lichtdrucken (Tafel VI im IV. Heft, VII, VIII im
VI. Heft) und 8 Textilluslrationen (im V. Heft).
(Schlufs.)
V. Zur stilistischen Charakteristik.
in reicher Cyklus christlicher Leh-
ren entrollt sich vor unseren
Augen, wenn wir dem Meister
des Taufbeckens nachgehen auf
den Wegen, die ein gut geschulter Theologe
ihm gewiesen. Kunst und Theologie, tiefes
Wissen nebst ästhetischem Feinsinn und reif
entwickelter Bildnerkraft haben Hand in Hand
gearbeitet, um dieses einzige Werk zu schaffen.
Von den Urnenträgern drunten bis zum Blatt-
knauf oben beherrscht eine tief durchdachte
Idee alle Darstellungen des Gufswerks, dem
man trotz mancher Mängel doch einen hohen
monumentalen Charakter nicht absprechen kann.
Meisterhaft sind Eintheilung und Dispo-
sition. Um bei der Masse der Figuren dem
Auge auf jeder Seite ein gut umrahmtes Bild
als abgeschlossenes Ganzes erscheinen zu
lassen, sind die gutwirkenden architektonischen
Trennungslinien mit eingefügten Einzelfiguren
aufgebaut. Die Benutzung der Bildflächen ist
durchweg eine geschickte. Mit Erfolg ist der
Kleeblattbogen verwandt zu baldachinähnlicher
Umkrönung der Hauptfigur der Gruppe (so
über Christus, Maria, der Misericordia, der
Bundeslade, dem Aaronstab).
Auf den harmonischen Wechsel figuren-
reicher mit einfacheren Gruppenbildern hat
schon v. Behr32) hingewiesen. So stehen die
beiden lebhaft bewegten und figurenreichen
Wanderbilder einander gegenüber, unterbrochen
von den ruhigen dreitheiligen Bildern der
Taufe und der Widmung, die gleichfalls in
Stellung einander entsprechen. Aehnliche,
doch zugleich kontrastreiche Gegenüberstellung
ist im Deckel durchgeführt. Es ist kaum ab-
sichtslos, dafs dem Symbol makelloser Jung-
frauschaft die Reue des tief gefallenen Weibes,
und dafs dem kindermordenden Könige die
») A. a. O. S. 30
königliche Gestalt der christlichen Liebe gegen-
übersteht.
Gut gewählt sind Fufs und Spitze des
Taufsteins. Während mitten unter dem Kessel
ein cylindrisches Abflufsrohr mit 4 kräftigen,
kugelpackenden Adlerklauen (der Fufs-Idee ent-
sprechend) steht, läuft oben die Deckelspitze
aus in einen durchbrochenen knospen artigen
Knauf, durch welchen die Zugstange des
Deckels hindurchgeht. In diesem Laubknauf,
dieser Krönungsblume, „kommt die volle form-
bildende Kraft des Künstlers zum Ausdruck";
er „gehört zu dem Schönsten, was die roma-
nische Kunst an freien Zierformen geschaffen
hat." Als Henkel sind dem Rande des Deckels
kleine Schlangen aufgesetzt, die theils einen
Ring halten, theils durch Körperwindung einen
Ring als Handgriff bilden.
Die Charakterisirung der Gestalten ist
namentlich bei den Paradiesflüssen eine glück-
liche und naturalistisch treue, durchaus indivi-
duelle. Gleiche Feinheit zeigen einige der Pro-
phetenköpfe, die oben aus der Deckelfläche
zwischen sich kräuselndem Blattwerk in voller
Rundung hervortreten und in ornamentaler
Hinsicht ganz köstlich wirken. In den Haupt-
bildern wechseln längliche schmale Gesichts-
typen mit runder geformten, jüngeren Köpfen.
Bevorzugt sind schlanke, theilweise schmächtige
Gestalten, von deren Gliederbau allerdings
manchmal die lange schematische Kleidung nicht
viel erkennen läfst. — Vergleicht man die Steif-
heit der Haltung und Gewandung einzelner
Figuren im Widmungsbilde mit Kleidung und
Bewegung der Urnenträger, der wandernden
Israeliten und der hilfesuchenden Leidenden, so
könnte man versucht sein, aus der grofsen Ver-
schiedenheit der Haltung und Gewandung auf
das Zusammenwirken zweier verschiedener
Meister bei unserem Gufswerke zu schliefsen.
Doch wird dies nicht geboten sein; die Ver-
schiedenheit der Behandlung wird dadurch sich
genügend erklären lassen, dafs bei dem stren-
geren, ceremoniösen Charakter des Widmungs-
bildes ein enger Anschlufs an ältere Vorbilder
ähnlichen Inhalts nahe lag, während bei der
Darstellung lebhaft bewegter historicher Er-
eignisse und bei Schilderung ergreifender Szenen