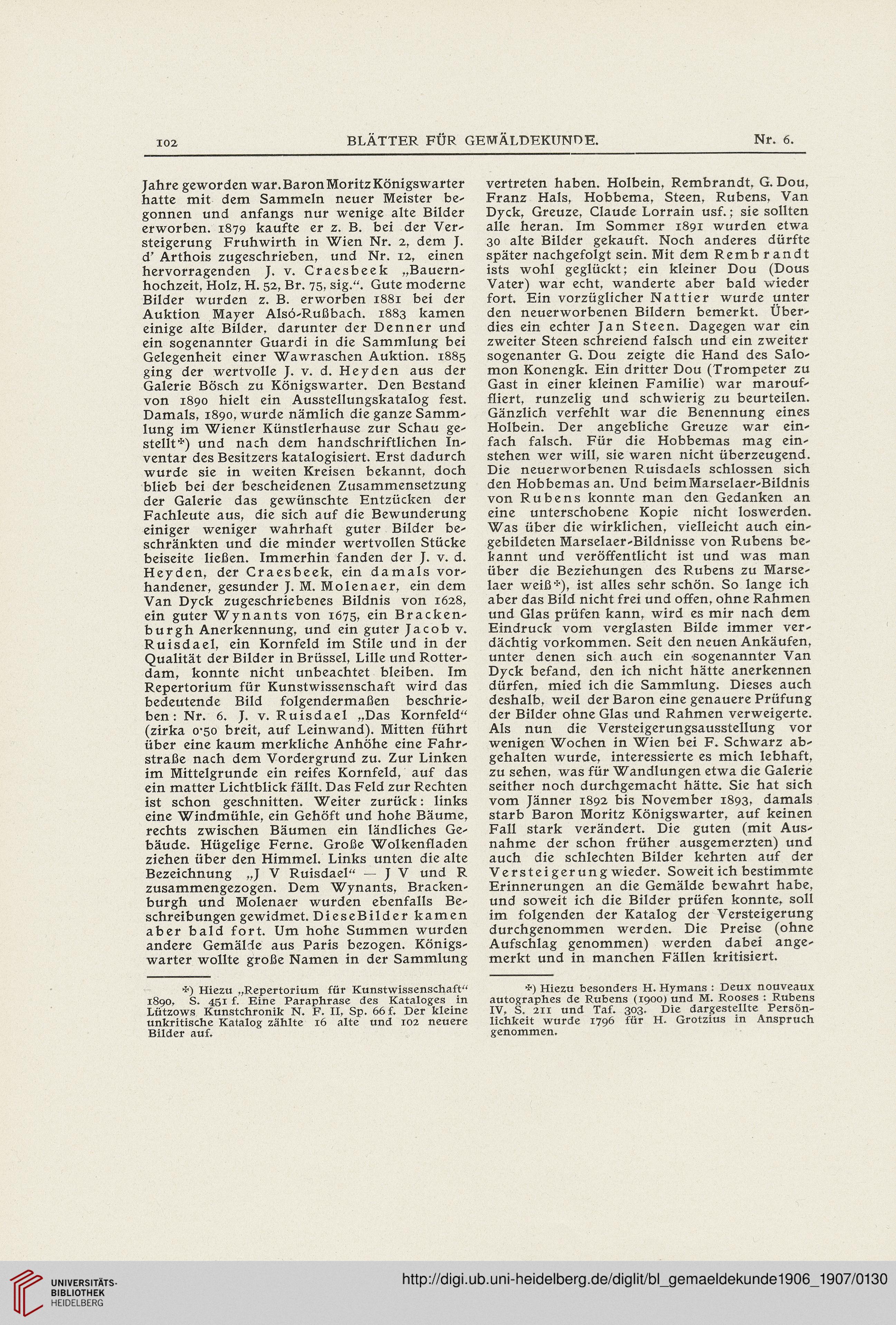102
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
Nr. 6.
Jahre geworden war. Baron Moritz Königswarter
hatte mit dem Sammeln neuer Meister be-
gonnen und anfangs nur wenige alte Bilder
erworben. 1879 kaufte er z. B. bei der Ver-
steigerung Fruhwirth in Wien Nr. 2, dem J.
d’ Ärthois zugeschrieben, und Nr. 12, einen
hervorragenden J. v. Craesbeek „Bauern-
hochzeit, Holz, H. 52, Br. 75, sig.“. Gute moderne
Bilder wurden z. B. erworben 1881 bei der
Auktion Mayer Alsö-Rußbach. 1883 kamen
einige alte Bilder, darunter der Denner und
ein sogenannter Guardi in die Sammlung bei
Gelegenheit einer Wawraschen Auktion. 1885
ging der wertvolle J. v. d. Heyden aus der
Galerie Bösch zu Königswarter. Den Bestand
von 1890 hielt ein Ausstellungskatalog fest.
Damals, 1890, wurde nämlich die ganze Samm-
lung im Wiener Künstlerhause zur Schau ge-
stellt*) und nach dem handschriftlichen In-
ventar des Besitzers katalogisiert. Erst dadurch
wurde sie in weiten Kreisen bekannt, doch
blieb bei der bescheidenen Zusammensetzung
der Galerie das gewünschte Entzücken der
Fachleute aus, die sich auf die Bewunderung
einiger weniger wahrhaft guter Bilder be-
schränkten und die minder wertvollen Stücke
beiseite ließen. Immerhin fanden der J. v. d.
Heyden, der Craesbeek, ein damals vor-
handener, gesunder J. M. Molenaer, ein dem
Van Dyck zugeschriebenes Bildnis von 1628,
ein guter Wynants von 1675, ein Bracken-
burgh Anerkennung, und ein guter Jacob v.
Ruisdael, ein Kornfeld im Stile und in der
Qualität der Bilder in Brüssel, Lille und Rotter-
dam, konnte nicht unbeachtet bleiben. Im
Repertorium für Kunstwissenschaft wird das
bedeutende Bild folgendermaßen beschrie-
ben: Nr. 6. J. v. Ruisdael „Das Kornfeld“
(zirka o\5o breit, auf Leinwand). Mitten führt
über eine kaum merkliche Anhöhe eine Fahr-
straße nach dem Vordergrund zu. Zur Linken
im Mittelgründe ein reifes Kornfeld, auf das
ein matter Lichtblick fällt. Das Feld zur Rechten
ist schon geschnitten. Weiter zurück: links
eine Windmühle, ein Gehöft und hohe Bäume,
rechts zwischen Bäumen ein ländliches Ge-
bäude. Hügelige Ferne. Große Wolkenfladen
ziehen über den Himmel. Links unten die alte
Bezeichnung „J V Ruisdael“ — J V und R
zusammengezogen. Dem Wynants, Bracken-
burgh und Molenaer wurden ebenfalls Be-
schreibungen gewidmet. DieseBilder kamen
aber bald fort. Um hohe Summen wurden
andere Gemälde aus Paris bezogen. Königs-
warter wollte große Namen in der Sammlung
*) Hiezu „Repertorium für Kunstwissenschaft“
1890, S. 451 f. Eine Paraphrase des Kataloges in
Lützows Kunstchronik N. F. II, Sp. 66 f. Der kleine
unkritische Katalog zählte 16 alte und 102 neuere
Bilder auf.
vertreten haben. Holbein, Rembrandt, G. Dou,
Franz Hals, Hobbema, Steen, Rubens, Van
Dyck, Greuze, Claude Lorrain usf.; sie sollten
alle heran. Im Sommer 1891 wurden etwa
30 alte Bilder gekauft. Noch anderes dürfte
später nachgefolgt sein. Mit dem Rembrandt
ists wohl geglückt; ein kleiner Dou (Dous
Vater) war echt, wanderte aber bald wieder
fort. Ein vorzüglicher Nattier wurde unter
den neuerworbenen Bildern bemerkt. Über-
dies ein echter Jan Steen. Dagegen war ein
zweiter Steen schreiend falsch und ein zweiter
sogenanter G. Dou zeigte die Hand des Salo-
mon Konengk. Ein dritter Dou (Trompeter zu
Gast in einer kleinen Familiel war marouf-
fliert, runzelig und schwierig zu beurteilen.
Gänzlich verfehlt war die Benennung eines
Holbein. Der angebliche Greuze war ein-
fach falsch. Für die Hobbemas mag ein-
stehen wer will, sie waren nicht überzeugend.
Die neuerworbenen Ruisdaels schlossen sich
den Hobbemas an. Und beim Marselaer-Bildnis
von Rubens konnte man den Gedanken an
eine unterschobene Kopie nicht loswerden.
Was über die wirklichen, vielleicht auch ein-
gebildeten Marselaer-Bildnisse von Rubens be-
kannt und veröffentlicht ist und was man
über die Beziehungen des Rubens zu Marse-
laer weiß*), ist alles sehr schön. So lange ich
aber das Bild nicht frei und offen, ohne Rahmen
und Glas prüfen kann, wird es mir nach dem
Eindruck vom verglasten Bilde immer ver-
dächtig Vorkommen. Seit den neuen Ankäufen,
unter denen sich auch ein sogenannter Van
Dyck befand, den ich nicht hätte anerkennen
dürfen, mied ich die Sammlung. Dieses auch
deshalb, weil der Baron eine genauere Prüfung
der Bilder ohne Glas und Rahmen verweigerte.
Als nun die Versteigerungsausstellung vor
wenigen Wochen in Wien bei F. Schwarz ab-
gehalten wurde, interessierte es mich lebhaft,
zu sehen, was für Wandlungen etwa die Galerie
seither noch durchgemacht hätte. Sie hat sich
vom Jänner 1892 bis November 1893, damals
starb Baron Moritz Königswarter, auf keinen
Fall stark verändert. Die guten (mit Aus-
nahme der schon früher ausgemerzten) und
auch die schlechten Bilder kehrten auf der
Versteigerung wieder. Soweit ich bestimmte
Erinnerungen an die Gemälde bewahrt habe,
und soweit ich die Bilder prüfen konnte, soll
im folgenden der Katalog der Versteigerung
durchgenommen werden. Die Preise (ohne
Aufschlag genommen) werden dabei ange-
merkt und in manchen Fällen kritisiert.
*) Hiezu besonders H. Hymans : Deux nouveaux
autographes de Rubens (1900) und M. Rooses : Rubens
IV, S. 211 und Taf. 303. Die dargestellte Persön-
lichkeit wurde 1796 für H. Grotzius in Anspruch
genommen.
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
Nr. 6.
Jahre geworden war. Baron Moritz Königswarter
hatte mit dem Sammeln neuer Meister be-
gonnen und anfangs nur wenige alte Bilder
erworben. 1879 kaufte er z. B. bei der Ver-
steigerung Fruhwirth in Wien Nr. 2, dem J.
d’ Ärthois zugeschrieben, und Nr. 12, einen
hervorragenden J. v. Craesbeek „Bauern-
hochzeit, Holz, H. 52, Br. 75, sig.“. Gute moderne
Bilder wurden z. B. erworben 1881 bei der
Auktion Mayer Alsö-Rußbach. 1883 kamen
einige alte Bilder, darunter der Denner und
ein sogenannter Guardi in die Sammlung bei
Gelegenheit einer Wawraschen Auktion. 1885
ging der wertvolle J. v. d. Heyden aus der
Galerie Bösch zu Königswarter. Den Bestand
von 1890 hielt ein Ausstellungskatalog fest.
Damals, 1890, wurde nämlich die ganze Samm-
lung im Wiener Künstlerhause zur Schau ge-
stellt*) und nach dem handschriftlichen In-
ventar des Besitzers katalogisiert. Erst dadurch
wurde sie in weiten Kreisen bekannt, doch
blieb bei der bescheidenen Zusammensetzung
der Galerie das gewünschte Entzücken der
Fachleute aus, die sich auf die Bewunderung
einiger weniger wahrhaft guter Bilder be-
schränkten und die minder wertvollen Stücke
beiseite ließen. Immerhin fanden der J. v. d.
Heyden, der Craesbeek, ein damals vor-
handener, gesunder J. M. Molenaer, ein dem
Van Dyck zugeschriebenes Bildnis von 1628,
ein guter Wynants von 1675, ein Bracken-
burgh Anerkennung, und ein guter Jacob v.
Ruisdael, ein Kornfeld im Stile und in der
Qualität der Bilder in Brüssel, Lille und Rotter-
dam, konnte nicht unbeachtet bleiben. Im
Repertorium für Kunstwissenschaft wird das
bedeutende Bild folgendermaßen beschrie-
ben: Nr. 6. J. v. Ruisdael „Das Kornfeld“
(zirka o\5o breit, auf Leinwand). Mitten führt
über eine kaum merkliche Anhöhe eine Fahr-
straße nach dem Vordergrund zu. Zur Linken
im Mittelgründe ein reifes Kornfeld, auf das
ein matter Lichtblick fällt. Das Feld zur Rechten
ist schon geschnitten. Weiter zurück: links
eine Windmühle, ein Gehöft und hohe Bäume,
rechts zwischen Bäumen ein ländliches Ge-
bäude. Hügelige Ferne. Große Wolkenfladen
ziehen über den Himmel. Links unten die alte
Bezeichnung „J V Ruisdael“ — J V und R
zusammengezogen. Dem Wynants, Bracken-
burgh und Molenaer wurden ebenfalls Be-
schreibungen gewidmet. DieseBilder kamen
aber bald fort. Um hohe Summen wurden
andere Gemälde aus Paris bezogen. Königs-
warter wollte große Namen in der Sammlung
*) Hiezu „Repertorium für Kunstwissenschaft“
1890, S. 451 f. Eine Paraphrase des Kataloges in
Lützows Kunstchronik N. F. II, Sp. 66 f. Der kleine
unkritische Katalog zählte 16 alte und 102 neuere
Bilder auf.
vertreten haben. Holbein, Rembrandt, G. Dou,
Franz Hals, Hobbema, Steen, Rubens, Van
Dyck, Greuze, Claude Lorrain usf.; sie sollten
alle heran. Im Sommer 1891 wurden etwa
30 alte Bilder gekauft. Noch anderes dürfte
später nachgefolgt sein. Mit dem Rembrandt
ists wohl geglückt; ein kleiner Dou (Dous
Vater) war echt, wanderte aber bald wieder
fort. Ein vorzüglicher Nattier wurde unter
den neuerworbenen Bildern bemerkt. Über-
dies ein echter Jan Steen. Dagegen war ein
zweiter Steen schreiend falsch und ein zweiter
sogenanter G. Dou zeigte die Hand des Salo-
mon Konengk. Ein dritter Dou (Trompeter zu
Gast in einer kleinen Familiel war marouf-
fliert, runzelig und schwierig zu beurteilen.
Gänzlich verfehlt war die Benennung eines
Holbein. Der angebliche Greuze war ein-
fach falsch. Für die Hobbemas mag ein-
stehen wer will, sie waren nicht überzeugend.
Die neuerworbenen Ruisdaels schlossen sich
den Hobbemas an. Und beim Marselaer-Bildnis
von Rubens konnte man den Gedanken an
eine unterschobene Kopie nicht loswerden.
Was über die wirklichen, vielleicht auch ein-
gebildeten Marselaer-Bildnisse von Rubens be-
kannt und veröffentlicht ist und was man
über die Beziehungen des Rubens zu Marse-
laer weiß*), ist alles sehr schön. So lange ich
aber das Bild nicht frei und offen, ohne Rahmen
und Glas prüfen kann, wird es mir nach dem
Eindruck vom verglasten Bilde immer ver-
dächtig Vorkommen. Seit den neuen Ankäufen,
unter denen sich auch ein sogenannter Van
Dyck befand, den ich nicht hätte anerkennen
dürfen, mied ich die Sammlung. Dieses auch
deshalb, weil der Baron eine genauere Prüfung
der Bilder ohne Glas und Rahmen verweigerte.
Als nun die Versteigerungsausstellung vor
wenigen Wochen in Wien bei F. Schwarz ab-
gehalten wurde, interessierte es mich lebhaft,
zu sehen, was für Wandlungen etwa die Galerie
seither noch durchgemacht hätte. Sie hat sich
vom Jänner 1892 bis November 1893, damals
starb Baron Moritz Königswarter, auf keinen
Fall stark verändert. Die guten (mit Aus-
nahme der schon früher ausgemerzten) und
auch die schlechten Bilder kehrten auf der
Versteigerung wieder. Soweit ich bestimmte
Erinnerungen an die Gemälde bewahrt habe,
und soweit ich die Bilder prüfen konnte, soll
im folgenden der Katalog der Versteigerung
durchgenommen werden. Die Preise (ohne
Aufschlag genommen) werden dabei ange-
merkt und in manchen Fällen kritisiert.
*) Hiezu besonders H. Hymans : Deux nouveaux
autographes de Rubens (1900) und M. Rooses : Rubens
IV, S. 211 und Taf. 303. Die dargestellte Persön-
lichkeit wurde 1796 für H. Grotzius in Anspruch
genommen.