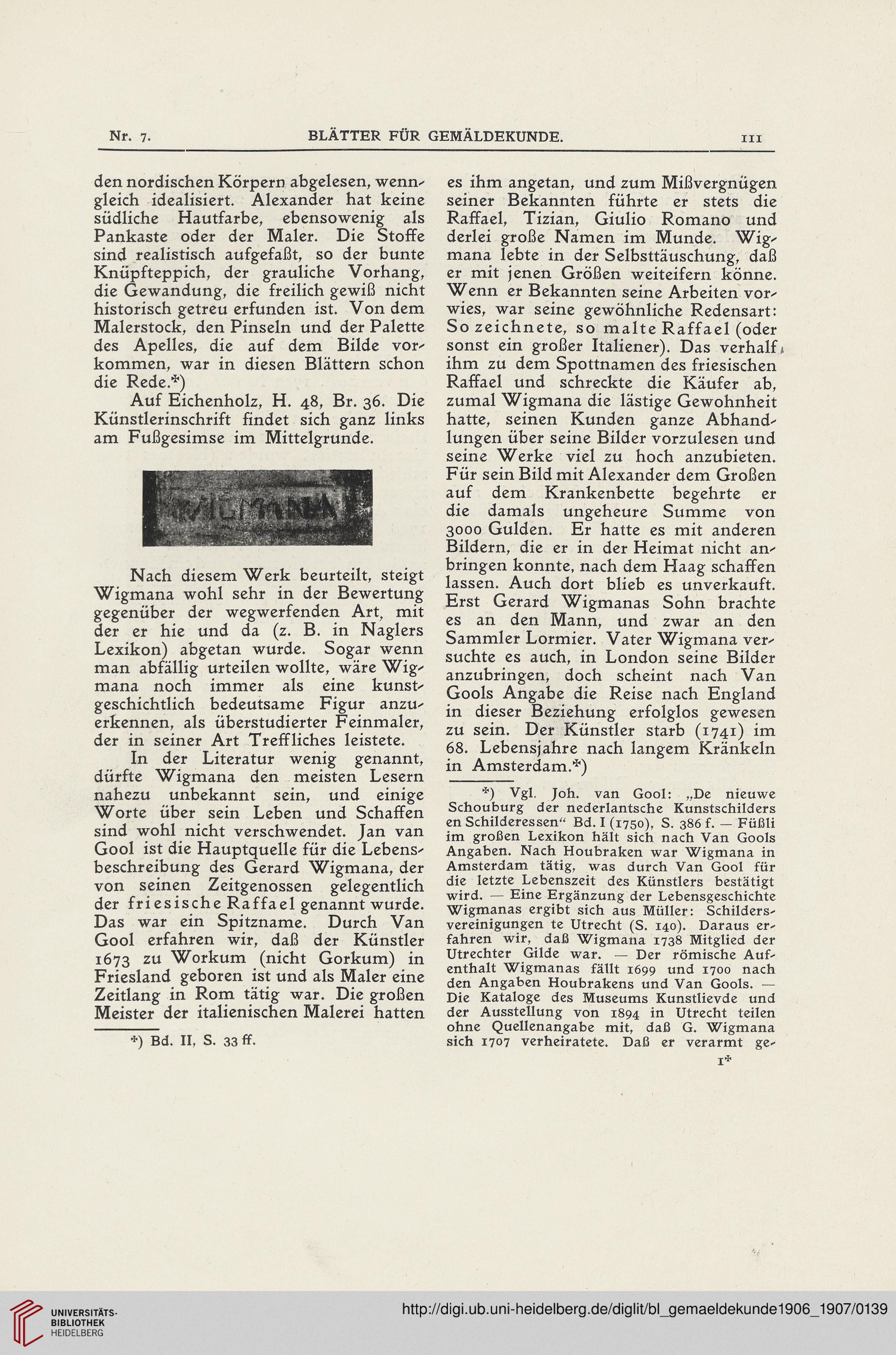Nr. 7.
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
ui
den nordischen Körpern abgelesen, wenn-
gleich idealisiert. Alexander hat keine
südliche Hautfarbe, ebensowenig als
Pankaste oder der Maler. Die Stoffe
sind realistisch aufgefaßt, so der bunte
Knüpfteppich, der grauliche Vorhang,
die Gewandung, die freilich gewiß nicht
historisch getreu erfunden ist. Von dem
Malerstock, den Pinseln und der Palette
des Apelles, die auf dem Bilde Vor-
kommen, war in diesen Blättern schon
die Rede.’1')
Auf Eichenholz, H. 48, Br. 36. Die
Künstlerinschrift findet sich ganz links
am Fußgesimse im Mittelgründe.
Nach diesem Werk beurteilt, steigt
Wigmana wohl sehr in der Bewertung
gegenüber der wegwerfenden Art, mit
der er hie und da (z. B. in Naglers
Lexikon) abgetan wurde. Sogar wenn
man abfällig urteilen wollte, wäre Wig-
mana noch immer als eine kunst-
geschichtlich bedeutsame Figur anzu-
erkennen, als überstudierter Feinmaler,
der in seiner Art Treffliches leistete.
In der Literatur wenig genannt,
dürfte Wigmana den meisten Lesern
nahezu unbekannt sein, und einige
Worte über sein Leben und Schaffen
sind wohl nicht verschwendet. Jan van
Gool ist die Hauptquelle für die Lebens-
beschreibung des Gerard Wigmana, der
von seinen Zeitgenossen gelegentlich
der friesische Raffael genannt wurde.
Das war ein Spitzname. Durch Van
Gool erfahren wir, daß der Künstler
1673 zu Workum (nicht Gorkum) in
Friesland geboren ist und als Maler eine
Zeitlang in Rom tätig war. Die großen
Meister der italienischen Malerei hatten
*) Bd. II, S. 33 ff.
es ihm angetan, und zum Mißvergnügen
seiner Bekannten führte er stets die
Raffael, Tizian, Giulio Romano und
derlei große Namen im Munde. Wig-
mana lebte in der Selbsttäuschung, daß
er mit jenen Größen weiteifern könne.
Wenn er Bekannten seine Arbeiten vor-
wies, war seine gewöhnliche Redensart:
So zeichnete, so malte Raffael (oder
sonst ein großer Italiener). Das verhalf»
ihm zu dem Spottnamen des friesischen
Raffael und schreckte die Käufer ab,
zumal Wigmana die lästige Gewohnheit
hatte, seinen Kunden ganze Abhand-
lungen über seine Bilder vorzulesen und
seine Werke viel zu hoch anzubieten.
Für sein Bild mit Alexander dem Großen
auf dem Krankenbette begehrte er
die damals ungeheure Summe von
3000 Gulden. Er hatte es mit anderen
Bildern, die er in der Heimat nicht an-
bringen konnte, nach dem Haag schaffen
lassen. Auch dort blieb es unverkauft.
Erst Gerard Wigmanas Sohn brachte
es an den Mann, und zwar an den
Sammler Lormier. Vater Wigmana ver-
suchte es auch, in London seine Bilder
anzubringen, doch scheint nach Van
Gools Angabe die Reise nach England
in dieser Beziehung erfolglos gewesen
zu sein. Der Künstler starb (1741) im
68. Lebensjahre nach langem Kränkeln
in Amsterdam.'1')
*) Vgl. Joh. van Gool: „De nieuwe
Schouburg der nederlantsche Kunstschilders
en Schilderessen" Bd. I (1750), S. 386 f. — Füßli
im großen Lexikon hält sich nach Van Gools
Angaben. Nach Houbraken war Wigmana in
Amsterdam tätig, was durch Van Gool für
die letzte Lebenszeit des Künstlers bestätigt
wird. — Eine Ergänzung der Lebensgeschichte
Wigmanas ergibt sich aus Müller: Schilderst
Vereinigungen te Utrecht (S. 140). Daraus er-
fahren wir, daß Wigmana 1738 Mitglied der
Utrechter Gilde war. — Der römische Auf-
enthalt Wigmanas fällt 1699 und 1700 nach
den Angaben Houbrakens und Van Gools. —
Die Kataloge des Museums Kunstlievde und
der Ausstellung von 1894 in Utrecht teilen
ohne Quellenangabe mit, daß G. Wigmana
sich 1707 verheiratete. Daß er verarmt ge-
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
ui
den nordischen Körpern abgelesen, wenn-
gleich idealisiert. Alexander hat keine
südliche Hautfarbe, ebensowenig als
Pankaste oder der Maler. Die Stoffe
sind realistisch aufgefaßt, so der bunte
Knüpfteppich, der grauliche Vorhang,
die Gewandung, die freilich gewiß nicht
historisch getreu erfunden ist. Von dem
Malerstock, den Pinseln und der Palette
des Apelles, die auf dem Bilde Vor-
kommen, war in diesen Blättern schon
die Rede.’1')
Auf Eichenholz, H. 48, Br. 36. Die
Künstlerinschrift findet sich ganz links
am Fußgesimse im Mittelgründe.
Nach diesem Werk beurteilt, steigt
Wigmana wohl sehr in der Bewertung
gegenüber der wegwerfenden Art, mit
der er hie und da (z. B. in Naglers
Lexikon) abgetan wurde. Sogar wenn
man abfällig urteilen wollte, wäre Wig-
mana noch immer als eine kunst-
geschichtlich bedeutsame Figur anzu-
erkennen, als überstudierter Feinmaler,
der in seiner Art Treffliches leistete.
In der Literatur wenig genannt,
dürfte Wigmana den meisten Lesern
nahezu unbekannt sein, und einige
Worte über sein Leben und Schaffen
sind wohl nicht verschwendet. Jan van
Gool ist die Hauptquelle für die Lebens-
beschreibung des Gerard Wigmana, der
von seinen Zeitgenossen gelegentlich
der friesische Raffael genannt wurde.
Das war ein Spitzname. Durch Van
Gool erfahren wir, daß der Künstler
1673 zu Workum (nicht Gorkum) in
Friesland geboren ist und als Maler eine
Zeitlang in Rom tätig war. Die großen
Meister der italienischen Malerei hatten
*) Bd. II, S. 33 ff.
es ihm angetan, und zum Mißvergnügen
seiner Bekannten führte er stets die
Raffael, Tizian, Giulio Romano und
derlei große Namen im Munde. Wig-
mana lebte in der Selbsttäuschung, daß
er mit jenen Größen weiteifern könne.
Wenn er Bekannten seine Arbeiten vor-
wies, war seine gewöhnliche Redensart:
So zeichnete, so malte Raffael (oder
sonst ein großer Italiener). Das verhalf»
ihm zu dem Spottnamen des friesischen
Raffael und schreckte die Käufer ab,
zumal Wigmana die lästige Gewohnheit
hatte, seinen Kunden ganze Abhand-
lungen über seine Bilder vorzulesen und
seine Werke viel zu hoch anzubieten.
Für sein Bild mit Alexander dem Großen
auf dem Krankenbette begehrte er
die damals ungeheure Summe von
3000 Gulden. Er hatte es mit anderen
Bildern, die er in der Heimat nicht an-
bringen konnte, nach dem Haag schaffen
lassen. Auch dort blieb es unverkauft.
Erst Gerard Wigmanas Sohn brachte
es an den Mann, und zwar an den
Sammler Lormier. Vater Wigmana ver-
suchte es auch, in London seine Bilder
anzubringen, doch scheint nach Van
Gools Angabe die Reise nach England
in dieser Beziehung erfolglos gewesen
zu sein. Der Künstler starb (1741) im
68. Lebensjahre nach langem Kränkeln
in Amsterdam.'1')
*) Vgl. Joh. van Gool: „De nieuwe
Schouburg der nederlantsche Kunstschilders
en Schilderessen" Bd. I (1750), S. 386 f. — Füßli
im großen Lexikon hält sich nach Van Gools
Angaben. Nach Houbraken war Wigmana in
Amsterdam tätig, was durch Van Gool für
die letzte Lebenszeit des Künstlers bestätigt
wird. — Eine Ergänzung der Lebensgeschichte
Wigmanas ergibt sich aus Müller: Schilderst
Vereinigungen te Utrecht (S. 140). Daraus er-
fahren wir, daß Wigmana 1738 Mitglied der
Utrechter Gilde war. — Der römische Auf-
enthalt Wigmanas fällt 1699 und 1700 nach
den Angaben Houbrakens und Van Gools. —
Die Kataloge des Museums Kunstlievde und
der Ausstellung von 1894 in Utrecht teilen
ohne Quellenangabe mit, daß G. Wigmana
sich 1707 verheiratete. Daß er verarmt ge-