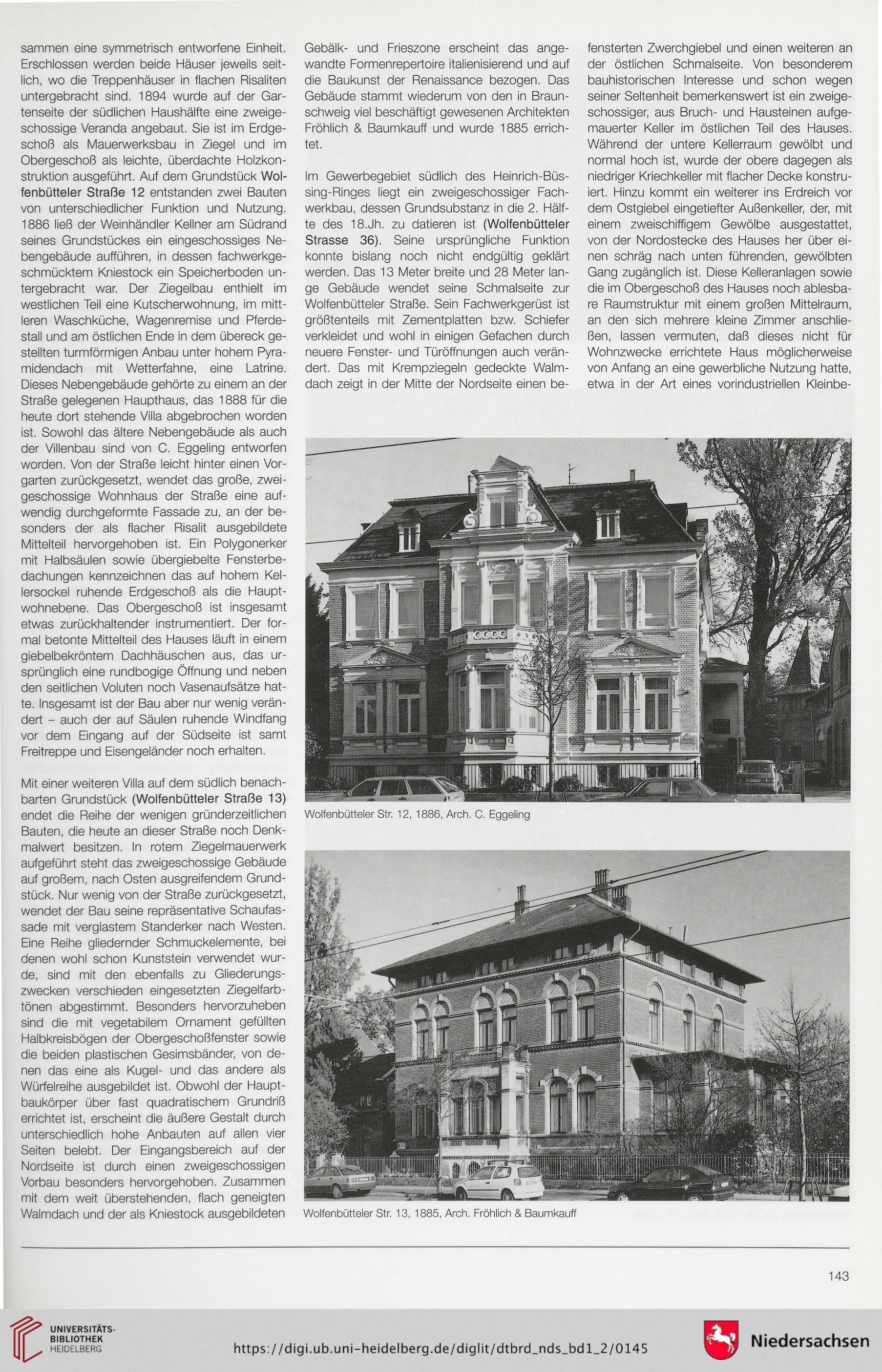sammen eine symmetrisch entworfene Einheit.
Erschlossen werden beide Häuser jeweils seit-
lich, wo die Treppenhäuser in flachen Risaliten
untergebracht sind. 1894 wurde auf der Gar-
tenseite der südlichen Haushälfte eine zweige-
schossige Veranda angebaut. Sie ist im Erdge-
schoß als Mauerwerksbau in Ziegel und im
Obergeschoß als leichte, überdachte Holzkon-
struktion ausgeführt. Auf dem Grundstück Wol-
fenbütteler Straße 12 entstanden zwei Bauten
von unterschiedlicher Funktion und Nutzung.
1886 ließ der Weinhändler Kellner am Südrand
seines Grundstückes ein eingeschossiges Ne-
bengebäude aufführen, in dessen fachwerkge-
schmücktem Kniestock ein Speicherboden un-
tergebracht war. Der Ziegelbau enthielt im
westlichen Teil eine Kutscherwohnung, im mitt-
leren Waschküche, Wagenremise und Pferde-
stall und am östlichen Ende in dem übereck ge-
stellten turmförmigen Anbau unter hohem Pyra-
midendach mit Wetterfahne, eine Latrine.
Dieses Nebengebäude gehörte zu einem an der
Straße gelegenen Haupthaus, das 1888 für die
heute dort stehende Villa abgebrochen worden
ist. Sowohl das ältere Nebengebäude als auch
der Villenbau sind von C. Eggeling entworfen
worden. Von der Straße leicht hinter einen Vor-
garten zurückgesetzt, wendet das große, zwei-
geschossige Wohnhaus der Straße eine auf-
wendig durchgeformte Fassade zu, an der be-
sonders der als flacher Risalit ausgebildete
Mittelteil hervorgehoben ist. Ein Polygonerker
mit Halbsäulen sowie übergiebelte Fensterbe-
dachungen kennzeichnen das auf hohem Kel-
lersockel ruhende Erdgeschoß als die Haupt-
wohnebene. Das Obergeschoß ist insgesamt
etwas zurückhaltender instrumentiert. Der for-
mal betonte Mittelteil des Hauses läuft in einem
giebelbekröntem Dachhäuschen aus, das ur-
sprünglich eine rundbogige Öffnung und neben
den seitlichen Voluten noch Vasenaufsätze hat-
te. Insgesamt ist der Bau aber nur wenig verän-
dert - auch der auf Säulen ruhende Windfang
vor dem Eingang auf der Südseite ist samt
Freitreppe und Eisengeländer noch erhalten.
Mit einer weiteren Villa auf dem südlich benach-
barten Grundstück (Wolfenbütteler Straße 13)
endet die Reihe der wenigen gründerzeitlichen
Bauten, die heute an dieser Straße noch Denk-
malwert besitzen. In rotem Ziegelmauerwerk
aufgeführt steht das zweigeschossige Gebäude
auf großem, nach Osten ausgreifendem Grund-
stück. Nur wenig von der Straße zurückgesetzt,
wendet der Bau seine repräsentative Schaufas-
sade mit verglastem Standerker nach Westen.
Eine Reihe gliedernder Schmuckelemente, bei
denen wohl schon Kunststein verwendet wur-
de, sind mit den ebenfalls zu Gliederungs-
zwecken verschieden eingesetzten Ziegelfarb-
tönen abgestimmt. Besonders hervorzuheben
sind die mit vegetabilem Ornament gefüllten
Halbkreisbögen der Obergeschoßfenster sowie
die beiden plastischen Gesimsbänder, von de-
nen das eine als Kugel- und das andere als
Würfelreihe ausgebildet ist. Obwohl der Haupt-
baukörper über fast quadratischem Grundriß
errichtet ist, erscheint die äußere Gestalt durch
unterschiedlich hohe Anbauten auf allen vier
Seiten belebt. Der Eingangsbereich auf der
Nordseite ist durch einen zweigeschossigen
Vorbau besonders hervorgehoben. Zusammen
mit dem weit überstehenden, flach geneigten
Walmdach und der als Kniestock ausgebildeten
Gebälk- und Frieszone erscheint das ange-
wandte Formenrepertoire italienisierend und auf
die Baukunst der Renaissance bezogen. Das
Gebäude stammt wiederum von den in Braun-
schweig viel beschäftigt gewesenen Architekten
Fröhlich & Baumkauff und wurde 1885 errich-
tet.
Im Gewerbegebiet südlich des Heinrich-Büs-
sing-Ringes liegt ein zweigeschossiger Fach-
werkbau, dessen Grundsubstanz in die 2. Hälf-
te des 18.Jh. zu datieren ist (Wolfenbütteler
Strasse 36). Seine ursprüngliche Funktion
konnte bislang noch nicht endgültig geklärt
werden. Das 13 Meter breite und 28 Meter lan-
ge Gebäude wendet seine Schmalseite zur
Wolfenbütteler Straße. Sein Fachwerkgerüst ist
größtenteils mit Zementplatten bzw. Schiefer
verkleidet und wohl in einigen Gefachen durch
neuere Fenster- und Türöffnungen auch verän-
dert. Das mit Krempziegeln gedeckte Walm-
dach zeigt in der Mitte der Nordseite einen be-
fensterten Zwerchgiebel und einen weiteren an
der östlichen Schmalseite. Von besonderem
bauhistorischen Interesse und schon wegen
seiner Seltenheit bemerkenswert ist ein zweige-
schossiger, aus Bruch- und Hausteinen aufge-
mauerter Keller im östlichen Teil des Hauses.
Während der untere Kellerraum gewölbt und
normal hoch ist, wurde der obere dagegen als
niedriger Kriechkeller mit flacher Decke konstru-
iert. Hinzu kommt ein weiterer ins Erdreich vor
dem Ostgiebel eingetiefter Außenkeller, der, mit
einem zweischiffigem Gewölbe ausgestattet,
von der Nordostecke des Hauses her über ei-
nen schräg nach unten führenden, gewölbten
Gang zugänglich ist. Diese Kelleranlagen sowie
die im Obergeschoß des Hauses noch ablesba-
re Raumstruktur mit einem großen Mittelraum,
an den sich mehrere kleine Zimmer anschlie-
ßen, lassen vermuten, daß dieses nicht für
Wohnzwecke errichtete Haus möglicherweise
von Anfang an eine gewerbliche Nutzung hatte,
etwa in der Art eines vorindustriellen Kleinbe-
Wolfenbütteler Str. 12, 1886, Arch. C. Eggeling
Wolfenbütteler Str. 13, 1885, Arch. Fröhlich & Baumkauff
143
Erschlossen werden beide Häuser jeweils seit-
lich, wo die Treppenhäuser in flachen Risaliten
untergebracht sind. 1894 wurde auf der Gar-
tenseite der südlichen Haushälfte eine zweige-
schossige Veranda angebaut. Sie ist im Erdge-
schoß als Mauerwerksbau in Ziegel und im
Obergeschoß als leichte, überdachte Holzkon-
struktion ausgeführt. Auf dem Grundstück Wol-
fenbütteler Straße 12 entstanden zwei Bauten
von unterschiedlicher Funktion und Nutzung.
1886 ließ der Weinhändler Kellner am Südrand
seines Grundstückes ein eingeschossiges Ne-
bengebäude aufführen, in dessen fachwerkge-
schmücktem Kniestock ein Speicherboden un-
tergebracht war. Der Ziegelbau enthielt im
westlichen Teil eine Kutscherwohnung, im mitt-
leren Waschküche, Wagenremise und Pferde-
stall und am östlichen Ende in dem übereck ge-
stellten turmförmigen Anbau unter hohem Pyra-
midendach mit Wetterfahne, eine Latrine.
Dieses Nebengebäude gehörte zu einem an der
Straße gelegenen Haupthaus, das 1888 für die
heute dort stehende Villa abgebrochen worden
ist. Sowohl das ältere Nebengebäude als auch
der Villenbau sind von C. Eggeling entworfen
worden. Von der Straße leicht hinter einen Vor-
garten zurückgesetzt, wendet das große, zwei-
geschossige Wohnhaus der Straße eine auf-
wendig durchgeformte Fassade zu, an der be-
sonders der als flacher Risalit ausgebildete
Mittelteil hervorgehoben ist. Ein Polygonerker
mit Halbsäulen sowie übergiebelte Fensterbe-
dachungen kennzeichnen das auf hohem Kel-
lersockel ruhende Erdgeschoß als die Haupt-
wohnebene. Das Obergeschoß ist insgesamt
etwas zurückhaltender instrumentiert. Der for-
mal betonte Mittelteil des Hauses läuft in einem
giebelbekröntem Dachhäuschen aus, das ur-
sprünglich eine rundbogige Öffnung und neben
den seitlichen Voluten noch Vasenaufsätze hat-
te. Insgesamt ist der Bau aber nur wenig verän-
dert - auch der auf Säulen ruhende Windfang
vor dem Eingang auf der Südseite ist samt
Freitreppe und Eisengeländer noch erhalten.
Mit einer weiteren Villa auf dem südlich benach-
barten Grundstück (Wolfenbütteler Straße 13)
endet die Reihe der wenigen gründerzeitlichen
Bauten, die heute an dieser Straße noch Denk-
malwert besitzen. In rotem Ziegelmauerwerk
aufgeführt steht das zweigeschossige Gebäude
auf großem, nach Osten ausgreifendem Grund-
stück. Nur wenig von der Straße zurückgesetzt,
wendet der Bau seine repräsentative Schaufas-
sade mit verglastem Standerker nach Westen.
Eine Reihe gliedernder Schmuckelemente, bei
denen wohl schon Kunststein verwendet wur-
de, sind mit den ebenfalls zu Gliederungs-
zwecken verschieden eingesetzten Ziegelfarb-
tönen abgestimmt. Besonders hervorzuheben
sind die mit vegetabilem Ornament gefüllten
Halbkreisbögen der Obergeschoßfenster sowie
die beiden plastischen Gesimsbänder, von de-
nen das eine als Kugel- und das andere als
Würfelreihe ausgebildet ist. Obwohl der Haupt-
baukörper über fast quadratischem Grundriß
errichtet ist, erscheint die äußere Gestalt durch
unterschiedlich hohe Anbauten auf allen vier
Seiten belebt. Der Eingangsbereich auf der
Nordseite ist durch einen zweigeschossigen
Vorbau besonders hervorgehoben. Zusammen
mit dem weit überstehenden, flach geneigten
Walmdach und der als Kniestock ausgebildeten
Gebälk- und Frieszone erscheint das ange-
wandte Formenrepertoire italienisierend und auf
die Baukunst der Renaissance bezogen. Das
Gebäude stammt wiederum von den in Braun-
schweig viel beschäftigt gewesenen Architekten
Fröhlich & Baumkauff und wurde 1885 errich-
tet.
Im Gewerbegebiet südlich des Heinrich-Büs-
sing-Ringes liegt ein zweigeschossiger Fach-
werkbau, dessen Grundsubstanz in die 2. Hälf-
te des 18.Jh. zu datieren ist (Wolfenbütteler
Strasse 36). Seine ursprüngliche Funktion
konnte bislang noch nicht endgültig geklärt
werden. Das 13 Meter breite und 28 Meter lan-
ge Gebäude wendet seine Schmalseite zur
Wolfenbütteler Straße. Sein Fachwerkgerüst ist
größtenteils mit Zementplatten bzw. Schiefer
verkleidet und wohl in einigen Gefachen durch
neuere Fenster- und Türöffnungen auch verän-
dert. Das mit Krempziegeln gedeckte Walm-
dach zeigt in der Mitte der Nordseite einen be-
fensterten Zwerchgiebel und einen weiteren an
der östlichen Schmalseite. Von besonderem
bauhistorischen Interesse und schon wegen
seiner Seltenheit bemerkenswert ist ein zweige-
schossiger, aus Bruch- und Hausteinen aufge-
mauerter Keller im östlichen Teil des Hauses.
Während der untere Kellerraum gewölbt und
normal hoch ist, wurde der obere dagegen als
niedriger Kriechkeller mit flacher Decke konstru-
iert. Hinzu kommt ein weiterer ins Erdreich vor
dem Ostgiebel eingetiefter Außenkeller, der, mit
einem zweischiffigem Gewölbe ausgestattet,
von der Nordostecke des Hauses her über ei-
nen schräg nach unten führenden, gewölbten
Gang zugänglich ist. Diese Kelleranlagen sowie
die im Obergeschoß des Hauses noch ablesba-
re Raumstruktur mit einem großen Mittelraum,
an den sich mehrere kleine Zimmer anschlie-
ßen, lassen vermuten, daß dieses nicht für
Wohnzwecke errichtete Haus möglicherweise
von Anfang an eine gewerbliche Nutzung hatte,
etwa in der Art eines vorindustriellen Kleinbe-
Wolfenbütteler Str. 12, 1886, Arch. C. Eggeling
Wolfenbütteler Str. 13, 1885, Arch. Fröhlich & Baumkauff
143