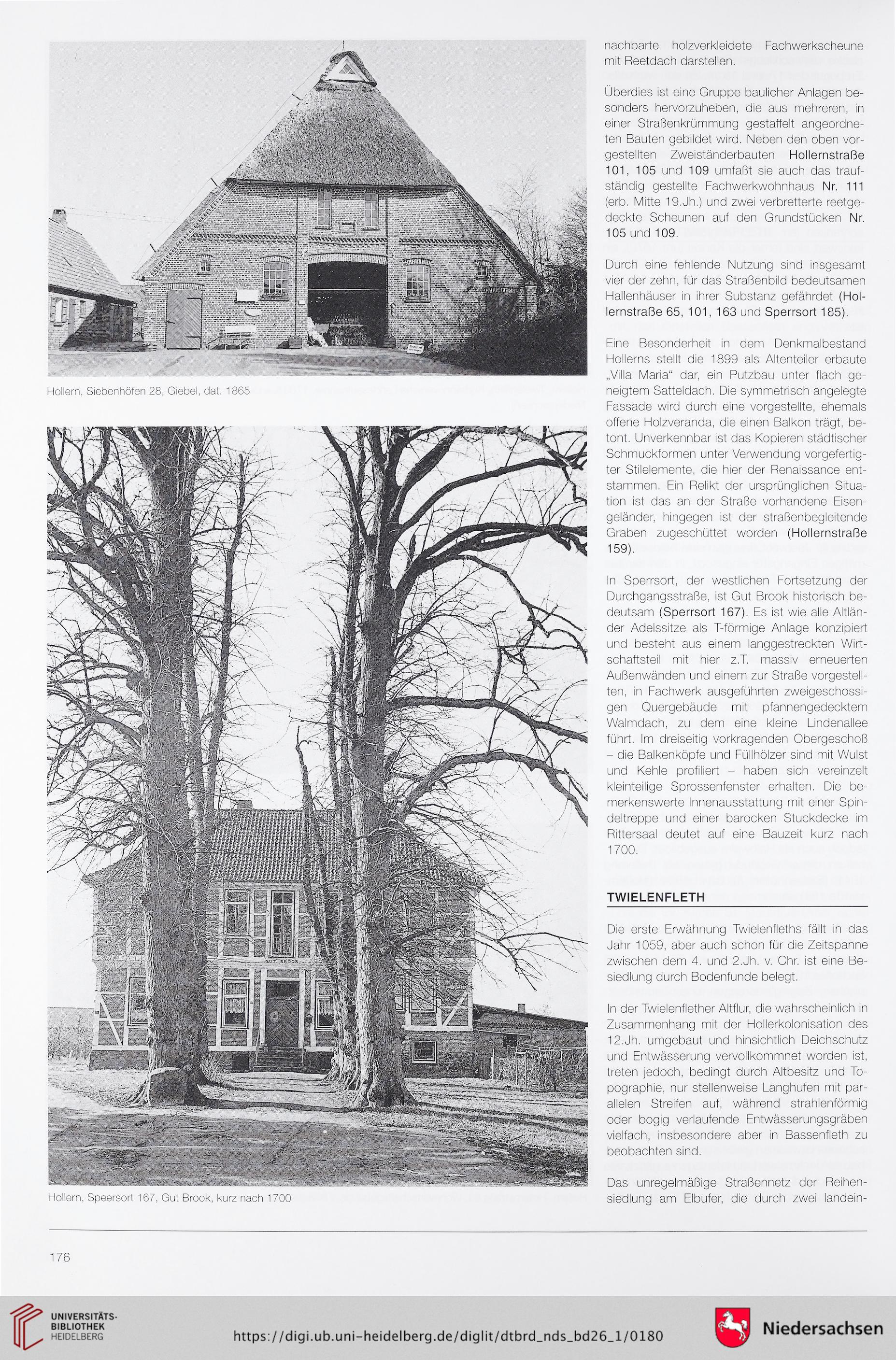Hollem, Siebenhöfen 28, Giebel, dat. 1865
Hollern, Speersort 167, Gut Brook, kurz nach 1700
nachbarte holzverkleidete Fachwerkscheune
mit Reetdach darstellen.
Überdies ist eine Gruppe baulicher Anlagen be-
sonders hervorzuheben, die aus mehreren, in
einer Straßenkrümmung gestaffelt angeordne-
ten Bauten gebildet wird. Neben den oben vor-
gestellten Zweiständerbauten Hollemstraße
101, 105 und 109 umfaßt sie auch das trauf-
ständig gestellte Fachwerkwohnhaus Nr. 111
(erb. Mitte 19.Jh.) und zwei verbreiterte reetge-
deckte Scheunen auf den Grundstücken Nr.
105 und 109.
Durch eine fehlende Nutzung sind insgesamt
vier der zehn, für das Straßenbild bedeutsamen
Hallenhäuser in ihrer Substanz gefährdet (Hol-
lernstraße 65, 101, 163 und Sperrsort 185).
Eine Besonderheit in dem Denkmalbestand
Hollerns stellt die 1899 als Altenteiler erbaute
„Villa Maria“ dar, ein Putzbau unter flach ge-
neigtem Satteldach. Die symmetrisch angelegte
Fassade wird durch eine vorgestellte, ehemals
offene Holzveranda, die einen Balkon trägt, be-
tont. Unverkennbar ist das Kopieren städtischer
Schmuckformen unter Verwendung vorgefertig-
ter Stilelemente, die hier der Renaissance ent-
stammen. Ein Relikt der ursprünglichen Situa-
tion ist das an der Straße vorhandene Eisen-
geländer, hingegen ist der straßenbegleitende
Graben zugeschüttet worden (Hollernstraße
159).
In Sperrsort, der westlichen Fortsetzung der
Durchgangsstraße, ist Gut Brook historisch be-
deutsam (Sperrsort 167). Es ist wie alle Altlän-
der Adelssitze als T-förmige Anlage konzipiert
und besteht aus einem langgestreckten Wirt-
schaftsteil mit hier z.T. massiv erneuerten
Außenwänden und einem zur Straße vorgestell-
ten, in Fachwerk ausgeführten zweigeschossi-
gen Quergebäude mit pfannengedecktem
Walmdach, zu dem eine kleine Lindenallee
führt. Im dreiseitig vorkragenden Obergeschoß
- die Balkenköpfe und Füllhölzer sind mit Wulst
und Kehle profiliert - haben sich vereinzelt
kleinteilige Sprossenfenster erhalten. Die be-
merkenswerte Innenausstattung mit einer Spin-
deltreppe und einer barocken Stuckdecke im
Rittersaal deutet auf eine Bauzeit kurz nach
1700.
TWIELENFLETH
Die erste Erwähnung Twielenfleths fällt in das
Jahr 1059, aber auch schon für die Zeitspanne
zwischen dem 4. und 2.Jh. v. Chr. ist eine Be-
siedlung durch Bodenfunde belegt.
In der Twielenflether Altflur, die wahrscheinlich in
Zusammenhang mit der Hollerkolonisation des
12.Jh. umgebaut und hinsichtlich Deichschutz
und Entwässerung vervollkommnet worden ist,
treten jedoch, bedingt durch Altbesitz und To-
pographie, nur stellenweise Langhufen mit par-
allelen Streifen auf, während strahlenförmig
oder bogig verlaufende Entwässerungsgräben
vielfach, insbesondere aber in Bassenfleth zu
beobachten sind.
Das unregelmäßige Straßennetz der Reihen-
siedlung am Elbufer, die durch zwei landein-
176
Hollern, Speersort 167, Gut Brook, kurz nach 1700
nachbarte holzverkleidete Fachwerkscheune
mit Reetdach darstellen.
Überdies ist eine Gruppe baulicher Anlagen be-
sonders hervorzuheben, die aus mehreren, in
einer Straßenkrümmung gestaffelt angeordne-
ten Bauten gebildet wird. Neben den oben vor-
gestellten Zweiständerbauten Hollemstraße
101, 105 und 109 umfaßt sie auch das trauf-
ständig gestellte Fachwerkwohnhaus Nr. 111
(erb. Mitte 19.Jh.) und zwei verbreiterte reetge-
deckte Scheunen auf den Grundstücken Nr.
105 und 109.
Durch eine fehlende Nutzung sind insgesamt
vier der zehn, für das Straßenbild bedeutsamen
Hallenhäuser in ihrer Substanz gefährdet (Hol-
lernstraße 65, 101, 163 und Sperrsort 185).
Eine Besonderheit in dem Denkmalbestand
Hollerns stellt die 1899 als Altenteiler erbaute
„Villa Maria“ dar, ein Putzbau unter flach ge-
neigtem Satteldach. Die symmetrisch angelegte
Fassade wird durch eine vorgestellte, ehemals
offene Holzveranda, die einen Balkon trägt, be-
tont. Unverkennbar ist das Kopieren städtischer
Schmuckformen unter Verwendung vorgefertig-
ter Stilelemente, die hier der Renaissance ent-
stammen. Ein Relikt der ursprünglichen Situa-
tion ist das an der Straße vorhandene Eisen-
geländer, hingegen ist der straßenbegleitende
Graben zugeschüttet worden (Hollernstraße
159).
In Sperrsort, der westlichen Fortsetzung der
Durchgangsstraße, ist Gut Brook historisch be-
deutsam (Sperrsort 167). Es ist wie alle Altlän-
der Adelssitze als T-förmige Anlage konzipiert
und besteht aus einem langgestreckten Wirt-
schaftsteil mit hier z.T. massiv erneuerten
Außenwänden und einem zur Straße vorgestell-
ten, in Fachwerk ausgeführten zweigeschossi-
gen Quergebäude mit pfannengedecktem
Walmdach, zu dem eine kleine Lindenallee
führt. Im dreiseitig vorkragenden Obergeschoß
- die Balkenköpfe und Füllhölzer sind mit Wulst
und Kehle profiliert - haben sich vereinzelt
kleinteilige Sprossenfenster erhalten. Die be-
merkenswerte Innenausstattung mit einer Spin-
deltreppe und einer barocken Stuckdecke im
Rittersaal deutet auf eine Bauzeit kurz nach
1700.
TWIELENFLETH
Die erste Erwähnung Twielenfleths fällt in das
Jahr 1059, aber auch schon für die Zeitspanne
zwischen dem 4. und 2.Jh. v. Chr. ist eine Be-
siedlung durch Bodenfunde belegt.
In der Twielenflether Altflur, die wahrscheinlich in
Zusammenhang mit der Hollerkolonisation des
12.Jh. umgebaut und hinsichtlich Deichschutz
und Entwässerung vervollkommnet worden ist,
treten jedoch, bedingt durch Altbesitz und To-
pographie, nur stellenweise Langhufen mit par-
allelen Streifen auf, während strahlenförmig
oder bogig verlaufende Entwässerungsgräben
vielfach, insbesondere aber in Bassenfleth zu
beobachten sind.
Das unregelmäßige Straßennetz der Reihen-
siedlung am Elbufer, die durch zwei landein-
176