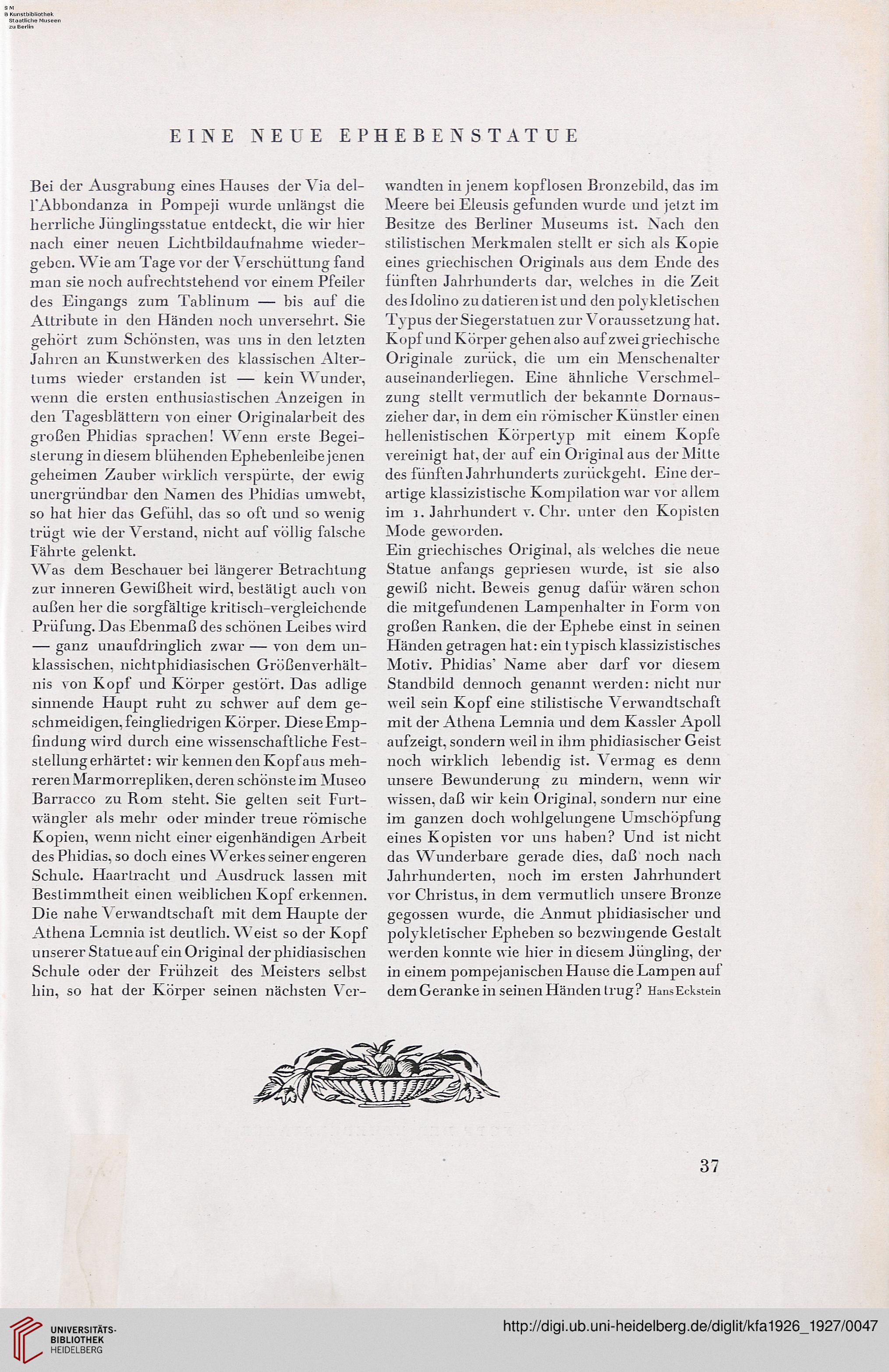EINE NEUE EPHEBENSTATUE
Bei der Ausgrabung eines Hauses der Via del-
l'Abbondanza in Pompeji wurde unlängst die
herrliche Jünglingsstatue entdeckt, die wir hier
nach einer neuen Lichtbildaufnahme wieder-
geben. Wie am Tage vor der Verschüttung fand
man sie noch aufrechtstehend vor einem Pfeiler
des Eingangs zum Tablinum — bis auf die
Attribute in den Händen noch unversehrt. Sie
gehört zum Schönsten, was uns in den letzten
Jahren an Kunstwerken des klassischen Alter-
tums wieder erstanden ist — kein Y\ ander,
wenn die ersten enthusiastischen Anzeigen in
den Tagesblättern von einer Originalarbeit des
großen Phidias sprachen! Wenn erste Begei-
sterung in diesem blühenden Ephebenleibe jenen
geheimen Zauber wirklich verspürte, der ewig
unergründbar den Namen des Phidias umwebt,
so hat hier das Gefühl, das so oft und so wenig
trügt wie der Verstand, nicht auf völlig falsche
Fährte gelenkt.
Was dem Beschauer bei längerer Betrachtung
zur inneren Gewißheit wird, bestätigt auch von
außen her die sorgfältige kritisch-vergleichende
Prüfung. Das Ebenmaß des schönen Leibes wird
— ganz unaufdringlich zwar — von dem un-
klassischen, nichtphidiasischen Größenverhält-
nis von Kopf und Körper gestört. Das adlige
sinnende Haupt ruht zu schwer auf dem ge-
schmeidigen, feingliedrigen Körper. Diese Emp-
findung wird durch eine wissenschaftliche Fest-
stellungerhärtet: wir kennen den Kopf aus meh-
reren Marmorrepliken, deren schönste im Museo
Barracco zu Rom steht. Sie gelten seit Furt-
wängler als mehr oder minder treue römische
Kopien, wenn nicht einer eigenhändigen Arbeit
des Phidias, so doch eines Werkes seiner engeren
Schule. Haartracht und Ausdruck lassen mit
Bestimmtheit einen weiblichen Kopf erkennen.
Die nahe ^ erwandtschaft mit dem Haupte der
Athena Lemnia ist deutlich. Weist so der Kopf
unserer Statue auf ein Original derphidiasischen
Schule oder der Frühzeit des Meisters selbst
hin, so hat der Körper seinen nächsten Ver-
wandten in jenem kopflosen Bronzebild, das im
Meere bei Eleusis gefunden wurde und jetzt im
Besitze des Berliner Museums ist. Nach den
stilistischen Merkmalen stellt er sich als Kopie
eines griechischen Originals aus dem Ende des
fünften Jahrhunderts dar, welches in die Zeit
desfdolino zu datieren ist und den polvkletischen
Typus der Siegerstatuen zur Voraussetzung hat.
Kopf und Körper gehen also auf zwei griechische
Originale zurück, die um ein Menschenalter
auseinanderliegen. Eine ähnliche Verschmel-
zung stellt vermutlich der bekannte Dornaus-
zieher dar, in dem ein römischer Künstler einen
hellenistischen Körperlyp mit einem Kopfe
vereinigt hat, der auf ein Original aus der Mitte
des fünften Jahrhunderts zurückgehl. Eine der-
artige klassizistische Kompilation war vor allem
im i. Jahrhundert v. Chr. unter den Kopisten
Mode geworden.
Ein griechisches Original, als welches die neue
Statue anfangs gepriesen wurde, ist sie also
gewiß nicht. Beweis genug dafür wären schon
die mitgefundenen Lampenhalter in Form von
großen Banken, die der Ephebe einst in seinen
Händen getragen hat: ein typisch klassizistisches
Motiv. Phidias' Name aber darf vor diesem
Standbild dennoch genannt werden: nicht nur
weil sein Kopf eine stilistische Verwandtschaft
mit der Athena Lemnia und dem Kassler Apoll
aufzeigt, sondern weil in ihm phidiasischer Geist
noch wirklich lebendig ist. Vermag es denn
unsere Bewunderung zu mindern, wenn wir
wissen, daß wir kein Original, sondern nur eine
im ganzen doch wohlgelungene Umschöpfung
eines Kopisten vor uns haben? Und ist nicht
das Wunderbare gerade dies, daß noch nach
Jahrhunderten, noch im ersten Jahrhundert
vor Christus, in dem vermutlich unsere Bronze
gegossen wurde, die Anmut phidiasischer und
polvkletischer Epheben so bezwingende Gestalt
werden konnte wie hier in diesem Jüngling, der
in einem pompejanischen Hause die Lampen auf
dem Geranke in seinen Händen trug? Hans Eckstein
Bei der Ausgrabung eines Hauses der Via del-
l'Abbondanza in Pompeji wurde unlängst die
herrliche Jünglingsstatue entdeckt, die wir hier
nach einer neuen Lichtbildaufnahme wieder-
geben. Wie am Tage vor der Verschüttung fand
man sie noch aufrechtstehend vor einem Pfeiler
des Eingangs zum Tablinum — bis auf die
Attribute in den Händen noch unversehrt. Sie
gehört zum Schönsten, was uns in den letzten
Jahren an Kunstwerken des klassischen Alter-
tums wieder erstanden ist — kein Y\ ander,
wenn die ersten enthusiastischen Anzeigen in
den Tagesblättern von einer Originalarbeit des
großen Phidias sprachen! Wenn erste Begei-
sterung in diesem blühenden Ephebenleibe jenen
geheimen Zauber wirklich verspürte, der ewig
unergründbar den Namen des Phidias umwebt,
so hat hier das Gefühl, das so oft und so wenig
trügt wie der Verstand, nicht auf völlig falsche
Fährte gelenkt.
Was dem Beschauer bei längerer Betrachtung
zur inneren Gewißheit wird, bestätigt auch von
außen her die sorgfältige kritisch-vergleichende
Prüfung. Das Ebenmaß des schönen Leibes wird
— ganz unaufdringlich zwar — von dem un-
klassischen, nichtphidiasischen Größenverhält-
nis von Kopf und Körper gestört. Das adlige
sinnende Haupt ruht zu schwer auf dem ge-
schmeidigen, feingliedrigen Körper. Diese Emp-
findung wird durch eine wissenschaftliche Fest-
stellungerhärtet: wir kennen den Kopf aus meh-
reren Marmorrepliken, deren schönste im Museo
Barracco zu Rom steht. Sie gelten seit Furt-
wängler als mehr oder minder treue römische
Kopien, wenn nicht einer eigenhändigen Arbeit
des Phidias, so doch eines Werkes seiner engeren
Schule. Haartracht und Ausdruck lassen mit
Bestimmtheit einen weiblichen Kopf erkennen.
Die nahe ^ erwandtschaft mit dem Haupte der
Athena Lemnia ist deutlich. Weist so der Kopf
unserer Statue auf ein Original derphidiasischen
Schule oder der Frühzeit des Meisters selbst
hin, so hat der Körper seinen nächsten Ver-
wandten in jenem kopflosen Bronzebild, das im
Meere bei Eleusis gefunden wurde und jetzt im
Besitze des Berliner Museums ist. Nach den
stilistischen Merkmalen stellt er sich als Kopie
eines griechischen Originals aus dem Ende des
fünften Jahrhunderts dar, welches in die Zeit
desfdolino zu datieren ist und den polvkletischen
Typus der Siegerstatuen zur Voraussetzung hat.
Kopf und Körper gehen also auf zwei griechische
Originale zurück, die um ein Menschenalter
auseinanderliegen. Eine ähnliche Verschmel-
zung stellt vermutlich der bekannte Dornaus-
zieher dar, in dem ein römischer Künstler einen
hellenistischen Körperlyp mit einem Kopfe
vereinigt hat, der auf ein Original aus der Mitte
des fünften Jahrhunderts zurückgehl. Eine der-
artige klassizistische Kompilation war vor allem
im i. Jahrhundert v. Chr. unter den Kopisten
Mode geworden.
Ein griechisches Original, als welches die neue
Statue anfangs gepriesen wurde, ist sie also
gewiß nicht. Beweis genug dafür wären schon
die mitgefundenen Lampenhalter in Form von
großen Banken, die der Ephebe einst in seinen
Händen getragen hat: ein typisch klassizistisches
Motiv. Phidias' Name aber darf vor diesem
Standbild dennoch genannt werden: nicht nur
weil sein Kopf eine stilistische Verwandtschaft
mit der Athena Lemnia und dem Kassler Apoll
aufzeigt, sondern weil in ihm phidiasischer Geist
noch wirklich lebendig ist. Vermag es denn
unsere Bewunderung zu mindern, wenn wir
wissen, daß wir kein Original, sondern nur eine
im ganzen doch wohlgelungene Umschöpfung
eines Kopisten vor uns haben? Und ist nicht
das Wunderbare gerade dies, daß noch nach
Jahrhunderten, noch im ersten Jahrhundert
vor Christus, in dem vermutlich unsere Bronze
gegossen wurde, die Anmut phidiasischer und
polvkletischer Epheben so bezwingende Gestalt
werden konnte wie hier in diesem Jüngling, der
in einem pompejanischen Hause die Lampen auf
dem Geranke in seinen Händen trug? Hans Eckstein