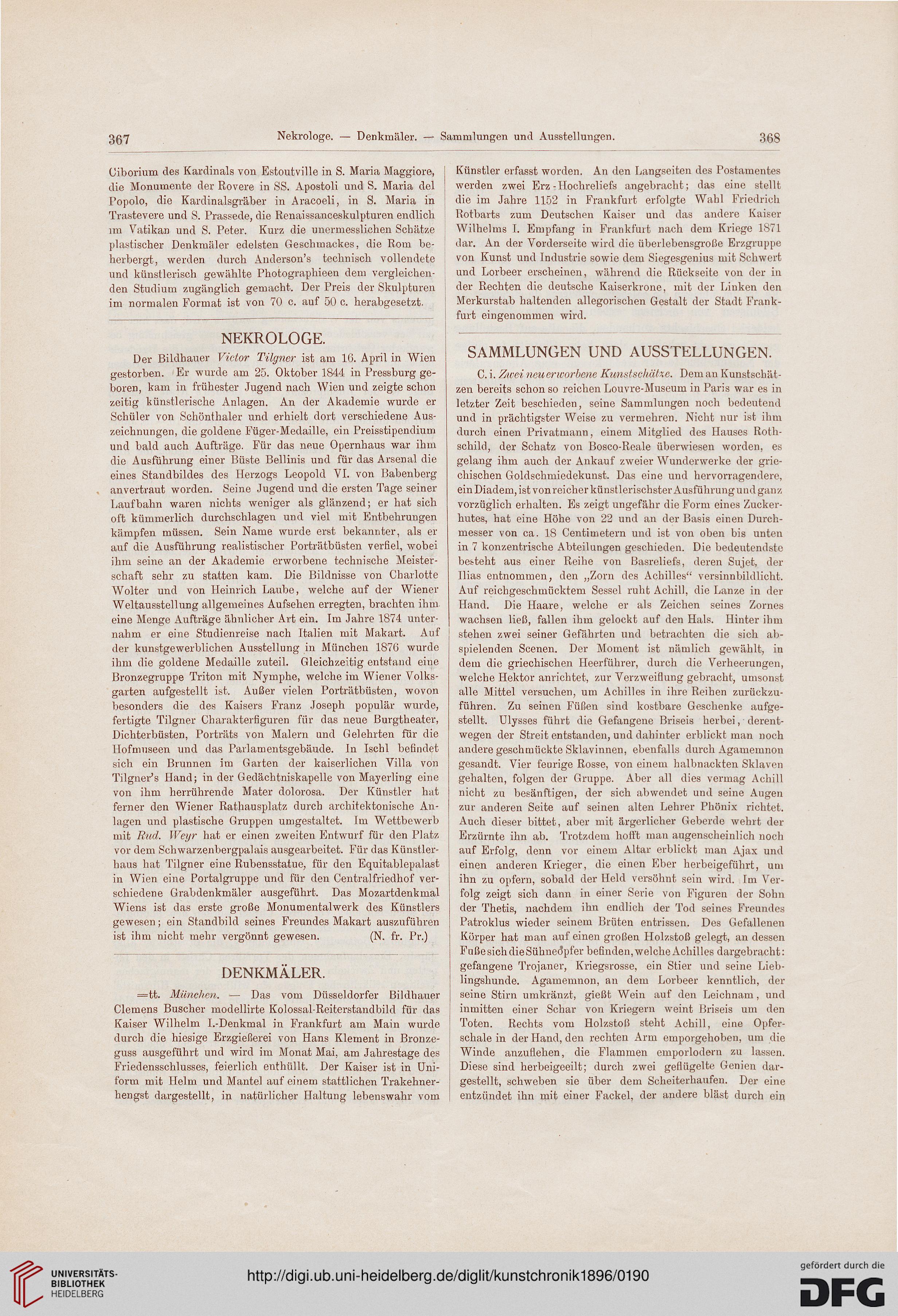367
368
Ciborium des Kardinals von Estoutville in S. Maria Maggiore,
die Monumente der Rovere in SS. Apostoli und S. Maria del
Popolo, die Kardinalsgräber in Aracoeli, in S. Maria in
Trastevere und S. Prassede, die Renaissanceskulpturen endlich
im Vatikan und S. Peter. Kurz die unermesslichen Schätze
plastischer Denkmäler edelsten Geschmackes, die Rom be-
herbergt, werden durch Anderson's technisch vollendete
und künstlerisch gewählte Photographieen dem vergleichen-
den Studium zugänglich gemacht. Der Preis der Skulpturen
im normalen Format ist von 70 c. auf 50 c. herabgesetzt.
NEKROLOGE.
Der Bildbauer Viftor Tilgner ist am IG. April in Wien
gestorben. Er wurde am 25. Oktober 1844 in Pressburg ge-
boren, kam in frühester Jugend nach Wien und zeigte schon
zeitig künstlerische Anlagen. An der Akademie wurde er
Schüler von Schönthaler und erhielt dort verschiedene Aus-
zeichnungen, die goldene Füger-Medaille, ein Preisstipendium
und bald auch Aufträge. Für das neue Opernhaus war ihm
die Ausführung einer Büste Bellinis und für das Arsenal die
eines Standbildes des Herzogs Leopold VI. von Babenberg
anvertraut worden. Seine Jugend und die ersten Tage seiner
Laufbahn waren nichts weniger als glänzend; er hat sich
oft kümmerlich durchschlagen und viel mit Entbehrungen
kämpfen müssen. Sein Name wurde erst bekannter, als er
auf die Ausführung realistischer Porträtbüsten verfiel, wobei
ihm seine an der Akademie erworbene technische Meister-
schaft sehr zu statten kam. Die Bildnisse von Charlotte
Wolter und von Heinrich Laube, welche auf der Wiener
Weltausstellung allgemeines Aufsehen erregten, brachten ihm
eine Menge Aufträge ähnlicher Art ein. Im Jahre 1874 unter-
nahm er eine Studienreise nach Italien mit Makart. Auf
der kunstgewerblichen Ausstellung in München 187G wurde
ihm die goldene Medaille zuteil. Gleichzeitig entstand eine
Bronzegruppe Triton mit Nymphe, welche im Wiener Volks-
garten aufgestellt ist. Außer vielen Porträtbüsten, wovon
besonders die des Kaisers Franz Joseph populär wurde,
fertigte Tilgner Charakterfiguren für das neue Burgtheater,
Dichterbüsten, Porträts von Malern und Gelehrten für die
llofmuseen und das Parlamentsgebäude. In Ischl befindet
sich ein Brunnen im Garten der kaiserlichen Villa von
Tilgner's Hand; in der Gedächtniskapelle von Mayerling eine
von ihm herrührende Mater dolorosa. Der Künstler hat
ferner den Wiener Rathausplatz durch architektonische An-
lagen und plastische Gruppen umgestaltet. Im Wettbewerb
mit Rud. Weyr hat er einen zweiten Entwurf für den Platz
vor dem Schwarzenbergpalais ausgearbeitet. Für das Künstler-
baus hat Tilgner eine Rubensstatue, für den Equitablepalast
in Wien eine Portalgruppe und für den Centralfriedhof ver-
schiedene Grabdenkmäler ausgeführt. Das Mozartdenkmal
Wiens ist das erste große Monumentalwerk des Künstlers
gewesen; ein Standbild seines Freundes Makart auszuführen
ist ihm nicht mehr vergönnt gewesen. (N. fr. Pr.)
DENKMÄLER.
=tt. Münclicn. — Das vom Düsseldorfer Bildhauer
Clemens Buscher modellirte Kolossal-Reiterstandbilcl für das
Kaiser Wilhelm I.-Denkmal in Frankfurt am Main wurde
durch die hiesige Erzgießerei von Hans Klement in Bronze-
guss ausgeführt und wird im Monat Mai, am Jahrestage des
Friedensschlusses, feierlich enthüllt. Der Kaiser ist in Uni-
form mit Helm und Mantel auf einem stattlichen Trakehner-
hengst dargestellt, in natürlicher Haltung lebenswahr vom
Künstler erfasst worden. An den Langseiten des Postamentes
werden zwei Erz-Hochreliefs angebracht; das eine stellt
die im Jahre 1152 in Frankfurt erfolgte Wahl Friedrich
Rotbarts zum Deutschen Kaiser und das andere Kaiser
Wilhelms I. Empfang in Frankfurt nach dem Kriege 1871
dar. An der Vorderseite wird die überlebensgroße Erzgruppe
von Kunst und Industrie sowie dem Siegesgenius mit Schwert
und Lorbeer erscheinen, während die Rückseite von der in
der Rechten die deutsche Kaiserkrone, mit der Linken den
Merkurstab haltenden allegorischen Gestalt der Stadt Frank-
furt eingenommen wird.
SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.
C. i. Zwei neuerworbene Kunstsehätxe. Dem an Kunstschät-
zen bereits schon so reichen Louvre-Museum in Paris war es in
letzter Zeit beschieden, seine Sammlungen noch bedeutend
und in prächtigster Weise zu vermehren. Nicht nur ist ihm
durch einen Privatmann, einem Mitglied des Hauses Roth-
schild, der Schatz von Bosco-Reale überwiesen worden, es
gelang ihm auch der Ankauf zweier Wunderwerke der grie-
chischen Goldschmiedekunst. Das eine und hervorragendere,
ein Diadem, ist von reicher künstlerischster Ausführung und ganz
vorzüglich erhalten. Es zeigt ungefähr die Form eines Zucker-
hutes, hat eine Höhe von 22 und an der Basis einen Durch-
messer von ca. 18 Centimetern und ist von oben bis unten
in 7 konzentrische Abteilungen geschieden. Die bedeutendste
besteht aus einer Reihe von Basreliefs, deren Sujet, der
Ilias entnommen, den „Zorn des Achilles" versinnbildlicht.
Auf reichgeschmücktem Sessel ruht Achill, die Lanze in der
Hand. Die Haare, welche er als Zeichen seines Zornes
wachsen ließ, fallen ihm gelockt auf den Hals. Hinter ihm
stehen zwei seiner Gefährten und betrachten die sich ab-
spielenden Scenen. Der Moment ist nämlich gewählt, in
dem die griechischen Heerführer, durch die Verheerungen,
welche Hektor anrichtet, zur Verzweiflung gebracht, umsonst
alle Mittel versuchen, um Achilles in ihre Reihen zurückzu-
führen. Zu seinen Füßen sind kostbare Geschenke aufge-
stellt. Ulysses führt die Gefangene Briseis herbei, derent-
wegen der Stroit entstanden, und dahinter erblickt man noch
andere geschmückte Sklavinnen, ebenfalls durch Agamemnon
gesandt. Vier feurige Rosse, von einem halbnackten Sklaven
gehalten, folgen der Gruppe. Aber all dies vermag Achill
nicht zu besänftigen, der sich abwendet und seine Augen
zur anderen Seite auf seinen alten Lehrer Phönix richtet.
Auch dieser bittet, aber mit ärgerlicher Geberde wehrt der
Erzürnte ihn ab. Trotzdem hofft man augenscheinlich noch
auf Erfolg, denn vor einem Altar erblickt man Ajax und
einen anderen Krieger, die einen Eber herbeigeführt, um
ihn zu opfern, sobald der Held versöhnt sein wird. Im Ver-
folg zeigt sich dann in einer Serie von Figuren der Sohn
der Thetis, nachdem ihn endlich der Tod seines Freundes
Patroklus wieder seinem Brüten entrissen. Des Gefallenen
Körper hat man auf einen großen Holzstoß gelegt, an dessen
Fuße sich die Sühne^pfer befinden, welche Achilles dargebracht:
gefangene Trojaner, Kriegsrosse, ein Stier und seine Lieb-
lingshunde. Agamemnon, an dem Lorbeer kenntlich, der
seine Stirn umkränzt, gießt Wein auf den Leichnam, und
inmitten einer Schar von Kriegern weint Briseis um den
Toten. Rechts vom Holzstoß steht Achill, eine Opfer-
schale in der Hand, den rechten Arm emporgehoben, um die
Winde anzuflehen, die Flammen emporlodern zu lassen.
Diese sind herbeigeeilt; durch zwei geflügelte Genien dar-
gestellt, schweben sie über dem Scheiterhaufen. Der eine
entzündet ihn mit einer Fackel, der andere bläst durch ein
368
Ciborium des Kardinals von Estoutville in S. Maria Maggiore,
die Monumente der Rovere in SS. Apostoli und S. Maria del
Popolo, die Kardinalsgräber in Aracoeli, in S. Maria in
Trastevere und S. Prassede, die Renaissanceskulpturen endlich
im Vatikan und S. Peter. Kurz die unermesslichen Schätze
plastischer Denkmäler edelsten Geschmackes, die Rom be-
herbergt, werden durch Anderson's technisch vollendete
und künstlerisch gewählte Photographieen dem vergleichen-
den Studium zugänglich gemacht. Der Preis der Skulpturen
im normalen Format ist von 70 c. auf 50 c. herabgesetzt.
NEKROLOGE.
Der Bildbauer Viftor Tilgner ist am IG. April in Wien
gestorben. Er wurde am 25. Oktober 1844 in Pressburg ge-
boren, kam in frühester Jugend nach Wien und zeigte schon
zeitig künstlerische Anlagen. An der Akademie wurde er
Schüler von Schönthaler und erhielt dort verschiedene Aus-
zeichnungen, die goldene Füger-Medaille, ein Preisstipendium
und bald auch Aufträge. Für das neue Opernhaus war ihm
die Ausführung einer Büste Bellinis und für das Arsenal die
eines Standbildes des Herzogs Leopold VI. von Babenberg
anvertraut worden. Seine Jugend und die ersten Tage seiner
Laufbahn waren nichts weniger als glänzend; er hat sich
oft kümmerlich durchschlagen und viel mit Entbehrungen
kämpfen müssen. Sein Name wurde erst bekannter, als er
auf die Ausführung realistischer Porträtbüsten verfiel, wobei
ihm seine an der Akademie erworbene technische Meister-
schaft sehr zu statten kam. Die Bildnisse von Charlotte
Wolter und von Heinrich Laube, welche auf der Wiener
Weltausstellung allgemeines Aufsehen erregten, brachten ihm
eine Menge Aufträge ähnlicher Art ein. Im Jahre 1874 unter-
nahm er eine Studienreise nach Italien mit Makart. Auf
der kunstgewerblichen Ausstellung in München 187G wurde
ihm die goldene Medaille zuteil. Gleichzeitig entstand eine
Bronzegruppe Triton mit Nymphe, welche im Wiener Volks-
garten aufgestellt ist. Außer vielen Porträtbüsten, wovon
besonders die des Kaisers Franz Joseph populär wurde,
fertigte Tilgner Charakterfiguren für das neue Burgtheater,
Dichterbüsten, Porträts von Malern und Gelehrten für die
llofmuseen und das Parlamentsgebäude. In Ischl befindet
sich ein Brunnen im Garten der kaiserlichen Villa von
Tilgner's Hand; in der Gedächtniskapelle von Mayerling eine
von ihm herrührende Mater dolorosa. Der Künstler hat
ferner den Wiener Rathausplatz durch architektonische An-
lagen und plastische Gruppen umgestaltet. Im Wettbewerb
mit Rud. Weyr hat er einen zweiten Entwurf für den Platz
vor dem Schwarzenbergpalais ausgearbeitet. Für das Künstler-
baus hat Tilgner eine Rubensstatue, für den Equitablepalast
in Wien eine Portalgruppe und für den Centralfriedhof ver-
schiedene Grabdenkmäler ausgeführt. Das Mozartdenkmal
Wiens ist das erste große Monumentalwerk des Künstlers
gewesen; ein Standbild seines Freundes Makart auszuführen
ist ihm nicht mehr vergönnt gewesen. (N. fr. Pr.)
DENKMÄLER.
=tt. Münclicn. — Das vom Düsseldorfer Bildhauer
Clemens Buscher modellirte Kolossal-Reiterstandbilcl für das
Kaiser Wilhelm I.-Denkmal in Frankfurt am Main wurde
durch die hiesige Erzgießerei von Hans Klement in Bronze-
guss ausgeführt und wird im Monat Mai, am Jahrestage des
Friedensschlusses, feierlich enthüllt. Der Kaiser ist in Uni-
form mit Helm und Mantel auf einem stattlichen Trakehner-
hengst dargestellt, in natürlicher Haltung lebenswahr vom
Künstler erfasst worden. An den Langseiten des Postamentes
werden zwei Erz-Hochreliefs angebracht; das eine stellt
die im Jahre 1152 in Frankfurt erfolgte Wahl Friedrich
Rotbarts zum Deutschen Kaiser und das andere Kaiser
Wilhelms I. Empfang in Frankfurt nach dem Kriege 1871
dar. An der Vorderseite wird die überlebensgroße Erzgruppe
von Kunst und Industrie sowie dem Siegesgenius mit Schwert
und Lorbeer erscheinen, während die Rückseite von der in
der Rechten die deutsche Kaiserkrone, mit der Linken den
Merkurstab haltenden allegorischen Gestalt der Stadt Frank-
furt eingenommen wird.
SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN.
C. i. Zwei neuerworbene Kunstsehätxe. Dem an Kunstschät-
zen bereits schon so reichen Louvre-Museum in Paris war es in
letzter Zeit beschieden, seine Sammlungen noch bedeutend
und in prächtigster Weise zu vermehren. Nicht nur ist ihm
durch einen Privatmann, einem Mitglied des Hauses Roth-
schild, der Schatz von Bosco-Reale überwiesen worden, es
gelang ihm auch der Ankauf zweier Wunderwerke der grie-
chischen Goldschmiedekunst. Das eine und hervorragendere,
ein Diadem, ist von reicher künstlerischster Ausführung und ganz
vorzüglich erhalten. Es zeigt ungefähr die Form eines Zucker-
hutes, hat eine Höhe von 22 und an der Basis einen Durch-
messer von ca. 18 Centimetern und ist von oben bis unten
in 7 konzentrische Abteilungen geschieden. Die bedeutendste
besteht aus einer Reihe von Basreliefs, deren Sujet, der
Ilias entnommen, den „Zorn des Achilles" versinnbildlicht.
Auf reichgeschmücktem Sessel ruht Achill, die Lanze in der
Hand. Die Haare, welche er als Zeichen seines Zornes
wachsen ließ, fallen ihm gelockt auf den Hals. Hinter ihm
stehen zwei seiner Gefährten und betrachten die sich ab-
spielenden Scenen. Der Moment ist nämlich gewählt, in
dem die griechischen Heerführer, durch die Verheerungen,
welche Hektor anrichtet, zur Verzweiflung gebracht, umsonst
alle Mittel versuchen, um Achilles in ihre Reihen zurückzu-
führen. Zu seinen Füßen sind kostbare Geschenke aufge-
stellt. Ulysses führt die Gefangene Briseis herbei, derent-
wegen der Stroit entstanden, und dahinter erblickt man noch
andere geschmückte Sklavinnen, ebenfalls durch Agamemnon
gesandt. Vier feurige Rosse, von einem halbnackten Sklaven
gehalten, folgen der Gruppe. Aber all dies vermag Achill
nicht zu besänftigen, der sich abwendet und seine Augen
zur anderen Seite auf seinen alten Lehrer Phönix richtet.
Auch dieser bittet, aber mit ärgerlicher Geberde wehrt der
Erzürnte ihn ab. Trotzdem hofft man augenscheinlich noch
auf Erfolg, denn vor einem Altar erblickt man Ajax und
einen anderen Krieger, die einen Eber herbeigeführt, um
ihn zu opfern, sobald der Held versöhnt sein wird. Im Ver-
folg zeigt sich dann in einer Serie von Figuren der Sohn
der Thetis, nachdem ihn endlich der Tod seines Freundes
Patroklus wieder seinem Brüten entrissen. Des Gefallenen
Körper hat man auf einen großen Holzstoß gelegt, an dessen
Fuße sich die Sühne^pfer befinden, welche Achilles dargebracht:
gefangene Trojaner, Kriegsrosse, ein Stier und seine Lieb-
lingshunde. Agamemnon, an dem Lorbeer kenntlich, der
seine Stirn umkränzt, gießt Wein auf den Leichnam, und
inmitten einer Schar von Kriegern weint Briseis um den
Toten. Rechts vom Holzstoß steht Achill, eine Opfer-
schale in der Hand, den rechten Arm emporgehoben, um die
Winde anzuflehen, die Flammen emporlodern zu lassen.
Diese sind herbeigeeilt; durch zwei geflügelte Genien dar-
gestellt, schweben sie über dem Scheiterhaufen. Der eine
entzündet ihn mit einer Fackel, der andere bläst durch ein