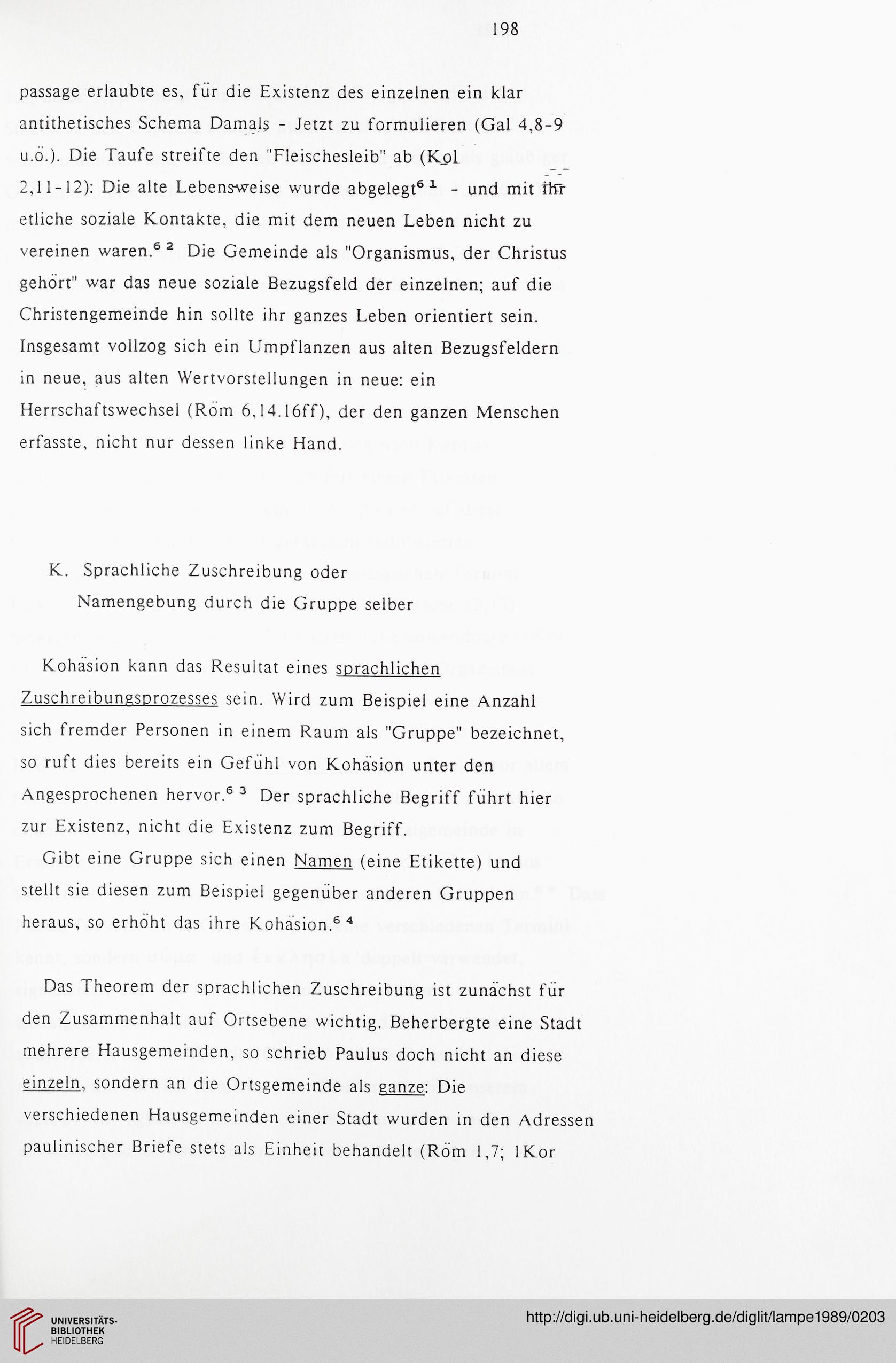198
passage erlaubte es, für die Existenz des einzelnen ein klar
antithetisches Schema Damals - Jetzt zu formulieren (Gal 4,8-9
u.ö.). Die Taufe streifte den "Fleischesleib" ab (KoL
2,11-12): Die alte Lebensweise wurde abgelegt61 - und mit ihr
etliche soziale Kontakte, die mit dem neuen Leben nicht zu
vereinen waren.6 2 Die Gemeinde als "Organismus, der Christus
gehört" war das neue soziale Bezugsfeld der einzelnen; auf die
Christengemeinde hin sollte ihr ganzes Leben orientiert sein.
Insgesamt vollzog sich ein Umpflanzen aus alten Bezugsfeldern
in neue, aus alten Wertvorstellungen in neue: ein
Herrschaftswechsel (Rom 6,14.16ff), der den ganzen Menschen
erfasste, nicht nur dessen linke Hand.
K. Sprachliche Zuschreibung oder
Namengebung durch die Gruppe selber
Kohäsion kann das Resultat eines sprachlichen
Zuschreibungsprozesses sein. Wird zum Beispiel eine Anzahl
sich fremder Personen in einem Raum als "Gruppe" bezeichnet,
so ruft dies bereits ein Gefühl von Kohäsion unter den
Angesprochenen hervor.6 3 Der sprachliche Begriff führt hier
zur Existenz, nicht die Existenz zum Begriff.
Gibt eine Gruppe sich einen Namen (eine Etikette) und
stellt sie diesen zum Beispiel gegenüber anderen Gruppen
heraus, so erhöht das ihre Kohäsion.6 4
Das Theorem der sprachlichen Zuschreibung ist zunächst für
den Zusammenhalt auf Ortsebene wichtig. Beherbergte eine Stadt
mehrere Hausgemeinden, so schrieb Paulus doch nicht an diese
einzeln, sondern an die Ortsgemeinde als ganze: Die
verschiedenen Hausgemeinden einer Stadt wurden in den Adressen
paulinischer Briefe stets als Einheit behandelt (Röm 1,7; IKor
passage erlaubte es, für die Existenz des einzelnen ein klar
antithetisches Schema Damals - Jetzt zu formulieren (Gal 4,8-9
u.ö.). Die Taufe streifte den "Fleischesleib" ab (KoL
2,11-12): Die alte Lebensweise wurde abgelegt61 - und mit ihr
etliche soziale Kontakte, die mit dem neuen Leben nicht zu
vereinen waren.6 2 Die Gemeinde als "Organismus, der Christus
gehört" war das neue soziale Bezugsfeld der einzelnen; auf die
Christengemeinde hin sollte ihr ganzes Leben orientiert sein.
Insgesamt vollzog sich ein Umpflanzen aus alten Bezugsfeldern
in neue, aus alten Wertvorstellungen in neue: ein
Herrschaftswechsel (Rom 6,14.16ff), der den ganzen Menschen
erfasste, nicht nur dessen linke Hand.
K. Sprachliche Zuschreibung oder
Namengebung durch die Gruppe selber
Kohäsion kann das Resultat eines sprachlichen
Zuschreibungsprozesses sein. Wird zum Beispiel eine Anzahl
sich fremder Personen in einem Raum als "Gruppe" bezeichnet,
so ruft dies bereits ein Gefühl von Kohäsion unter den
Angesprochenen hervor.6 3 Der sprachliche Begriff führt hier
zur Existenz, nicht die Existenz zum Begriff.
Gibt eine Gruppe sich einen Namen (eine Etikette) und
stellt sie diesen zum Beispiel gegenüber anderen Gruppen
heraus, so erhöht das ihre Kohäsion.6 4
Das Theorem der sprachlichen Zuschreibung ist zunächst für
den Zusammenhalt auf Ortsebene wichtig. Beherbergte eine Stadt
mehrere Hausgemeinden, so schrieb Paulus doch nicht an diese
einzeln, sondern an die Ortsgemeinde als ganze: Die
verschiedenen Hausgemeinden einer Stadt wurden in den Adressen
paulinischer Briefe stets als Einheit behandelt (Röm 1,7; IKor