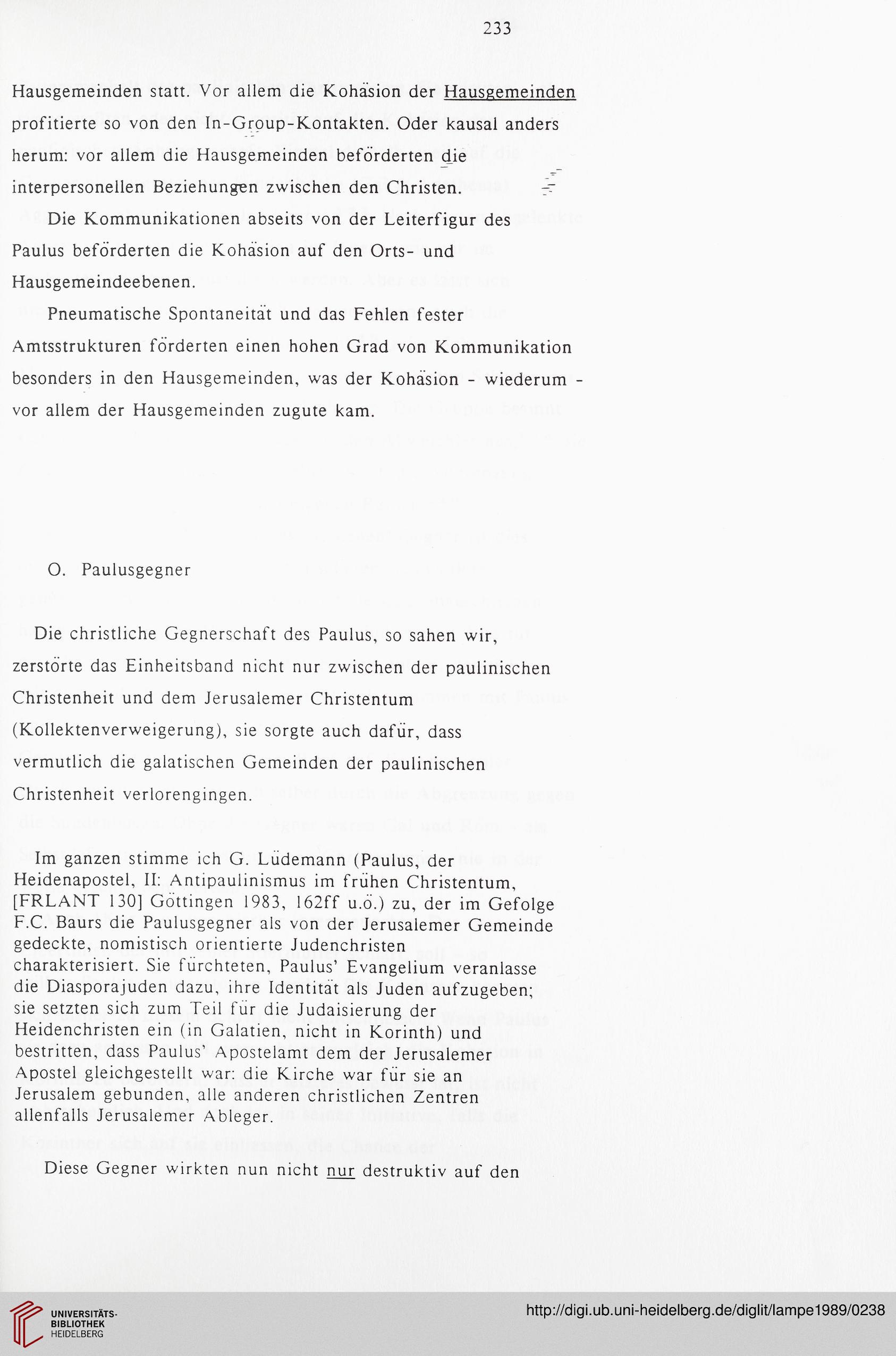233
Hausgemeinden statt. Vor allem die Kohäsion der Hausgemeinden
profitierte so von den In-Group-Kontakten. Oder kausal anders
herum: vor allem die Hausgemeinden beförderten die
interpersonellen Beziehungen zwischen den Christen.
Die Kommunikationen abseits von der Leiterfigur des
Paulus beförderten die Kohäsion auf den Orts- und
Hausgemeindeebenen.
Pneumatische Spontaneität und das Fehlen fester
Amtsstrukturen förderten einen hohen Grad von Kommunikation
besonders in den Hausgemeinden, was der Kohäsion - wiederum -
vor allem der Hausgemeinden zugute kam.
O. Paulusgegner
Die christliche Gegnerschaft des Paulus, so sahen wir,
zerstörte das Einheitsband nicht nur zwischen der paulinischen
Christenheit und dem Jerusalemer Christentum
(Kollektenverweigerung), sie sorgte auch dafür, dass
vermutlich die galatischen Gemeinden der paulinischen
Christenheit verlorengingen.
Im ganzen stimme ich G. Lüdemann (Paulus, der
Heidenapostel, II: Antipaulinismus im frühen Christentum,
[FRLANT 130] Göttingen 1983, 162ff u.ö.) zu, der im Gefolge
F.C. Baurs die Paulusgegner als von der Jerusalemer Gemeinde
gedeckte, nomistisch orientierte Judenchristen
charakterisiert. Sie fürchteten, Paulus’ Evangelium veranlasse
die Diasporajuden dazu, ihre Identität als Juden aufzugeben;
sie setzten sich zum Teil für die Judaisierung der
Heidenchristen ein (in Galatien, nicht in Korinth) und
bestritten, dass Paulus’ Apostelamt dem der Jerusalemer
Apostel gleichgestellt war: die Kirche war für sie an
Jerusalem gebunden, alle anderen christlichen Zentren
allenfalls Jerusalemer Ableger.
Diese Gegner wirkten nun nicht nur destruktiv auf den
Hausgemeinden statt. Vor allem die Kohäsion der Hausgemeinden
profitierte so von den In-Group-Kontakten. Oder kausal anders
herum: vor allem die Hausgemeinden beförderten die
interpersonellen Beziehungen zwischen den Christen.
Die Kommunikationen abseits von der Leiterfigur des
Paulus beförderten die Kohäsion auf den Orts- und
Hausgemeindeebenen.
Pneumatische Spontaneität und das Fehlen fester
Amtsstrukturen förderten einen hohen Grad von Kommunikation
besonders in den Hausgemeinden, was der Kohäsion - wiederum -
vor allem der Hausgemeinden zugute kam.
O. Paulusgegner
Die christliche Gegnerschaft des Paulus, so sahen wir,
zerstörte das Einheitsband nicht nur zwischen der paulinischen
Christenheit und dem Jerusalemer Christentum
(Kollektenverweigerung), sie sorgte auch dafür, dass
vermutlich die galatischen Gemeinden der paulinischen
Christenheit verlorengingen.
Im ganzen stimme ich G. Lüdemann (Paulus, der
Heidenapostel, II: Antipaulinismus im frühen Christentum,
[FRLANT 130] Göttingen 1983, 162ff u.ö.) zu, der im Gefolge
F.C. Baurs die Paulusgegner als von der Jerusalemer Gemeinde
gedeckte, nomistisch orientierte Judenchristen
charakterisiert. Sie fürchteten, Paulus’ Evangelium veranlasse
die Diasporajuden dazu, ihre Identität als Juden aufzugeben;
sie setzten sich zum Teil für die Judaisierung der
Heidenchristen ein (in Galatien, nicht in Korinth) und
bestritten, dass Paulus’ Apostelamt dem der Jerusalemer
Apostel gleichgestellt war: die Kirche war für sie an
Jerusalem gebunden, alle anderen christlichen Zentren
allenfalls Jerusalemer Ableger.
Diese Gegner wirkten nun nicht nur destruktiv auf den