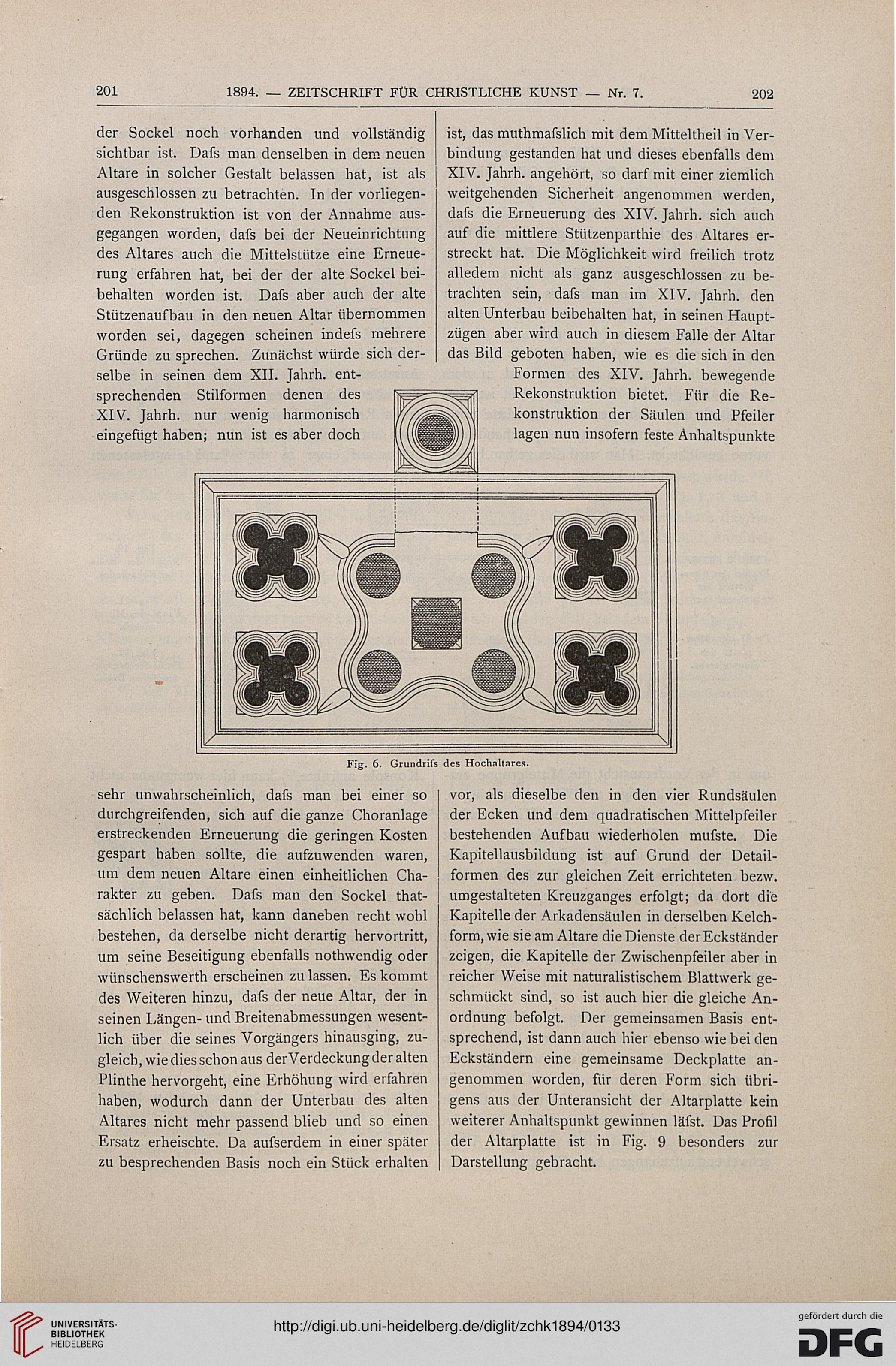201
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
202
der Sockel noch vorhanden und vollständig
sichtbar ist. Dafs man denselben in dem neuen
Altare in solcher Gestalt belassen hat, ist als
ausgeschlossen zu betrachten. In der vorliegen-
den Rekonstruktion ist von der Annahme aus-
gegangen worden, dafs bei der Neueinrichtung
des Altares auch die Mittelstütze eine Erneue-
rung erfahren hat, bei der der alte Sockel bei-
behalten worden ist. Dafs aber auch der alte
Stützenaufbau in den neuen Altar übernommen
worden sei, dagegen scheinen indefs mehrere
Gründe zu sprechen. Zunächst würde sich der-
selbe in seinen dem XII. Jahrh. ent-
sprechenden Stilformen denen des
XIV. Jahrh. nur wenig harmonisch
eingefügt haben; nun ist es aber doch
ist, das muthmafslich mit dem Mitteltheil in Ver-
bindung gestanden hat und dieses ebenfalls dem
XIV. Jahrh. angehört, so darf mit einer ziemlich
weitgehenden Sicherheit angenommen werden,
dafs die Erneuerung des XIV. Jahrh. sich auch
auf die mittlere Stützenparthie des Altares er-
streckt hat. Die Möglichkeit wird freilich trotz
alledem nicht als ganz ausgeschlossen zu be-
trachten sein, dafs man im XIV. Jahrh. den
alten Unterbau beibehalten hat, in seinen Haupt-
zügen aber wird auch in diesem Falle der Altar
das Bild geboten haben, wie es die sich in den
Formen des XIV. Jahrh. bewegende
Rekonstruktion bietet. Für die Re-
konstruktion der Säulen und Pfeiler
lagen nun insofern feste Anhaltspunkte
Fig. 6. Grundrifs des Hochaltnres.
sehr unwahrscheinlich, dafs man bei einer so
durchgreifenden, sich auf die ganze Choranlage
erstreckenden Erneuerung die geringen Kosten
gespart haben sollte, die aufzuwenden waren,
um dem neuen Altare einen einheitlichen Cha-
rakter zu geben. Dafs man den Sockel that-
sächlich belassen hat, kann daneben recht wohl
bestehen, da derselbe nicht derartig hervortritt,
um seine Beseitigung ebenfalls nothwendig oder
wünschenswerth erscheinen zulassen. Es kommt
des Weiteren hinzu, dafs der neue Altar, der in
seinen Längen- und Breitenabmessungen wesent-
lich über die seines Vorgängers hinausging, zu-
gleich, wie dies schon aus der Verdeckung der alten
Plinthe hervorgeht, eine Erhöhung wird erfahren
haben, wodurch dann der Unterbau des alten
Altares nicht mehr passend blieb und so einen
Ersatz erheischte. Da aufserdem in einer später
zu besprechenden Basis noch ein Stück erhalten
vor, als dieselbe den in den vier Rundsäulen
der Ecken und dem quadratischen Mittelpfeiler
bestehenden Aufbau wiederholen mufste. Die
Kapitellausbildung ist auf Grund der Detail-
formen des zur gleichen Zeit errichteten bezw.
umgestalteten Kreuzganges erfolgt; da dort die
Kapitelle der Arkadensäulen in derselben Kelch-
form, wie sie am Altare die Dienste der Eckständer
zeigen, die Kapitelle der Zwischenpfeiler aber in
reicher Weise mit naturalistischem Blattwerk ge-
schmückt sind, so ist auch hier die gleiche An-
ordnung befolgt. Der gemeinsamen Basis ent-
sprechend, ist dann auch hier ebenso wie bei den
Eckständern eine gemeinsame Deckplatte an-
genommen worden, für deren Form sich übri-
gens aus der Unteransicht der Altarplatte kein
weiterer Anhaltspunkt gewinnen läfst. Das Profil
der Altarplatte ist in Fig. 9 besonders zur
Darstellung gebracht.
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
202
der Sockel noch vorhanden und vollständig
sichtbar ist. Dafs man denselben in dem neuen
Altare in solcher Gestalt belassen hat, ist als
ausgeschlossen zu betrachten. In der vorliegen-
den Rekonstruktion ist von der Annahme aus-
gegangen worden, dafs bei der Neueinrichtung
des Altares auch die Mittelstütze eine Erneue-
rung erfahren hat, bei der der alte Sockel bei-
behalten worden ist. Dafs aber auch der alte
Stützenaufbau in den neuen Altar übernommen
worden sei, dagegen scheinen indefs mehrere
Gründe zu sprechen. Zunächst würde sich der-
selbe in seinen dem XII. Jahrh. ent-
sprechenden Stilformen denen des
XIV. Jahrh. nur wenig harmonisch
eingefügt haben; nun ist es aber doch
ist, das muthmafslich mit dem Mitteltheil in Ver-
bindung gestanden hat und dieses ebenfalls dem
XIV. Jahrh. angehört, so darf mit einer ziemlich
weitgehenden Sicherheit angenommen werden,
dafs die Erneuerung des XIV. Jahrh. sich auch
auf die mittlere Stützenparthie des Altares er-
streckt hat. Die Möglichkeit wird freilich trotz
alledem nicht als ganz ausgeschlossen zu be-
trachten sein, dafs man im XIV. Jahrh. den
alten Unterbau beibehalten hat, in seinen Haupt-
zügen aber wird auch in diesem Falle der Altar
das Bild geboten haben, wie es die sich in den
Formen des XIV. Jahrh. bewegende
Rekonstruktion bietet. Für die Re-
konstruktion der Säulen und Pfeiler
lagen nun insofern feste Anhaltspunkte
Fig. 6. Grundrifs des Hochaltnres.
sehr unwahrscheinlich, dafs man bei einer so
durchgreifenden, sich auf die ganze Choranlage
erstreckenden Erneuerung die geringen Kosten
gespart haben sollte, die aufzuwenden waren,
um dem neuen Altare einen einheitlichen Cha-
rakter zu geben. Dafs man den Sockel that-
sächlich belassen hat, kann daneben recht wohl
bestehen, da derselbe nicht derartig hervortritt,
um seine Beseitigung ebenfalls nothwendig oder
wünschenswerth erscheinen zulassen. Es kommt
des Weiteren hinzu, dafs der neue Altar, der in
seinen Längen- und Breitenabmessungen wesent-
lich über die seines Vorgängers hinausging, zu-
gleich, wie dies schon aus der Verdeckung der alten
Plinthe hervorgeht, eine Erhöhung wird erfahren
haben, wodurch dann der Unterbau des alten
Altares nicht mehr passend blieb und so einen
Ersatz erheischte. Da aufserdem in einer später
zu besprechenden Basis noch ein Stück erhalten
vor, als dieselbe den in den vier Rundsäulen
der Ecken und dem quadratischen Mittelpfeiler
bestehenden Aufbau wiederholen mufste. Die
Kapitellausbildung ist auf Grund der Detail-
formen des zur gleichen Zeit errichteten bezw.
umgestalteten Kreuzganges erfolgt; da dort die
Kapitelle der Arkadensäulen in derselben Kelch-
form, wie sie am Altare die Dienste der Eckständer
zeigen, die Kapitelle der Zwischenpfeiler aber in
reicher Weise mit naturalistischem Blattwerk ge-
schmückt sind, so ist auch hier die gleiche An-
ordnung befolgt. Der gemeinsamen Basis ent-
sprechend, ist dann auch hier ebenso wie bei den
Eckständern eine gemeinsame Deckplatte an-
genommen worden, für deren Form sich übri-
gens aus der Unteransicht der Altarplatte kein
weiterer Anhaltspunkt gewinnen läfst. Das Profil
der Altarplatte ist in Fig. 9 besonders zur
Darstellung gebracht.