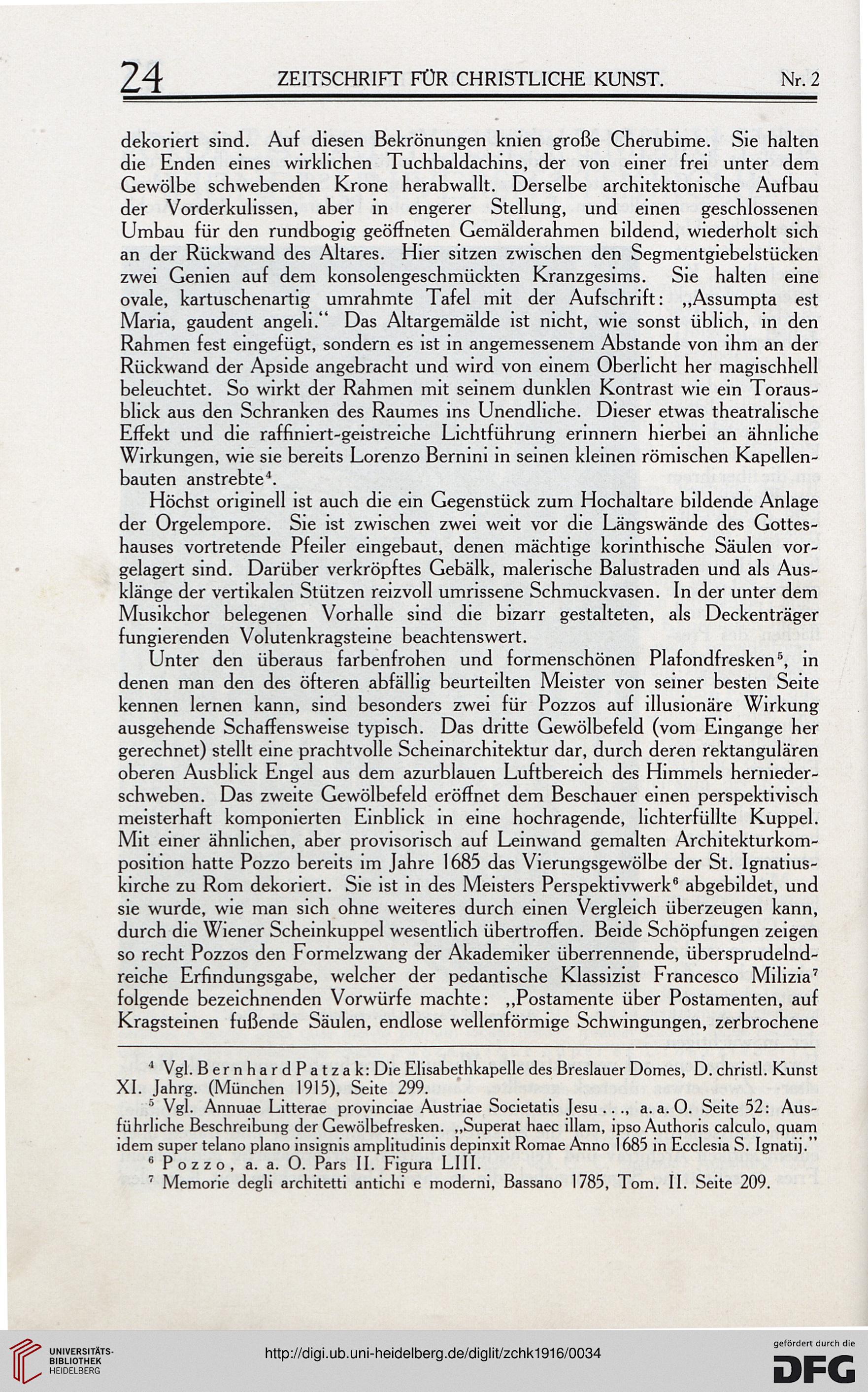24
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 2
dekoriert sind. Auf diesen Bekrönungen knien große Cherubime. Sie halten
die Enden eines wirklichen Tuchbaldachins, der von einer frei unter dem
Gewölbe schwebenden Krone herabwallt. Derselbe architektonische Aufbau
der Vorderkulissen, aber in engerer Stellung, und einen geschlossenen
Umbau für den rundbogig geöffneten Gemälderahmen bildend, wiederholt sich
an der Rückwand des Altares. Hier sitzen zwischen den Segmentgiebelstücken
zwei Genien auf dem konsolengeschmückten Kranzgesims. Sie halten eine
ovale, kartuschenartig umrahmte Tafel mit der Aufschrift: „Assumpta est
Maria, gaudent angeli." Das Altargemälde ist nicht, wie sonst üblich, in den
Rahmen fest eingefügt, sondern es ist in angemessenem Abstände von ihm an der
Rückwand der Apside angebracht und wird von einem Oberlicht her magischhell
beleuchtet. So wirkt der Rahmen mit seinem dunklen Kontrast wie ein Toraus-
blick aus den Schranken des Raumes ins Unendliche. Dieser etwas theatralische
Effekt und die raffiniert-geistreiche Lichtführung erinnern hierbei an ähnliche
Wirkungen, wie sie bereits Lorenzo Bernini in seinen kleinen römischen Kapellen-
bauten anstrebte4.
Höchst originell ist auch die ein Gegenstück zum Hochaltare bildende Anlage
der Orgelempore. Sie ist zwischen zwei weit vor die Längswände des Gottes-
hauses vortretende Pfeiler eingebaut, denen mächtige korinthische Säulen vor-
gelagert sind. Darüber verkröpftes Gebälk, malerische Balustraden und als Aus-
klänge der vertikalen Stützen reizvoll umnssene Schmuckvasen. In der unter dem
Musikchor belegenen Vorhalle sind die bizarr gestalteten, als Deckenträger
fungierenden Volutenkragsteine beachtenswert.
Unter den überaus farbenfrohen und formenschönen Plafondfresken5, in
denen man den des öfteren abfällig beurteilten Meister von seiner besten Seite
kennen lernen kann, sind besonders zwei für Pozzos auf illusionäre Wirkung
ausgehende Schaffensweise typisch. Das dritte Gewölbefeld (vom Eingange her
gerechnet) stellt eine prachtvolle Scheinarchitektur dar, durch deren rektangulären
oberen Ausblick Engel aus dem azurblauen Luftbereich des Himmels hernieder-
schweben. Das zweite Gewölbefeld eröffnet dem Beschauer einen perspektivisch
meisterhaft komponierten Einblick in eine hochragende, lichterfüllte Kuppel.
Mit einer ähnlichen, aber provisorisch auf Leinwand gemalten Architekturkom-
position hatte Pozzo bereits im Jahre 1685 das Vierungsgewölbe der St. Ignatius-
kirche zu Rom dekoriert. Sie ist in des Meisters Perspektivwerk6 abgebildet, und
sie wurde, wie man sich ohne weiteres durch einen Vergleich überzeugen kann,
durch die Wiener Scheinkuppel wesentlich übertroffen. Beide Schöpfungen zeigen
so recht Pozzos den Formelzwang der Akademiker überrennende, Übersprudelnd-
reiche Erfindungsgabe, welcher der pedantische Klassizist Francesco Milizia7
folgende bezeichnenden Vorwürfe machte: „Postamente über Postamenten, auf
Kragsteinen fußende Säulen, endlose wellenförmige Schwingungen, zerbrochene
4 Vgl. BernhardPatzak: Die Elisabethkapelle des Breslauer Domes, D. christl. Kunst
XI. Jahrg. (München 1915), Seite 299.
6 Vgl. Annuae Litterae provinciae Austriae Societatis Jesu .. ., a.a.O. Seite 52: Aus-
führliche Beschreibung der Gewölbefresken. „Superat haec lllam, ipsoAuthoris calculo, quam
idem super telano piano insignis amplitudims depinxit Romae Anno 1685 in Ecclesia S. Ignatij."
6 Pozzo, a. a. 0. Pars II. Figura LIII.
7 Memorie degli architetti antichi e moderni, Bassano 1785, Tom. II. Seite 209.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 2
dekoriert sind. Auf diesen Bekrönungen knien große Cherubime. Sie halten
die Enden eines wirklichen Tuchbaldachins, der von einer frei unter dem
Gewölbe schwebenden Krone herabwallt. Derselbe architektonische Aufbau
der Vorderkulissen, aber in engerer Stellung, und einen geschlossenen
Umbau für den rundbogig geöffneten Gemälderahmen bildend, wiederholt sich
an der Rückwand des Altares. Hier sitzen zwischen den Segmentgiebelstücken
zwei Genien auf dem konsolengeschmückten Kranzgesims. Sie halten eine
ovale, kartuschenartig umrahmte Tafel mit der Aufschrift: „Assumpta est
Maria, gaudent angeli." Das Altargemälde ist nicht, wie sonst üblich, in den
Rahmen fest eingefügt, sondern es ist in angemessenem Abstände von ihm an der
Rückwand der Apside angebracht und wird von einem Oberlicht her magischhell
beleuchtet. So wirkt der Rahmen mit seinem dunklen Kontrast wie ein Toraus-
blick aus den Schranken des Raumes ins Unendliche. Dieser etwas theatralische
Effekt und die raffiniert-geistreiche Lichtführung erinnern hierbei an ähnliche
Wirkungen, wie sie bereits Lorenzo Bernini in seinen kleinen römischen Kapellen-
bauten anstrebte4.
Höchst originell ist auch die ein Gegenstück zum Hochaltare bildende Anlage
der Orgelempore. Sie ist zwischen zwei weit vor die Längswände des Gottes-
hauses vortretende Pfeiler eingebaut, denen mächtige korinthische Säulen vor-
gelagert sind. Darüber verkröpftes Gebälk, malerische Balustraden und als Aus-
klänge der vertikalen Stützen reizvoll umnssene Schmuckvasen. In der unter dem
Musikchor belegenen Vorhalle sind die bizarr gestalteten, als Deckenträger
fungierenden Volutenkragsteine beachtenswert.
Unter den überaus farbenfrohen und formenschönen Plafondfresken5, in
denen man den des öfteren abfällig beurteilten Meister von seiner besten Seite
kennen lernen kann, sind besonders zwei für Pozzos auf illusionäre Wirkung
ausgehende Schaffensweise typisch. Das dritte Gewölbefeld (vom Eingange her
gerechnet) stellt eine prachtvolle Scheinarchitektur dar, durch deren rektangulären
oberen Ausblick Engel aus dem azurblauen Luftbereich des Himmels hernieder-
schweben. Das zweite Gewölbefeld eröffnet dem Beschauer einen perspektivisch
meisterhaft komponierten Einblick in eine hochragende, lichterfüllte Kuppel.
Mit einer ähnlichen, aber provisorisch auf Leinwand gemalten Architekturkom-
position hatte Pozzo bereits im Jahre 1685 das Vierungsgewölbe der St. Ignatius-
kirche zu Rom dekoriert. Sie ist in des Meisters Perspektivwerk6 abgebildet, und
sie wurde, wie man sich ohne weiteres durch einen Vergleich überzeugen kann,
durch die Wiener Scheinkuppel wesentlich übertroffen. Beide Schöpfungen zeigen
so recht Pozzos den Formelzwang der Akademiker überrennende, Übersprudelnd-
reiche Erfindungsgabe, welcher der pedantische Klassizist Francesco Milizia7
folgende bezeichnenden Vorwürfe machte: „Postamente über Postamenten, auf
Kragsteinen fußende Säulen, endlose wellenförmige Schwingungen, zerbrochene
4 Vgl. BernhardPatzak: Die Elisabethkapelle des Breslauer Domes, D. christl. Kunst
XI. Jahrg. (München 1915), Seite 299.
6 Vgl. Annuae Litterae provinciae Austriae Societatis Jesu .. ., a.a.O. Seite 52: Aus-
führliche Beschreibung der Gewölbefresken. „Superat haec lllam, ipsoAuthoris calculo, quam
idem super telano piano insignis amplitudims depinxit Romae Anno 1685 in Ecclesia S. Ignatij."
6 Pozzo, a. a. 0. Pars II. Figura LIII.
7 Memorie degli architetti antichi e moderni, Bassano 1785, Tom. II. Seite 209.