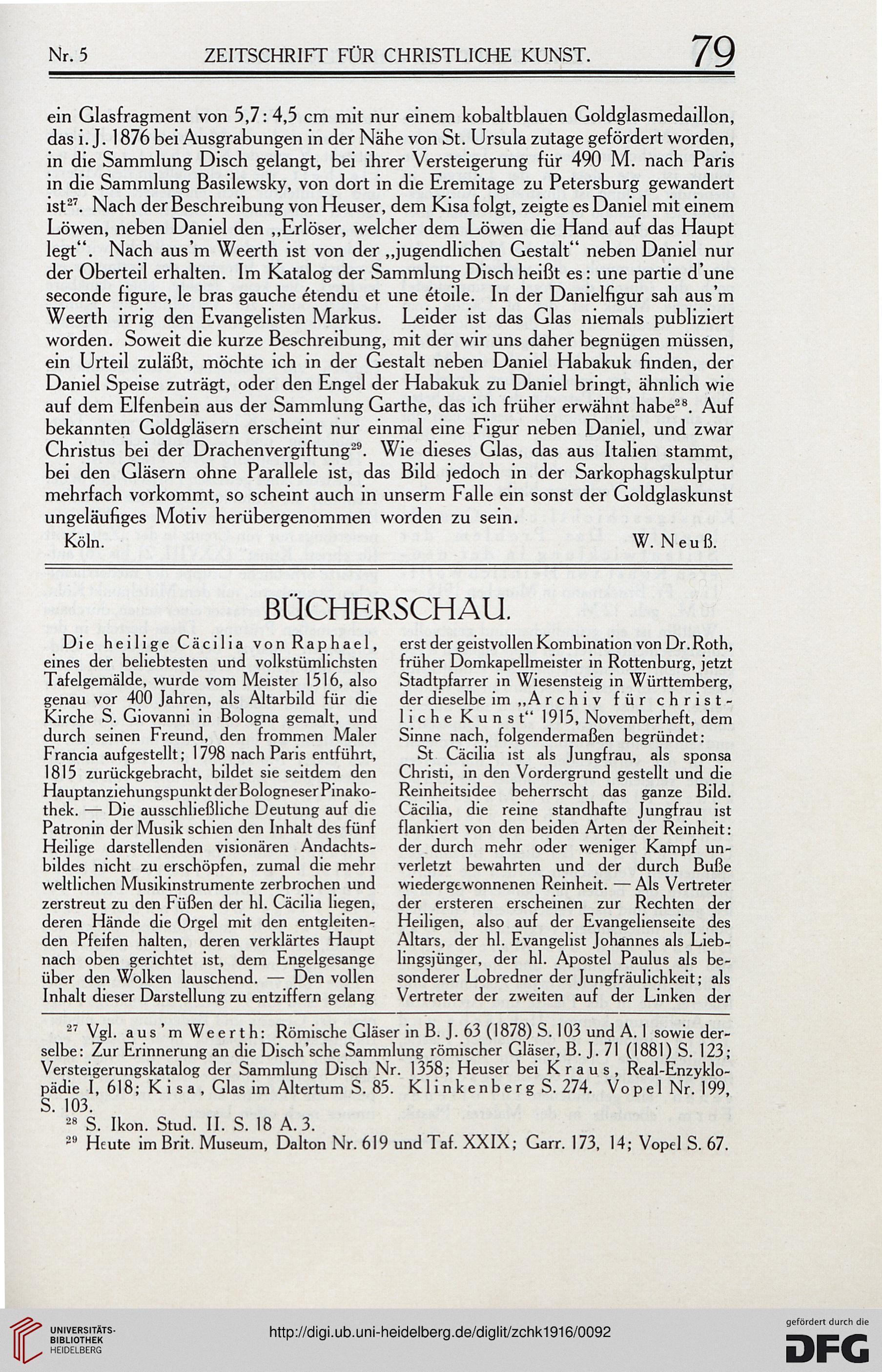Nr. 5 ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. 79
ein Glasfragment von 5,7: 4,5 cm mit nur einem kobaltblauen Goldglasmedaillon,
das i. J. 1876 bei Ausgrabungen in der Nähe von St. Ursula zutage gefördert worden,
in die Sammlung Disch gelangt, bei ihrer Versteigerung für 490 M. nach Paris
in die Sammlung Basilewsky, von dort in die Eremitage zu Petersburg gewandert
ist27. Nach der Beschreibung von Heuser, dem Kisa folgt, zeigte es Daniel mit einem
Löwen, neben Daniel den „Erlöser, welcher dem Löwen die Hand auf das Haupt
legt". Nach aus'm Weerth ist von der „jugendlichen Gestalt" neben Daniel nur
der Oberteil erhalten. Im Katalog der Sammlung Disch heißt es: une partie d'une
seconde figure, le bras gauche etendu et une etoile. In der Danielngur sah aus'm
Weerth irrig den Evangelisten Markus. Leider ist das Glas niemals publiziert
worden. Soweit die kurze Beschreibung, mit der wir uns daher begnügen müssen,
ein Urteil zuläßt, möchte ich in der Gestalt neben Daniel Habakuk finden, der
Daniel Speise zuträgt, oder den Engel der Habakuk zu Daniel bringt, ähnlich wie
auf dem Elfenbein aus der Sammlung Garthe, das ich früher erwähnt habe28. Auf
bekannten Goldgläsern erscheint nur einmal eine Figur neben Daniel, und zwar
Christus bei der Drachenvergiftung29. Wie dieses Glas, das aus Italien stammt,
bei den Gläsern ohne Parallele ist, das Bild jedoch in der Sarkophagskulptur
mehrfach vorkommt, so scheint auch in unserm Falle ein sonst der Goldglaskunst
ungeläufiges Motiv herübergenommen worden zu sein.
Köln. W. Neuß.
BÜCHERSCHAU.
Die heilige Cäcilia vonRaphael, erst der geistvollen Kombination von Dr. Roth,
eines der beliebtesten und volkstümlichsten früher Domkapellmeister in Rottenburg, jetzt
Tafelgemälde, wurde vom Meister 1516, also Stadtpfarrer in Wiesensteig in Württemberg,
genau vor 400 Jahren, als Altarbild für die der dieselbe im „A rchiv für christ-
Kirche S. Giovanni in Bologna gemalt, und liehe Kunst" 1915, Novemberheft, dem
durch seinen Freund, den frommen Maler Sinne nach, folgendermaßen begründet:
Francia aufgestellt; 1798 nach Paris entführt, St Cäcilia ist als Jungfrau, als sponsa
1815 zurückgebracht, bildet sie seitdem den Christi, in den Vordergrund gestellt und die
Hauptanziehungspunkt der Bologneser Pinako- Reinheitsidee beherrscht das ganze Bild,
thek. — Die ausschließliche Deutung auf die Cäcilia, die reine standhafte Jungfrau ist
Patronin der Musik schien den Inhalt des fünf flankiert von den beiden Arten der Reinheit:
Heilige darstellenden visionären Andachts- der durch mehr oder weniger Kampf un-
bildes nicht zu erschöpfen, zumal die mehr verletzt bewahrten und der durch Buße
weltlichen Musikinstrumente zerbrochen und wiedergewonnenen Reinheit. — Als Vertreter
zerstreut zu den Füßen der hl. Cäcilia liegen, der ersteren erscheinen zur Rechten der
deren Hände die Orgel mit den entgleiten- Heiligen, also auf der Evangelienseite des
den Pfeifen halten, deren verklärtes Haupt Altars, der hl. Evangelist Johannes als Lieb-
nach oben gerichtet ist, dem Engelgesange lingsjünger, der hl. Apostel Paulus als be-
über den Wolken lauschend. — Den vollen sonderer Lobredner der Jungfräulichkeit; als
Inhalt dieser Darstellung zu entziffern gelang Vertreter der zweiten auf der Linken der
27 Vgl. aus'm Weerth: Römische Gläser in B. J. 63 (1878) S. 103 und A. 1 sowie der-
selbe: Zur Erinnerung an die Disch'sehe Sammlung römischer Gläser, B. J. 71 (1881) S. 123;
Versteigerungskatalog der Sammlung Disch Nr. 1358; Heuser bei Kraus, Real-Enzyklo-
pädie I, 618; Kisa, Glas im Altertum S. 85. Klinkenberg S. 274. Vopel Nr. 199,
S. 103.
28 S. Ikon. Stud. II. S. 18 A.3.
29 Heute im Brit. Museum, Dalton Nr. 619 und Taf. XXIX; Garr. 173, 14; Vopel S. 67.
ein Glasfragment von 5,7: 4,5 cm mit nur einem kobaltblauen Goldglasmedaillon,
das i. J. 1876 bei Ausgrabungen in der Nähe von St. Ursula zutage gefördert worden,
in die Sammlung Disch gelangt, bei ihrer Versteigerung für 490 M. nach Paris
in die Sammlung Basilewsky, von dort in die Eremitage zu Petersburg gewandert
ist27. Nach der Beschreibung von Heuser, dem Kisa folgt, zeigte es Daniel mit einem
Löwen, neben Daniel den „Erlöser, welcher dem Löwen die Hand auf das Haupt
legt". Nach aus'm Weerth ist von der „jugendlichen Gestalt" neben Daniel nur
der Oberteil erhalten. Im Katalog der Sammlung Disch heißt es: une partie d'une
seconde figure, le bras gauche etendu et une etoile. In der Danielngur sah aus'm
Weerth irrig den Evangelisten Markus. Leider ist das Glas niemals publiziert
worden. Soweit die kurze Beschreibung, mit der wir uns daher begnügen müssen,
ein Urteil zuläßt, möchte ich in der Gestalt neben Daniel Habakuk finden, der
Daniel Speise zuträgt, oder den Engel der Habakuk zu Daniel bringt, ähnlich wie
auf dem Elfenbein aus der Sammlung Garthe, das ich früher erwähnt habe28. Auf
bekannten Goldgläsern erscheint nur einmal eine Figur neben Daniel, und zwar
Christus bei der Drachenvergiftung29. Wie dieses Glas, das aus Italien stammt,
bei den Gläsern ohne Parallele ist, das Bild jedoch in der Sarkophagskulptur
mehrfach vorkommt, so scheint auch in unserm Falle ein sonst der Goldglaskunst
ungeläufiges Motiv herübergenommen worden zu sein.
Köln. W. Neuß.
BÜCHERSCHAU.
Die heilige Cäcilia vonRaphael, erst der geistvollen Kombination von Dr. Roth,
eines der beliebtesten und volkstümlichsten früher Domkapellmeister in Rottenburg, jetzt
Tafelgemälde, wurde vom Meister 1516, also Stadtpfarrer in Wiesensteig in Württemberg,
genau vor 400 Jahren, als Altarbild für die der dieselbe im „A rchiv für christ-
Kirche S. Giovanni in Bologna gemalt, und liehe Kunst" 1915, Novemberheft, dem
durch seinen Freund, den frommen Maler Sinne nach, folgendermaßen begründet:
Francia aufgestellt; 1798 nach Paris entführt, St Cäcilia ist als Jungfrau, als sponsa
1815 zurückgebracht, bildet sie seitdem den Christi, in den Vordergrund gestellt und die
Hauptanziehungspunkt der Bologneser Pinako- Reinheitsidee beherrscht das ganze Bild,
thek. — Die ausschließliche Deutung auf die Cäcilia, die reine standhafte Jungfrau ist
Patronin der Musik schien den Inhalt des fünf flankiert von den beiden Arten der Reinheit:
Heilige darstellenden visionären Andachts- der durch mehr oder weniger Kampf un-
bildes nicht zu erschöpfen, zumal die mehr verletzt bewahrten und der durch Buße
weltlichen Musikinstrumente zerbrochen und wiedergewonnenen Reinheit. — Als Vertreter
zerstreut zu den Füßen der hl. Cäcilia liegen, der ersteren erscheinen zur Rechten der
deren Hände die Orgel mit den entgleiten- Heiligen, also auf der Evangelienseite des
den Pfeifen halten, deren verklärtes Haupt Altars, der hl. Evangelist Johannes als Lieb-
nach oben gerichtet ist, dem Engelgesange lingsjünger, der hl. Apostel Paulus als be-
über den Wolken lauschend. — Den vollen sonderer Lobredner der Jungfräulichkeit; als
Inhalt dieser Darstellung zu entziffern gelang Vertreter der zweiten auf der Linken der
27 Vgl. aus'm Weerth: Römische Gläser in B. J. 63 (1878) S. 103 und A. 1 sowie der-
selbe: Zur Erinnerung an die Disch'sehe Sammlung römischer Gläser, B. J. 71 (1881) S. 123;
Versteigerungskatalog der Sammlung Disch Nr. 1358; Heuser bei Kraus, Real-Enzyklo-
pädie I, 618; Kisa, Glas im Altertum S. 85. Klinkenberg S. 274. Vopel Nr. 199,
S. 103.
28 S. Ikon. Stud. II. S. 18 A.3.
29 Heute im Brit. Museum, Dalton Nr. 619 und Taf. XXIX; Garr. 173, 14; Vopel S. 67.