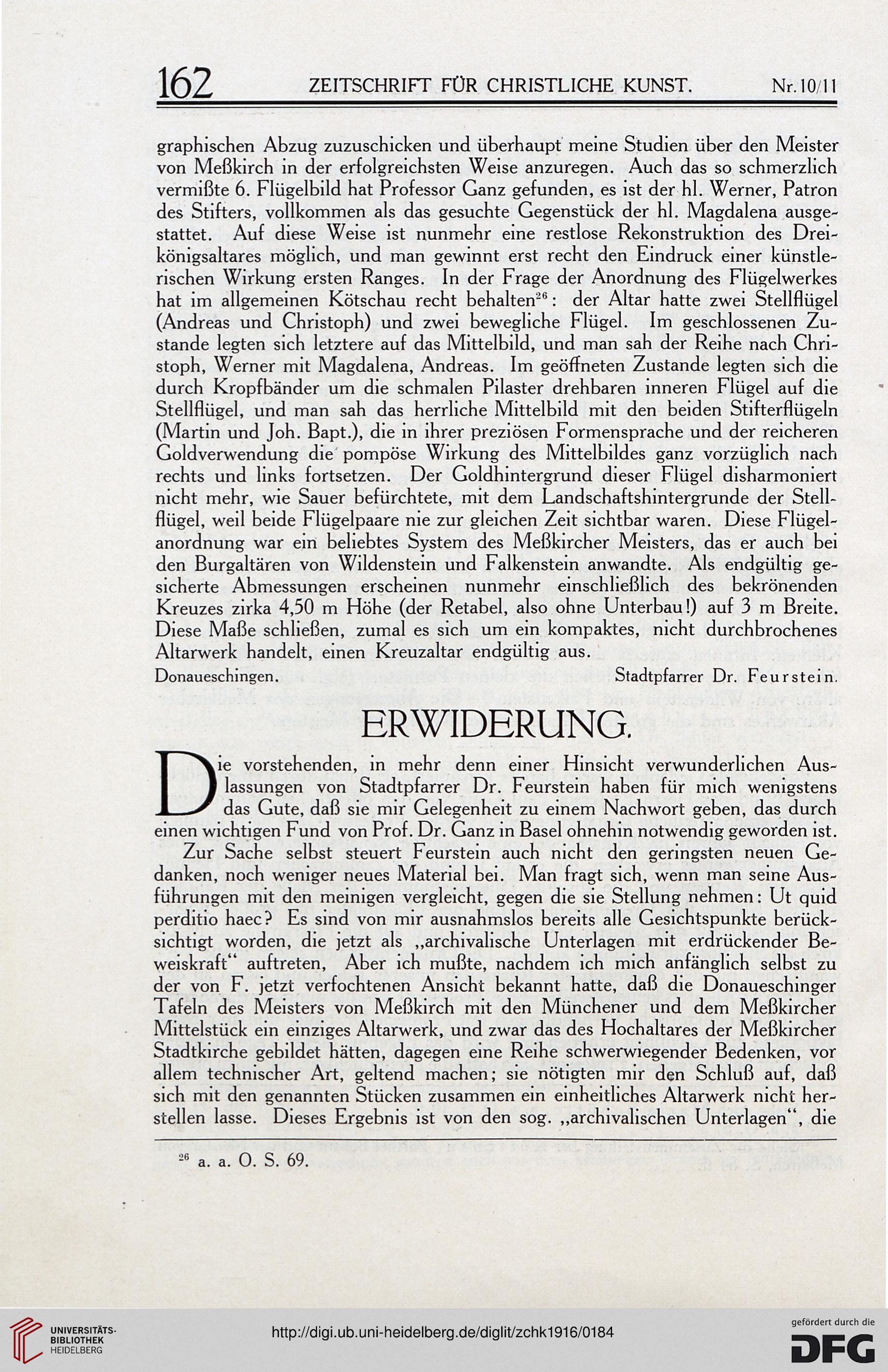162
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 10/11
graphischen Abzug zuzuschicken und überhaupt meine Studien über den Meister
von Meßkirch in der erfolgreichsten Weise anzuregen. Auch das so schmerzlich
vermißte 6. Flügelbild hat Professor Ganz gefunden, es ist der hl. Werner, Patron
des Stifters, vollkommen als das gesuchte Gegenstück der hl. Magdalena ausge-
stattet. Auf diese Weise ist nunmehr eine restlose Rekonstruktion des Drei-
königsaltares möglich, und man gewinnt erst recht den Eindruck einer künstle-
rischen Wirkung ersten Ranges. In der Frage der Anordnung des Flügelwerkes
hat im allgemeinen Kötschau recht behalten26: der Altar hatte zwei Stellflügel
(Andreas und Christoph) und zwei bewegliche Flügel. Im geschlossenen Zu-
stande legten sich letztere auf das Mittelbild, und man sah der Reihe nach Chri-
stoph, Werner mit Magdalena, Andreas. Im geöffneten Zustande legten sich die
durch Kropfbänder um die schmalen Pilaster drehbaren inneren Flügel auf die
Stellflügel, und man sah das herrliche Mittelbild mit den beiden Stifterflügeln
(Martin und Joh. Bapt.), die in ihrer preziösen Formensprache und der reicheren
Goldverwendung die pompöse Wirkung des Mittelbildes ganz vorzüglich nach
rechts und links fortsetzen. Der Goldhintergrund dieser Flügel disharmoniert
nicht mehr, wie Sauer befürchtete, mit dem Landschaftshintergrunde der Stell-
flügel, weil beide Flügelpaare nie zur gleichen Zeit sichtbar waren. Diese Flügel-
anordnung war ein beliebtes System des Meßkircher Meisters, das er auch bei
den Burgaltären von Wildenstein und Falkenstein anwandte. Als endgültig ge-
sicherte Abmessungen erscheinen nunmehr einschließlich des bekrönenden
Kreuzes zirka 4,50 m Höhe (der Retabel, also ohne Unterbau!) auf 3 m Breite.
Diese Maße schließen, zumal es sich um ein kompaktes, nicht durchbrochenes
Altarwerk handelt, einen Kreuzaltar endgültig aus.
Donaueschingen. Stadtpfarrer Dr. Feurstein.
ERWIDERUNG.
Die vorstehenden, in mehr denn einer Hinsicht verwunderlichen Aus-
lassungen von Stadtpfarrer Dr. Feurstein haben für mich wenigstens
das Gute, daß sie mir Gelegenheit zu einem Nachwort geben, das durch
einen wichtigen Fund von Prof. Dr. Ganz in Basel ohnehin notwendig geworden ist.
Zur Sache selbst steuert Feurstein auch nicht den geringsten neuen Ge-
danken, noch weniger neues Material bei. Man fragt sich, wenn man seine Aus-
führungen mit den meinigen vergleicht, gegen die sie Stellung nehmen: Ut quid
perditio haec? Es sind von mir ausnahmslos bereits alle Gesichtspunkte berück-
sichtigt worden, die jetzt als „archivalische Unterlagen mit erdrückender Be-
weiskraft" auftreten, Aber ich mußte, nachdem ich mich anfänglich selbst zu
der von F. jetzt verfochtenen Ansicht bekannt hatte, daß die Donaueschinger
Tafeln des Meisters von Meßkirch mit den Münchener und dem Meßkircher
Mittelstück ein einziges Altarwerk, und zwar das des Hochaltares der Meßkircher
Stadtkirche gebildet hätten, dagegen eine Reihe schwerwiegender Bedenken, vor
allem technischer Art, geltend machen; sie nötigten mir den Schluß auf, daß
sich mit den genannten Stücken zusammen ein einheitliches Altarwerk nicht her-
stellen lasse. Dieses Ergebnis ist von den sog. „archivalischen Unterlagen", die
26 a. a. 0. S. 69.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 10/11
graphischen Abzug zuzuschicken und überhaupt meine Studien über den Meister
von Meßkirch in der erfolgreichsten Weise anzuregen. Auch das so schmerzlich
vermißte 6. Flügelbild hat Professor Ganz gefunden, es ist der hl. Werner, Patron
des Stifters, vollkommen als das gesuchte Gegenstück der hl. Magdalena ausge-
stattet. Auf diese Weise ist nunmehr eine restlose Rekonstruktion des Drei-
königsaltares möglich, und man gewinnt erst recht den Eindruck einer künstle-
rischen Wirkung ersten Ranges. In der Frage der Anordnung des Flügelwerkes
hat im allgemeinen Kötschau recht behalten26: der Altar hatte zwei Stellflügel
(Andreas und Christoph) und zwei bewegliche Flügel. Im geschlossenen Zu-
stande legten sich letztere auf das Mittelbild, und man sah der Reihe nach Chri-
stoph, Werner mit Magdalena, Andreas. Im geöffneten Zustande legten sich die
durch Kropfbänder um die schmalen Pilaster drehbaren inneren Flügel auf die
Stellflügel, und man sah das herrliche Mittelbild mit den beiden Stifterflügeln
(Martin und Joh. Bapt.), die in ihrer preziösen Formensprache und der reicheren
Goldverwendung die pompöse Wirkung des Mittelbildes ganz vorzüglich nach
rechts und links fortsetzen. Der Goldhintergrund dieser Flügel disharmoniert
nicht mehr, wie Sauer befürchtete, mit dem Landschaftshintergrunde der Stell-
flügel, weil beide Flügelpaare nie zur gleichen Zeit sichtbar waren. Diese Flügel-
anordnung war ein beliebtes System des Meßkircher Meisters, das er auch bei
den Burgaltären von Wildenstein und Falkenstein anwandte. Als endgültig ge-
sicherte Abmessungen erscheinen nunmehr einschließlich des bekrönenden
Kreuzes zirka 4,50 m Höhe (der Retabel, also ohne Unterbau!) auf 3 m Breite.
Diese Maße schließen, zumal es sich um ein kompaktes, nicht durchbrochenes
Altarwerk handelt, einen Kreuzaltar endgültig aus.
Donaueschingen. Stadtpfarrer Dr. Feurstein.
ERWIDERUNG.
Die vorstehenden, in mehr denn einer Hinsicht verwunderlichen Aus-
lassungen von Stadtpfarrer Dr. Feurstein haben für mich wenigstens
das Gute, daß sie mir Gelegenheit zu einem Nachwort geben, das durch
einen wichtigen Fund von Prof. Dr. Ganz in Basel ohnehin notwendig geworden ist.
Zur Sache selbst steuert Feurstein auch nicht den geringsten neuen Ge-
danken, noch weniger neues Material bei. Man fragt sich, wenn man seine Aus-
führungen mit den meinigen vergleicht, gegen die sie Stellung nehmen: Ut quid
perditio haec? Es sind von mir ausnahmslos bereits alle Gesichtspunkte berück-
sichtigt worden, die jetzt als „archivalische Unterlagen mit erdrückender Be-
weiskraft" auftreten, Aber ich mußte, nachdem ich mich anfänglich selbst zu
der von F. jetzt verfochtenen Ansicht bekannt hatte, daß die Donaueschinger
Tafeln des Meisters von Meßkirch mit den Münchener und dem Meßkircher
Mittelstück ein einziges Altarwerk, und zwar das des Hochaltares der Meßkircher
Stadtkirche gebildet hätten, dagegen eine Reihe schwerwiegender Bedenken, vor
allem technischer Art, geltend machen; sie nötigten mir den Schluß auf, daß
sich mit den genannten Stücken zusammen ein einheitliches Altarwerk nicht her-
stellen lasse. Dieses Ergebnis ist von den sog. „archivalischen Unterlagen", die
26 a. a. 0. S. 69.