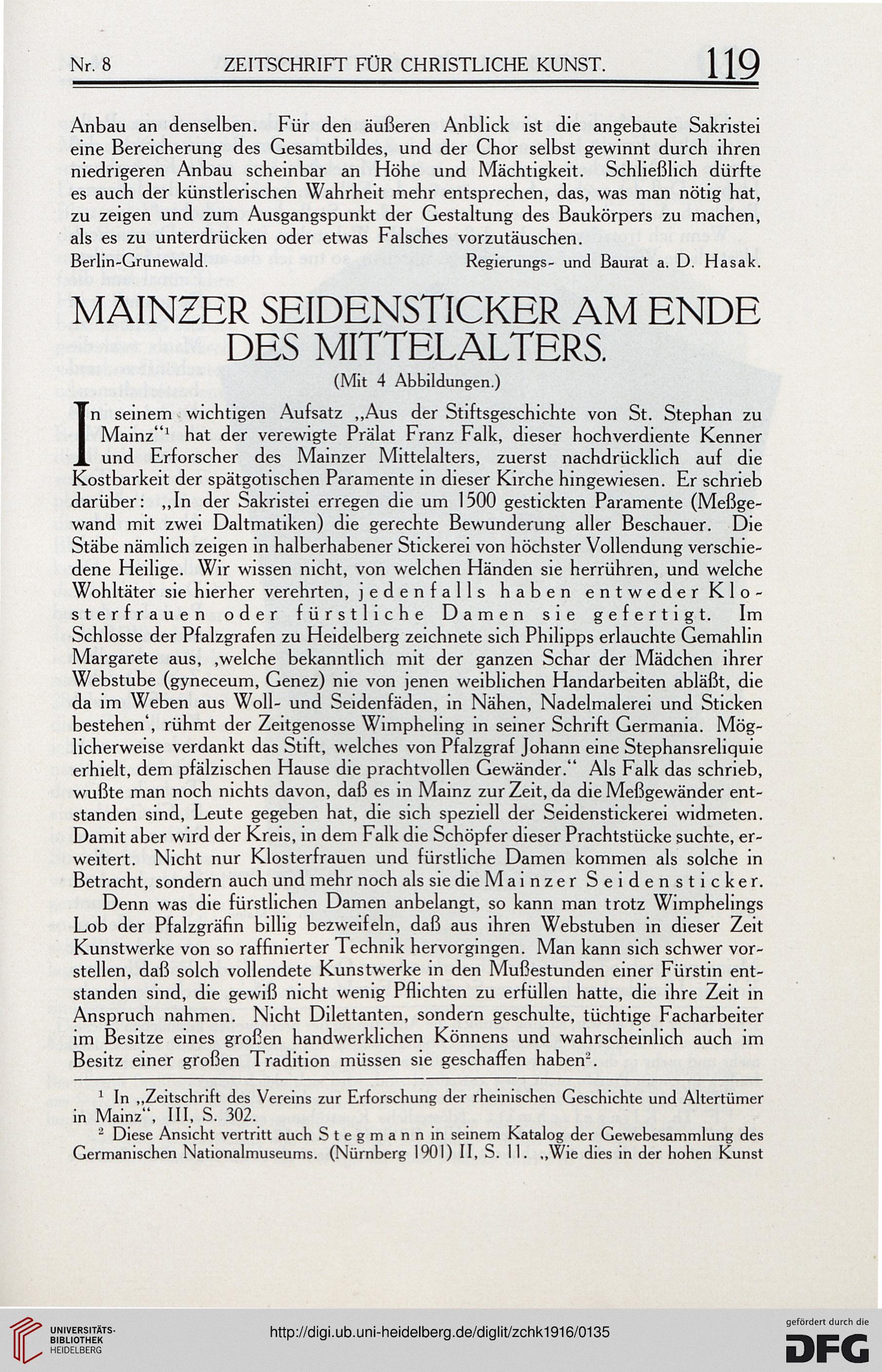Nr. 8 ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. \ \Q
Anbau an denselben. Für den äußeren Anblick ist die angebaute Sakristei
eine Bereicherung des Gesamtbildes, und der Chor selbst gewinnt durch ihren
niedrigeren Anbau scheinbar an Höhe und Mächtigkeit. Schließlich dürfte
es auch der künstlerischen Wahrheit mehr entsprechen, das, was man nötig hat,
zu zeigen und zum Ausgangspunkt der Gestaltung des Baukörpers zu machen,
als es zu unterdrücken oder etwas Falsches vorzutäuschen.
Berlin-Grunewald. Regierungs- und Baurat a. D. Hasak.
MAINZER SEIDENSTICKER AM ENDE
DES MITTELALTERS.
(Mit 4 Abbildungen.)
In seinem wichtigen Aufsatz „Aus der Stiftsgeschichte von St. Stephan zu
Mainz"1 hat der verewigte Prälat Franz Falk, dieser hochverdiente Kenner
und Erforscher des Mainzer Mittelalters, zuerst nachdrücklich auf die
Kostbarkeit der spätgotischen Paramente in dieser Kirche hingewiesen. Er schrieb
darüber: ,,In der Sakristei erregen die um 1500 gestickten Paramente (Meßge-
wand mit zwei Daltmatiken) die gerechte Bewunderung aller Beschauer. Die
Stäbe nämlich zeigen in halberhabener Stickerei von höchster Vollendung verschie-
dene Heilige. Wir wissen nicht, von welchen Händen sie herrühren, und welche
Wohltäter sie hierher verehrten, jedenfalls haben entweder Klo-
sterfrauen oder fürstliche Damen sie gefertigt. Im
Schlosse der Pfalzgrafen zu Heidelberg zeichnete sich Philipps erlauchte Gemahlin
Margarete aus, .welche bekanntlich mit der ganzen Schar der Mädchen ihrer
Webstube (gyneceum, Genez) nie von jenen weiblichen Handarbeiten abläßt, die
da im Weben aus Woll- und Seidenfäden, in Nähen, Nadelmalerei und Sticken
bestehen', rühmt der Zeitgenosse Wimpheling in seiner Schrift Germania. Mög-
licherweise verdankt das Stift, welches von Pfalzgraf Johann eine Stephansreliquie
erhielt, dem pfälzischen Hause die prachtvollen Gewänder." Als Falk das schrieb,
wußte man noch nichts davon, daß es in Mainz zur Zeit, da die Meßgewänder ent-
standen sind, Leute gegeben hat, die sich speziell der Seidenstickerei widmeten.
Damit aber wird der Kreis, in dem Falk die Schöpfer dieser Prachtstücke suchte, er-
weitert. Nicht nur Klosterfrauen und fürstliche Damen kommen als solche in
Betracht, sondern auch und mehr noch als sie die Mainzer Seidensticke r.
Denn was die fürstlichen Damen anbelangt, so kann man trotz Wimphelings
Lob der Pfalzgräfin billig bezweifeln, daß aus ihren Webstuben in dieser Zeit
Kunstwerke von so raffinierter Technik hervorgingen. Man kann sich schwer vor-
stellen, daß solch vollendete Kunstwerke in den Mußestunden einer Fürstin ent-
standen sind, die gewiß nicht wenig Pflichten zu erfüllen hatte, die ihre Zeit in
Anspruch nahmen. Nicht Dilettanten, sondern geschulte, tüchtige Facharbeiter
im Besitze eines großen handwerklichen Könnens und wahrscheinlich auch im
Besitz einer großen Tradition müssen sie geschaffen haben2.
1 In „Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Altertümer
in Mainz", III, S. 302.
2 Diese Ansicht vertritt auch Stegmann in seinem Katalog der Gewebesammlung des
Germanischen Nationalmuseums. (Nürnberg 1901) II, S. 11. „Wie dies in der hohen Kunst
Anbau an denselben. Für den äußeren Anblick ist die angebaute Sakristei
eine Bereicherung des Gesamtbildes, und der Chor selbst gewinnt durch ihren
niedrigeren Anbau scheinbar an Höhe und Mächtigkeit. Schließlich dürfte
es auch der künstlerischen Wahrheit mehr entsprechen, das, was man nötig hat,
zu zeigen und zum Ausgangspunkt der Gestaltung des Baukörpers zu machen,
als es zu unterdrücken oder etwas Falsches vorzutäuschen.
Berlin-Grunewald. Regierungs- und Baurat a. D. Hasak.
MAINZER SEIDENSTICKER AM ENDE
DES MITTELALTERS.
(Mit 4 Abbildungen.)
In seinem wichtigen Aufsatz „Aus der Stiftsgeschichte von St. Stephan zu
Mainz"1 hat der verewigte Prälat Franz Falk, dieser hochverdiente Kenner
und Erforscher des Mainzer Mittelalters, zuerst nachdrücklich auf die
Kostbarkeit der spätgotischen Paramente in dieser Kirche hingewiesen. Er schrieb
darüber: ,,In der Sakristei erregen die um 1500 gestickten Paramente (Meßge-
wand mit zwei Daltmatiken) die gerechte Bewunderung aller Beschauer. Die
Stäbe nämlich zeigen in halberhabener Stickerei von höchster Vollendung verschie-
dene Heilige. Wir wissen nicht, von welchen Händen sie herrühren, und welche
Wohltäter sie hierher verehrten, jedenfalls haben entweder Klo-
sterfrauen oder fürstliche Damen sie gefertigt. Im
Schlosse der Pfalzgrafen zu Heidelberg zeichnete sich Philipps erlauchte Gemahlin
Margarete aus, .welche bekanntlich mit der ganzen Schar der Mädchen ihrer
Webstube (gyneceum, Genez) nie von jenen weiblichen Handarbeiten abläßt, die
da im Weben aus Woll- und Seidenfäden, in Nähen, Nadelmalerei und Sticken
bestehen', rühmt der Zeitgenosse Wimpheling in seiner Schrift Germania. Mög-
licherweise verdankt das Stift, welches von Pfalzgraf Johann eine Stephansreliquie
erhielt, dem pfälzischen Hause die prachtvollen Gewänder." Als Falk das schrieb,
wußte man noch nichts davon, daß es in Mainz zur Zeit, da die Meßgewänder ent-
standen sind, Leute gegeben hat, die sich speziell der Seidenstickerei widmeten.
Damit aber wird der Kreis, in dem Falk die Schöpfer dieser Prachtstücke suchte, er-
weitert. Nicht nur Klosterfrauen und fürstliche Damen kommen als solche in
Betracht, sondern auch und mehr noch als sie die Mainzer Seidensticke r.
Denn was die fürstlichen Damen anbelangt, so kann man trotz Wimphelings
Lob der Pfalzgräfin billig bezweifeln, daß aus ihren Webstuben in dieser Zeit
Kunstwerke von so raffinierter Technik hervorgingen. Man kann sich schwer vor-
stellen, daß solch vollendete Kunstwerke in den Mußestunden einer Fürstin ent-
standen sind, die gewiß nicht wenig Pflichten zu erfüllen hatte, die ihre Zeit in
Anspruch nahmen. Nicht Dilettanten, sondern geschulte, tüchtige Facharbeiter
im Besitze eines großen handwerklichen Könnens und wahrscheinlich auch im
Besitz einer großen Tradition müssen sie geschaffen haben2.
1 In „Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Altertümer
in Mainz", III, S. 302.
2 Diese Ansicht vertritt auch Stegmann in seinem Katalog der Gewebesammlung des
Germanischen Nationalmuseums. (Nürnberg 1901) II, S. 11. „Wie dies in der hohen Kunst