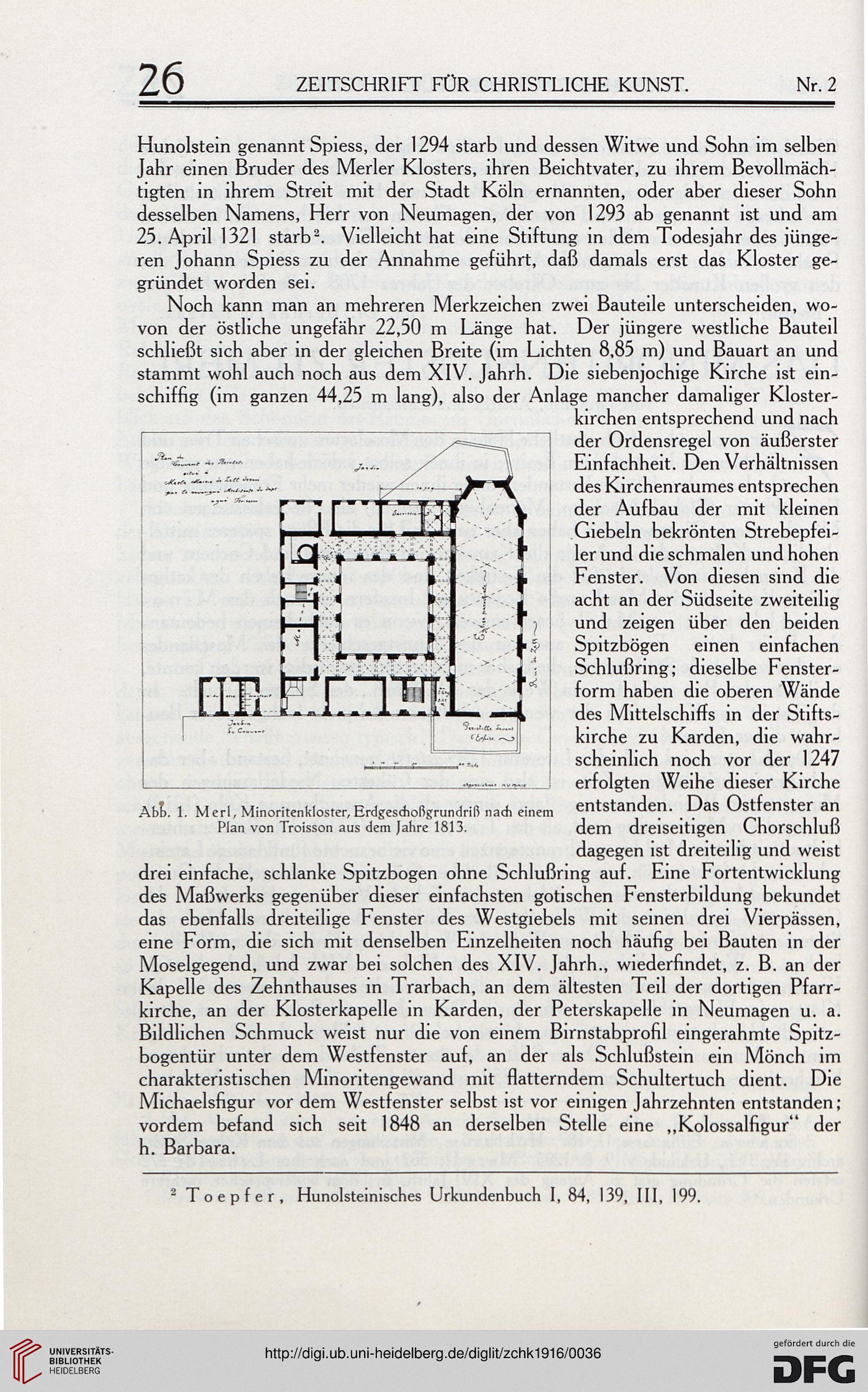26
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 2
Hunolstein genannt Spiess, der 1294 starb und dessen Witwe und Sohn im selben
Jahr einen Bruder des Merler Klosters, ihren Beichtvater, zu ihrem Bevollmäch-
tigten in ihrem Streit mit der Stadt Köln ernannten, oder aber dieser Sohn
desselben Namens, Herr von Neumagen, der von 1293 ab genannt ist und am
25. April 1321 starb2. Vielleicht hat eine Stiftung in dem Todesjahr des jünge-
ren Johann Spiess zu der Annahme geführt, daß damals erst das Kloster ge-
gründet worden sei.
Noch kann man an mehreren Merkzeichen zwei Bauteile unterscheiden, wo-
von der östliche ungefähr 22,50 m Länge hat. Der jüngere westliche Bauteil
schließt sich aber in der gleichen Breite (im Lichten 8,85 m) und Bauart an und
stammt wohl auch noch aus dem XIV. Jahrh. Die siebenjochige Kirche ist ein-
schiffig (im ganzen 44,25 m lang), also der Anlage mancher damaliger Kloster-
kirchen entsprechend und nach
der Ordensregel von äußerster
Einfachheit. Den Verhältnissen
des Kirchenraumes entsprechen
der Aufbau der mit kleinen
Giebeln bekrönten Strebepfei-
ler und die schmalen und hohen
Fenster. Von diesen sind die
acht an der Südseite zweiteilig
und zeigen über den beiden
Spitzbögen einen einfachen
Schlußring; dieselbe Fenster-
form haben die oberen Wände
des Mittelschiffs in der Stifts-
kirche zu Karden, die wahr-
scheinlich noch vor der 1247
erfolgten Weihe dieser Kirche
entstanden. Das Ostfenster an
dem dreiseitigen Chorschluß
dagegen ist dreiteilig und weist
drei einfache, schlanke Spitzbogen ohne Schlußring auf. Eine Fortentwicklung
des Maßwerks gegenüber dieser einfachsten gotischen Fensterbildung bekundet
das ebenfalls dreiteilige Fenster des Westgiebels mit seinen drei Vierpässen,
eine Form, die sich mit denselben Einzelheiten noch häufig bei Bauten in der
Moselgegend, und zwar bei solchen des XIV. Jahrh., wiederfindet, z. B. an der
Kapelle des Zehnthauses in Trarbach, an dem ältesten Teil der dortigen Pfarr-
kirche, an der Klosterkapelle in Karden, der Peterskapelle in Neumagen u. a.
Bildlichen Schmuck weist nur die von einem Birnstabprofil eingerahmte Spitz-
bogentür unter dem Westfenster auf, an der als Schlußstein ein Mönch im
charakteristischen Minontengewand mit flatterndem Schultertuch dient. Die
Michaelsfigur vor dem Westfenster selbst ist vor einigen Jahrzehnten entstanden;
vordem befand sich seit 1848 an derselben Stelle eine „Kolossalfigur" der
h. Barbara.
Abb. 1. Merl, Minoritenkloster, Erdgeschoßgrundriß nach einem
Plan von Troisson aus dem Jahre 1813.
2 Toepfer, Hunolsteinisches Urkundenbuch I, 84, 139, III, 199.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 2
Hunolstein genannt Spiess, der 1294 starb und dessen Witwe und Sohn im selben
Jahr einen Bruder des Merler Klosters, ihren Beichtvater, zu ihrem Bevollmäch-
tigten in ihrem Streit mit der Stadt Köln ernannten, oder aber dieser Sohn
desselben Namens, Herr von Neumagen, der von 1293 ab genannt ist und am
25. April 1321 starb2. Vielleicht hat eine Stiftung in dem Todesjahr des jünge-
ren Johann Spiess zu der Annahme geführt, daß damals erst das Kloster ge-
gründet worden sei.
Noch kann man an mehreren Merkzeichen zwei Bauteile unterscheiden, wo-
von der östliche ungefähr 22,50 m Länge hat. Der jüngere westliche Bauteil
schließt sich aber in der gleichen Breite (im Lichten 8,85 m) und Bauart an und
stammt wohl auch noch aus dem XIV. Jahrh. Die siebenjochige Kirche ist ein-
schiffig (im ganzen 44,25 m lang), also der Anlage mancher damaliger Kloster-
kirchen entsprechend und nach
der Ordensregel von äußerster
Einfachheit. Den Verhältnissen
des Kirchenraumes entsprechen
der Aufbau der mit kleinen
Giebeln bekrönten Strebepfei-
ler und die schmalen und hohen
Fenster. Von diesen sind die
acht an der Südseite zweiteilig
und zeigen über den beiden
Spitzbögen einen einfachen
Schlußring; dieselbe Fenster-
form haben die oberen Wände
des Mittelschiffs in der Stifts-
kirche zu Karden, die wahr-
scheinlich noch vor der 1247
erfolgten Weihe dieser Kirche
entstanden. Das Ostfenster an
dem dreiseitigen Chorschluß
dagegen ist dreiteilig und weist
drei einfache, schlanke Spitzbogen ohne Schlußring auf. Eine Fortentwicklung
des Maßwerks gegenüber dieser einfachsten gotischen Fensterbildung bekundet
das ebenfalls dreiteilige Fenster des Westgiebels mit seinen drei Vierpässen,
eine Form, die sich mit denselben Einzelheiten noch häufig bei Bauten in der
Moselgegend, und zwar bei solchen des XIV. Jahrh., wiederfindet, z. B. an der
Kapelle des Zehnthauses in Trarbach, an dem ältesten Teil der dortigen Pfarr-
kirche, an der Klosterkapelle in Karden, der Peterskapelle in Neumagen u. a.
Bildlichen Schmuck weist nur die von einem Birnstabprofil eingerahmte Spitz-
bogentür unter dem Westfenster auf, an der als Schlußstein ein Mönch im
charakteristischen Minontengewand mit flatterndem Schultertuch dient. Die
Michaelsfigur vor dem Westfenster selbst ist vor einigen Jahrzehnten entstanden;
vordem befand sich seit 1848 an derselben Stelle eine „Kolossalfigur" der
h. Barbara.
Abb. 1. Merl, Minoritenkloster, Erdgeschoßgrundriß nach einem
Plan von Troisson aus dem Jahre 1813.
2 Toepfer, Hunolsteinisches Urkundenbuch I, 84, 139, III, 199.