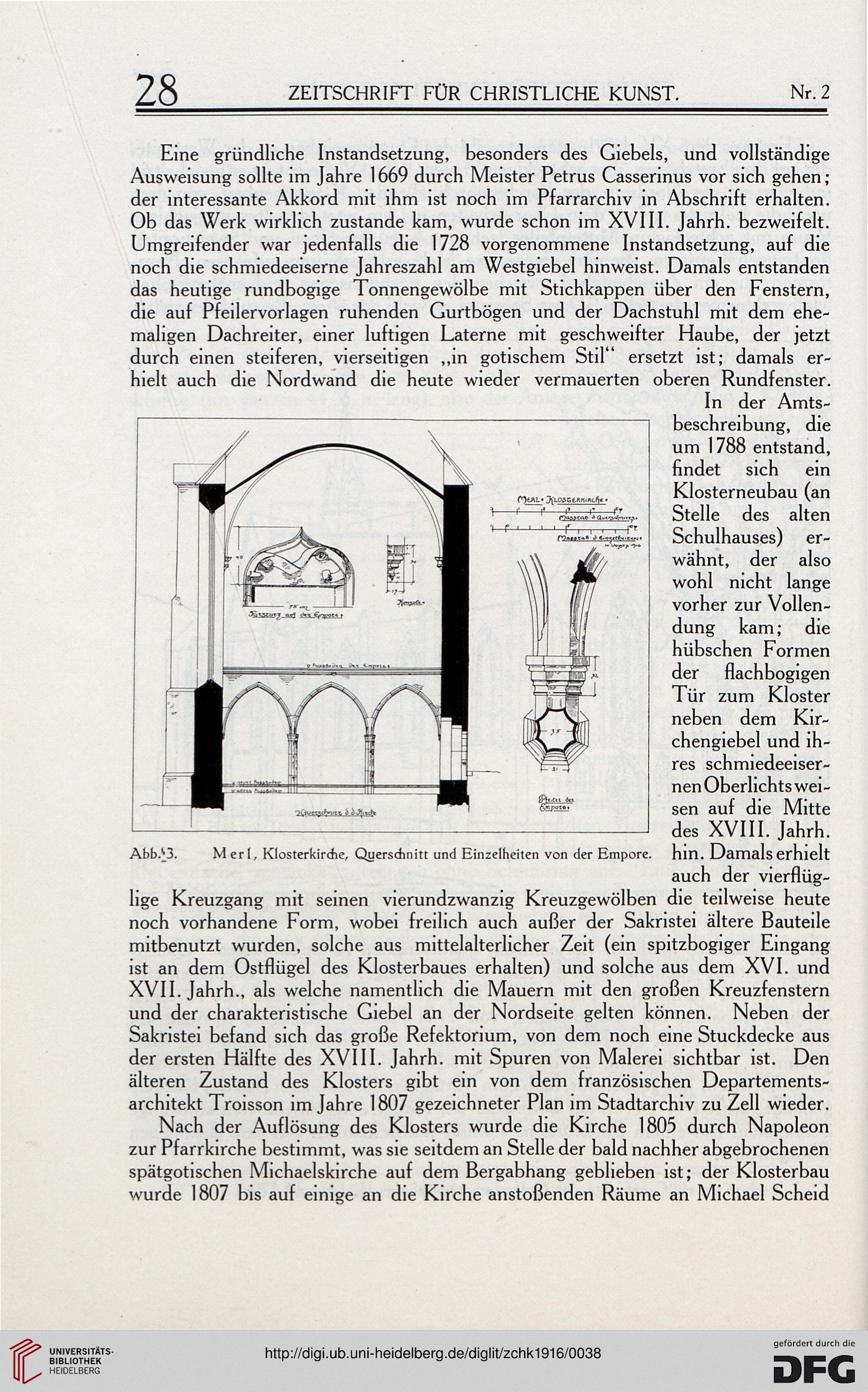28
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 2
Eine gründliche Instandsetzung, besonders des Giebels, und vollständige
Ausweisung sollte im Jahre 1669 durch Meister Petrus Casserinus vor sich gehen;
der interessante Akkord mit ihm ist noch im Pfarrarchiv in Abschrift erhalten.
Ob das Werk wirklich zustande kam, wurde schon im XVIII. Jahrh. bezweifelt.
Umgreifender war jedenfalls die 1728 vorgenommene Instandsetzung, auf die
noch die schmiedeeiserne Jahreszahl am Westgiebel hinweist. Damals entstanden
das heutige rundbogige Tonnengewölbe mit Stichkappen über den Fenstern,
die auf Pfeilervorlagen ruhenden Gurtbögen und der Dachstuhl mit dem ehe-
maligen Dachreiter, einer luftigen Laterne mit geschweifter Haube, der jetzt
durch einen steiferen, vierseitigen „in gotischem Stil" ersetzt ist; damals er-
hielt auch die Nordwand die heute wieder vermauerten oberen Rundfenster.
In der Amts-
beschreibung, die
um 1788 entstand,
findet sich ein
Klosterneubau (an
Stelle des alten
Schulhauses) er-
wähnt, der also
wohl nicht lange
vorher zur Vollen-
dung kam; die
hübschen Formen
der flachbogigen
Tür zum Kloster
neben dem Kir-
chengiebel und ih-
res schmiedeeiser-
nen Oberlichts wei-
sen auf die Mitte
des XVIII. Jahrh.
hin. Damals erhielt
auch der vierflüg-
lige Kreuzgang mit seinen vierundzwanzig Kreuzgewölben die teilweise heute
noch vorhandene Form, wobei freilich auch außer der Sakristei ältere Bauteile
mitbenutzt wurden, solche aus mittelalterlicher Zeit (ein spitzbogiger Eingang
ist an dem Ostflügel des Klosterbaues erhalten) und solche aus dem XVI. und
XVII. Jahrh., als welche namentlich die Mauern mit den großen Kreuzfenstern
und der charakteristische Giebel an der Nordseite gelten können. Neben der
Sakristei befand sich das große Refektorium, von dem noch eine Stuckdecke aus
der ersten Hälfte des XVIII. Jahrh. mit Spuren von Malerei sichtbar ist. Den
älteren Zustand des Klosters gibt ein von dem französischen Departements-
architekt Troisson im Jahre 1807 gezeichneter Plan im Stadtarchiv zu Zell wieder.
Nach der Auflösung des Klosters wurde die Kirche 1805 durch Napoleon
zur Pfarrkirche bestimmt, was sie seitdem an Stelle der bald nachher abgebrochenen
spätgotischen Michaelskirche auf dem Bergabhang geblieben ist; der Klosterbau
wurde 1807 bis auf einige an die Kirche anstoßenden Räume an Michael Scheid
OQmT$cfr).ts i i Jfittft
Abb>3. Merl, Klosterkirche, Querschnitt und Einzelheiten von der Empore.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 2
Eine gründliche Instandsetzung, besonders des Giebels, und vollständige
Ausweisung sollte im Jahre 1669 durch Meister Petrus Casserinus vor sich gehen;
der interessante Akkord mit ihm ist noch im Pfarrarchiv in Abschrift erhalten.
Ob das Werk wirklich zustande kam, wurde schon im XVIII. Jahrh. bezweifelt.
Umgreifender war jedenfalls die 1728 vorgenommene Instandsetzung, auf die
noch die schmiedeeiserne Jahreszahl am Westgiebel hinweist. Damals entstanden
das heutige rundbogige Tonnengewölbe mit Stichkappen über den Fenstern,
die auf Pfeilervorlagen ruhenden Gurtbögen und der Dachstuhl mit dem ehe-
maligen Dachreiter, einer luftigen Laterne mit geschweifter Haube, der jetzt
durch einen steiferen, vierseitigen „in gotischem Stil" ersetzt ist; damals er-
hielt auch die Nordwand die heute wieder vermauerten oberen Rundfenster.
In der Amts-
beschreibung, die
um 1788 entstand,
findet sich ein
Klosterneubau (an
Stelle des alten
Schulhauses) er-
wähnt, der also
wohl nicht lange
vorher zur Vollen-
dung kam; die
hübschen Formen
der flachbogigen
Tür zum Kloster
neben dem Kir-
chengiebel und ih-
res schmiedeeiser-
nen Oberlichts wei-
sen auf die Mitte
des XVIII. Jahrh.
hin. Damals erhielt
auch der vierflüg-
lige Kreuzgang mit seinen vierundzwanzig Kreuzgewölben die teilweise heute
noch vorhandene Form, wobei freilich auch außer der Sakristei ältere Bauteile
mitbenutzt wurden, solche aus mittelalterlicher Zeit (ein spitzbogiger Eingang
ist an dem Ostflügel des Klosterbaues erhalten) und solche aus dem XVI. und
XVII. Jahrh., als welche namentlich die Mauern mit den großen Kreuzfenstern
und der charakteristische Giebel an der Nordseite gelten können. Neben der
Sakristei befand sich das große Refektorium, von dem noch eine Stuckdecke aus
der ersten Hälfte des XVIII. Jahrh. mit Spuren von Malerei sichtbar ist. Den
älteren Zustand des Klosters gibt ein von dem französischen Departements-
architekt Troisson im Jahre 1807 gezeichneter Plan im Stadtarchiv zu Zell wieder.
Nach der Auflösung des Klosters wurde die Kirche 1805 durch Napoleon
zur Pfarrkirche bestimmt, was sie seitdem an Stelle der bald nachher abgebrochenen
spätgotischen Michaelskirche auf dem Bergabhang geblieben ist; der Klosterbau
wurde 1807 bis auf einige an die Kirche anstoßenden Räume an Michael Scheid
OQmT$cfr).ts i i Jfittft
Abb>3. Merl, Klosterkirche, Querschnitt und Einzelheiten von der Empore.