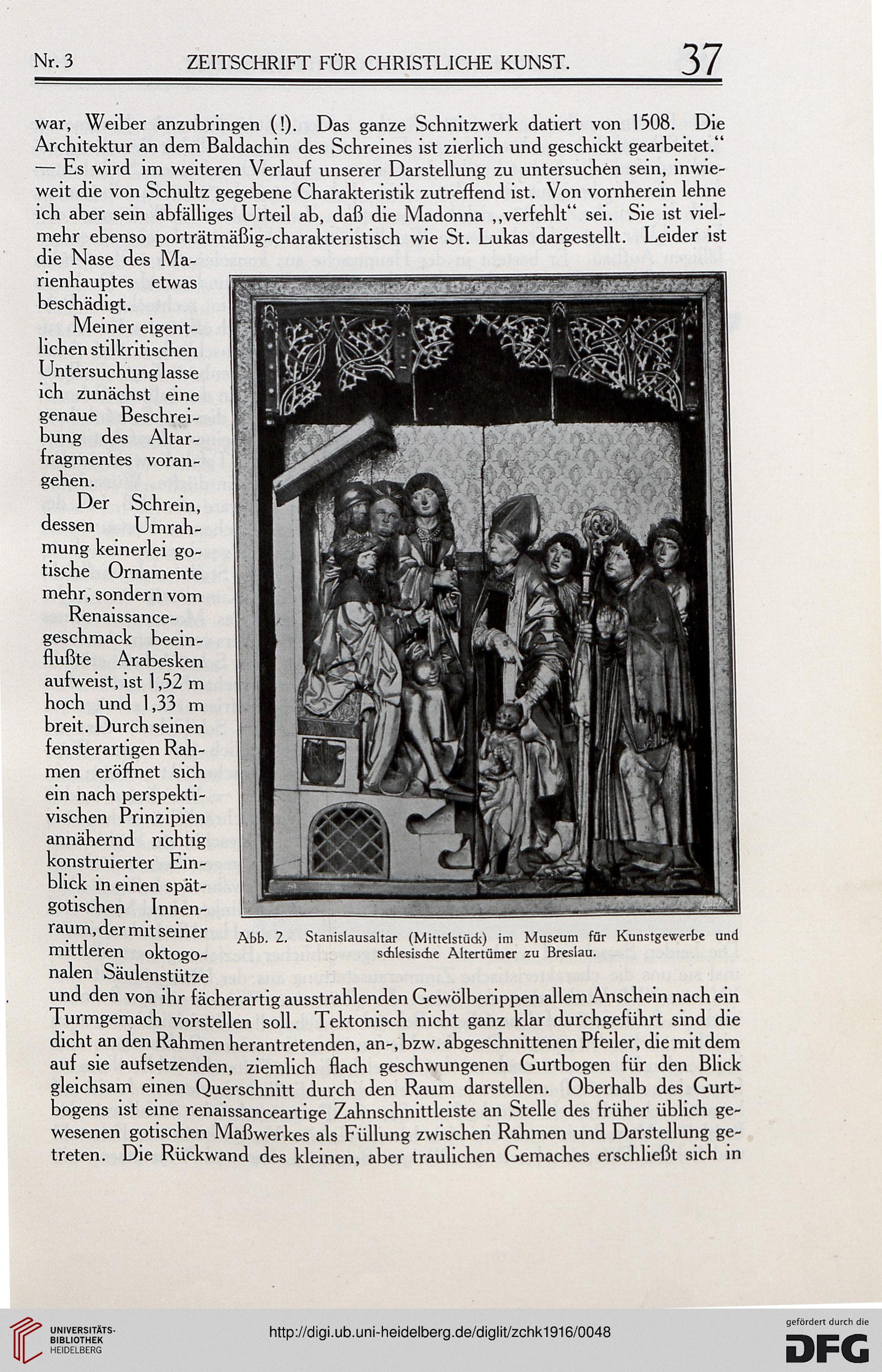Nr. 3
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
37
war, Weiber anzubringen (!). Das ganze Schnitzwerk datiert von 1508. Die
Architektur an dem Baldachin des Schreines ist zierlich und geschickt gearbeitet."
— Es wird im weiteren Verlauf unserer Darstellung zu untersuchen sein, inwie-
weit die von Schultz gegebene Charakteristik zutreffend ist. Von vornherein lehne
ich aber sein abfälliges Urteil ab, daß die Madonna „verfehlt" sei. Sie ist viel-
mehr ebenso porträtmäßig-charakteristisch wie St. Lukas dargestellt. Leider ist
die Nase des Ma-
rienhauptes etwas
beschädigt.
Meiner eigent-
lichen stilkritischen
Untersuchung lasse
ich zunächst eine
genaue Beschrei-
bung des Altar-
fragmentes voran-
gehen.
Der Schrein,
dessen Umrah-
mung keinerlei go-
tische Ornamente
mehr, sondern vom
Renaissance-
geschmack beein-
flußte Arabesken
aufweist, ist 1,52 m
hoch und 1,33 m
breit. Durch seinen
fensterartigen Rah-
men eröffnet sich
ein nach perspekti-
vischen Prinzipien
annähernd richtig
konstruierter Ein-
blick in einen spät-
gotischen Innen-
raum, der mit seiner
mittleren oktogo-
nalen Säulenstütze
und den von ihr fächerartig ausstrahlenden Gewölberippen allem Anschein nach ein
Turmgemach vorstellen soll. Tektonisch nicht ganz klar durchgeführt sind die
dicht an den Rahmen herantretenden, an-, bzw. abgeschnittenen Pfeiler, die mit dem
auf sie aufsetzenden, ziemlich flach geschwungenen Gurtbogen für den Blick
gleichsam einen Querschnitt durch den Raum darstellen. Oberhalb des Gurt-
bogens ist eine renaissanceartige Zahnschnittleiste an Stelle des früher üblich ge-
wesenen gotischen Maßwerkes als Füllung zwischen Rahmen und Darstellung ge-
treten. Die Rückwand des kleinen, aber traulichen Gemaches erschließt sich in
Abb. 2. Stanislausaltar (MittelstüA) im Museum für Kunstgewerbe und
schlesisdie Altertümer zu Breslau.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
37
war, Weiber anzubringen (!). Das ganze Schnitzwerk datiert von 1508. Die
Architektur an dem Baldachin des Schreines ist zierlich und geschickt gearbeitet."
— Es wird im weiteren Verlauf unserer Darstellung zu untersuchen sein, inwie-
weit die von Schultz gegebene Charakteristik zutreffend ist. Von vornherein lehne
ich aber sein abfälliges Urteil ab, daß die Madonna „verfehlt" sei. Sie ist viel-
mehr ebenso porträtmäßig-charakteristisch wie St. Lukas dargestellt. Leider ist
die Nase des Ma-
rienhauptes etwas
beschädigt.
Meiner eigent-
lichen stilkritischen
Untersuchung lasse
ich zunächst eine
genaue Beschrei-
bung des Altar-
fragmentes voran-
gehen.
Der Schrein,
dessen Umrah-
mung keinerlei go-
tische Ornamente
mehr, sondern vom
Renaissance-
geschmack beein-
flußte Arabesken
aufweist, ist 1,52 m
hoch und 1,33 m
breit. Durch seinen
fensterartigen Rah-
men eröffnet sich
ein nach perspekti-
vischen Prinzipien
annähernd richtig
konstruierter Ein-
blick in einen spät-
gotischen Innen-
raum, der mit seiner
mittleren oktogo-
nalen Säulenstütze
und den von ihr fächerartig ausstrahlenden Gewölberippen allem Anschein nach ein
Turmgemach vorstellen soll. Tektonisch nicht ganz klar durchgeführt sind die
dicht an den Rahmen herantretenden, an-, bzw. abgeschnittenen Pfeiler, die mit dem
auf sie aufsetzenden, ziemlich flach geschwungenen Gurtbogen für den Blick
gleichsam einen Querschnitt durch den Raum darstellen. Oberhalb des Gurt-
bogens ist eine renaissanceartige Zahnschnittleiste an Stelle des früher üblich ge-
wesenen gotischen Maßwerkes als Füllung zwischen Rahmen und Darstellung ge-
treten. Die Rückwand des kleinen, aber traulichen Gemaches erschließt sich in
Abb. 2. Stanislausaltar (MittelstüA) im Museum für Kunstgewerbe und
schlesisdie Altertümer zu Breslau.