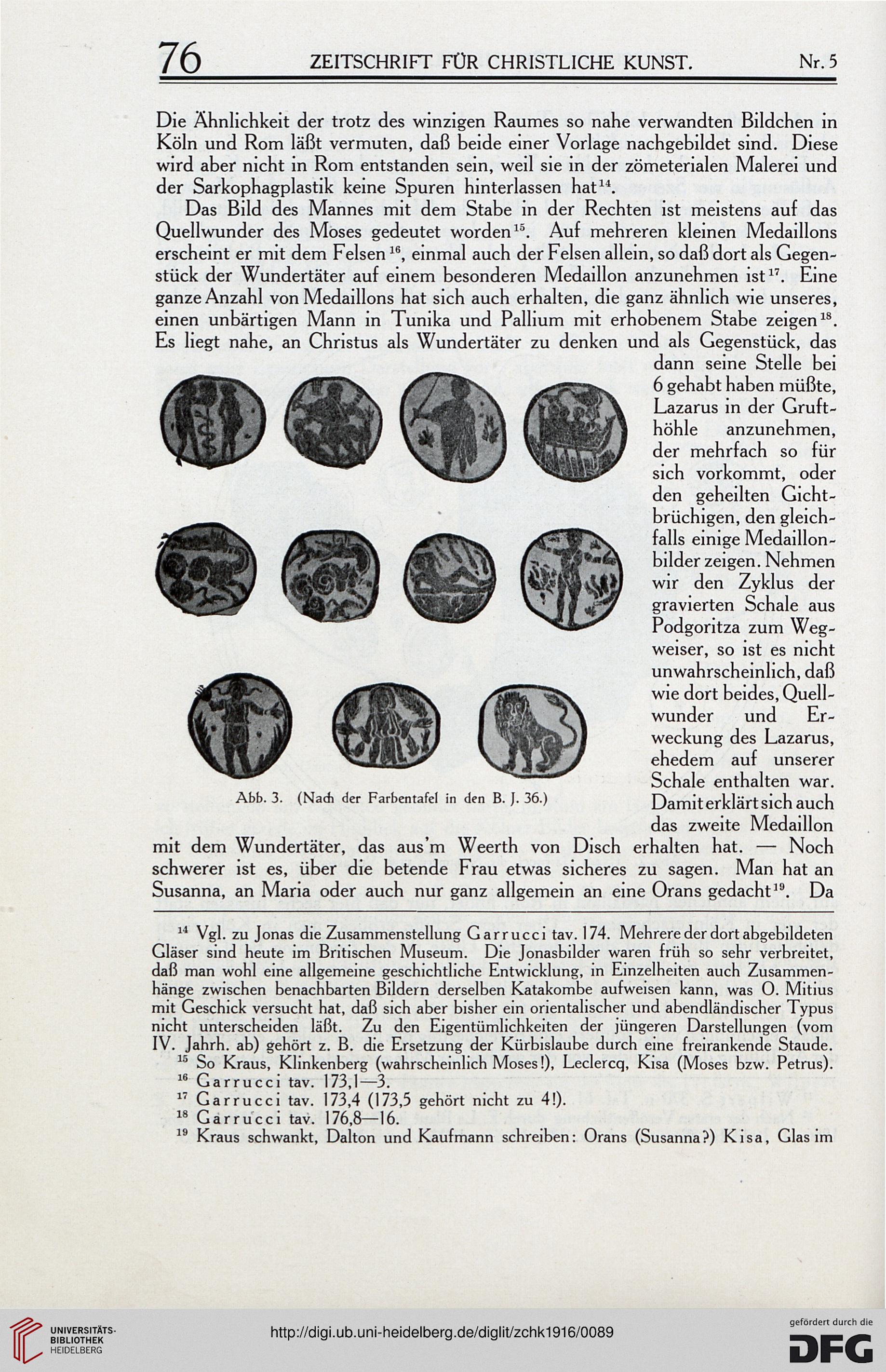76
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 5
Die Ähnlichkeit der trotz des winzigen Raumes so nahe verwandten Bildchen in
Köln und Rom läßt vermuten, daß beide einer Vorlage nachgebildet sind. Diese
wird aber nicht in Rom entstanden sein, weil sie in der zömeterialen Malerei und
der Sarkophagplastik keine Spuren hinterlassen hat14.
Das Bild des Mannes mit dem Stabe in der Rechten ist meistens auf das
Quellwunder des Moses gedeutet worden15. Auf mehreren kleinen Medaillons
erscheint er mit dem Felsen16, einmal auch der Felsen allein, so daß dort als Gegen-
stück der Wundertäter auf einem besonderen Medaillon anzunehmen ist17. Eine
ganze Anzahl von Medaillons hat sich auch erhalten, die ganz ähnlich wie unseres,
einen unbärtigen Mann in Tunika und Pallium mit erhobenem Stabe zeigen18.
Es liegt nahe, an Christus als Wundertäter zu denken und als Gegenstück, das
dann seine Stelle bei
6 gehabt haben müßte,
Lazarus in der Gruft-
höhle anzunehmen,
der mehrfach so für
sich vorkommt, oder
den geheilten Gicht-
brüchigen, den gleich-
falls einige Medaillon-
bilder zeigen. Nehmen
wir den Zyklus der
gravierten Schale aus
Podgontza zum Weg-
weiser, so ist es nicht
unwahrscheinlich, daß
wie dort beides, Quell-
wunder und Er-
weckung des Lazarus,
ehedem auf unserer
Schale enthalten war.
Damit erklärt sich auch
das zweite Medaillon
mit dem Wundertäter, das aus'm Weerth von Disch erhalten hat. — Noch
schwerer ist es, über die betende Frau etwas sicheres zu sagen. Man hat an
Susanna, an Maria oder auch nur ganz allgemein an eine Orans gedacht39. Da
14 Vgl. zu Jonas die Zusammenstellung Garrucci tav. 174. Mehrere der dort abgebildeten
Gläser sind heute im Britischen Museum. Die Jonasbilder waren früh so sehr verbreitet,
daß man wohl eine allgemeine geschichtliche Entwicklung, in Einzelheiten auch Zusammen-
hänge zwischen benachbarten Bildern derselben Katakombe aufweisen kann, was O. Mitius
mit Geschick versucht hat, daß sich aber bisher ein orientalischer und abendländischer Typus
nicht unterscheiden läßt. Zu den Eigentümlichkeiten der jüngeren Darstellungen (vom
IV. Jahrh. ab) gehört z. B. die Ersetzung der Kürbislaube durch eine freirankende Staude.
15 So Kraus, Klinkenberg (wahrscheinlich Moses!), Leclercq, Kisa (Moses bzw. Petrus).
16 Garrucci tav. 173,1—3.
17 Garrucci tav. 173,4 (173,5 gehört nicht zu 4!).
18 Garrucci tav. 176,8—16.
19 Kraus schwankt, Dalton und Kaufmann schreiben: Orans (Susanna?) Kisa, Glas im
Abb. 3. (Narfi der Farbentafel in den B. J. 36.)
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 5
Die Ähnlichkeit der trotz des winzigen Raumes so nahe verwandten Bildchen in
Köln und Rom läßt vermuten, daß beide einer Vorlage nachgebildet sind. Diese
wird aber nicht in Rom entstanden sein, weil sie in der zömeterialen Malerei und
der Sarkophagplastik keine Spuren hinterlassen hat14.
Das Bild des Mannes mit dem Stabe in der Rechten ist meistens auf das
Quellwunder des Moses gedeutet worden15. Auf mehreren kleinen Medaillons
erscheint er mit dem Felsen16, einmal auch der Felsen allein, so daß dort als Gegen-
stück der Wundertäter auf einem besonderen Medaillon anzunehmen ist17. Eine
ganze Anzahl von Medaillons hat sich auch erhalten, die ganz ähnlich wie unseres,
einen unbärtigen Mann in Tunika und Pallium mit erhobenem Stabe zeigen18.
Es liegt nahe, an Christus als Wundertäter zu denken und als Gegenstück, das
dann seine Stelle bei
6 gehabt haben müßte,
Lazarus in der Gruft-
höhle anzunehmen,
der mehrfach so für
sich vorkommt, oder
den geheilten Gicht-
brüchigen, den gleich-
falls einige Medaillon-
bilder zeigen. Nehmen
wir den Zyklus der
gravierten Schale aus
Podgontza zum Weg-
weiser, so ist es nicht
unwahrscheinlich, daß
wie dort beides, Quell-
wunder und Er-
weckung des Lazarus,
ehedem auf unserer
Schale enthalten war.
Damit erklärt sich auch
das zweite Medaillon
mit dem Wundertäter, das aus'm Weerth von Disch erhalten hat. — Noch
schwerer ist es, über die betende Frau etwas sicheres zu sagen. Man hat an
Susanna, an Maria oder auch nur ganz allgemein an eine Orans gedacht39. Da
14 Vgl. zu Jonas die Zusammenstellung Garrucci tav. 174. Mehrere der dort abgebildeten
Gläser sind heute im Britischen Museum. Die Jonasbilder waren früh so sehr verbreitet,
daß man wohl eine allgemeine geschichtliche Entwicklung, in Einzelheiten auch Zusammen-
hänge zwischen benachbarten Bildern derselben Katakombe aufweisen kann, was O. Mitius
mit Geschick versucht hat, daß sich aber bisher ein orientalischer und abendländischer Typus
nicht unterscheiden läßt. Zu den Eigentümlichkeiten der jüngeren Darstellungen (vom
IV. Jahrh. ab) gehört z. B. die Ersetzung der Kürbislaube durch eine freirankende Staude.
15 So Kraus, Klinkenberg (wahrscheinlich Moses!), Leclercq, Kisa (Moses bzw. Petrus).
16 Garrucci tav. 173,1—3.
17 Garrucci tav. 173,4 (173,5 gehört nicht zu 4!).
18 Garrucci tav. 176,8—16.
19 Kraus schwankt, Dalton und Kaufmann schreiben: Orans (Susanna?) Kisa, Glas im
Abb. 3. (Narfi der Farbentafel in den B. J. 36.)