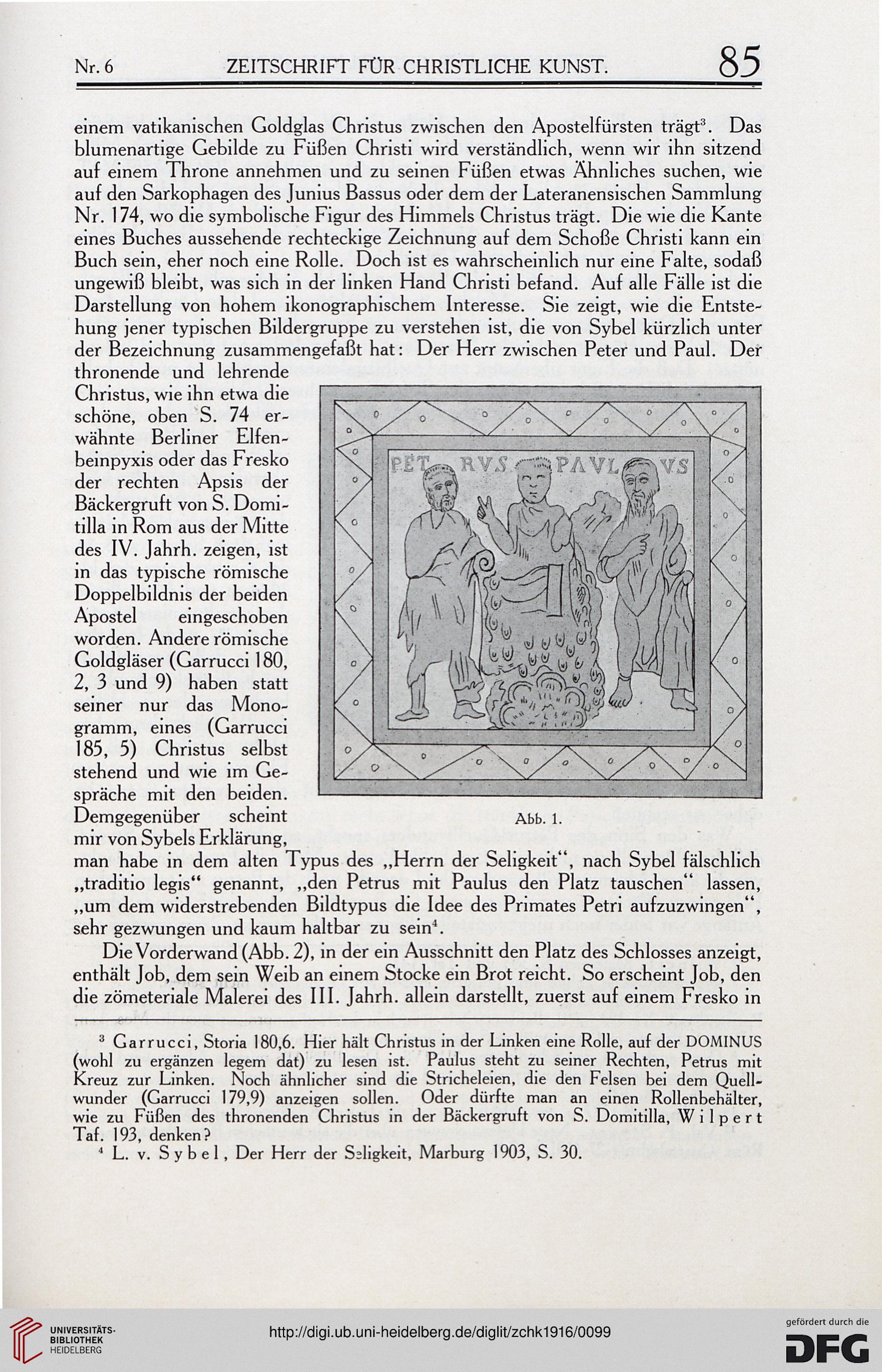Nr. 6
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
85
einem vatikanischen Goldglas Christus zwischen den Apostelfürsten trägt3. Das
blumenartige Gebilde zu Füßen Christi wird verständlich, wenn wir ihn sitzend
auf einem Throne annehmen und zu seinen Füßen etwas Ähnliches suchen, wie
auf den Sarkophagen des Junius Bassus oder dem der Lateranensischen Sammlung
Nr. 174, wo die symbolische Figur des Himmels Christus trägt. Die wie die Kante
eines Buches aussehende rechteckige Zeichnung auf dem Schöße Christi kann ein
Buch sein, eher noch eine Rolle. Doch ist es wahrscheinlich nur eine Falte, sodaß
ungewiß bleibt, was sich in der linken Hand Christi befand. Auf alle Fälle ist die
Darstellung von hohem ikonographischem Interesse. Sie zeigt, wie die Entste-
hung jener typischen Bildergruppe zu verstehen ist, die von Sybel kürzlich unter
der Bezeichnung zusammengefaßt hat: Der Herr zwischen Peter und Paul. Der
thronende und lehrende
Christus, wie ihn etwa die
schöne, oben S. 74 er-
wähnte Berliner Elfen-
beinpyxis oder das Fresko
der rechten Apsis der
Bäckergruft von S. Domi-
tilla in Rom aus der Mitte
des IV. Jahrh. zeigen, ist
in das typische römische
Doppelbildnis der beiden
Apostel eingeschoben
worden. Andere römische
Goldgläser (Garrucci 180,
2, 3 und 9) haben statt
seiner nur das Mono-
gramm, eines (Garrucci
185, 5) Christus selbst
stehend und wie im Ge-
spräche mit den beiden.
Demgegenüber scheint
mir von Sybels Erklärung,
man habe in dem alten Typus des „Herrn der Seligkeit", nach Sybel fälschlich
„traditio legis" genannt, „den Petrus mit Paulus den Platz tauschen" lassen,
„um dem widerstrebenden Bildtypus die Idee des Primates Petri aufzuzwingen",
sehr gezwungen und kaum haltbar zu sein4.
Die Vorderwand (Abb. 2), in der em Ausschnitt den Platz des Schlosses anzeigt,
enthält Job, dem sein Weib an einem Stocke ein Brot reicht. So erscheint Job, den
die zömeteriale Malerei des III. Jahrh. allein darstellt, zuerst auf einem Fresko in
Abb. 1.
3 Garrucci, Storia 180,6. Hier hält Christus in der Linken eine Rolle, auf der DOMINUS
(wohl zu ergänzen legem dat) zu lesen ist. Paulus steht zu seiner Rechten, Petrus mit
Kreuz zur Linken. Noch ähnlicher sind die Stricheleien, die den Felsen bei dem Quell-
wunder (Garrucci 179,9) anzeigen sollen. Oder dürfte man an einen Rollenbehälter,
wie zu Füßen des thronenden Christus in der Bäckergruft von S. Domitilla, W i I p e r t
Taf. 193, denken?
4 L. v. S y b e 1 , Der Herr der Seligkeit, Marburg 1903, S. 30.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
85
einem vatikanischen Goldglas Christus zwischen den Apostelfürsten trägt3. Das
blumenartige Gebilde zu Füßen Christi wird verständlich, wenn wir ihn sitzend
auf einem Throne annehmen und zu seinen Füßen etwas Ähnliches suchen, wie
auf den Sarkophagen des Junius Bassus oder dem der Lateranensischen Sammlung
Nr. 174, wo die symbolische Figur des Himmels Christus trägt. Die wie die Kante
eines Buches aussehende rechteckige Zeichnung auf dem Schöße Christi kann ein
Buch sein, eher noch eine Rolle. Doch ist es wahrscheinlich nur eine Falte, sodaß
ungewiß bleibt, was sich in der linken Hand Christi befand. Auf alle Fälle ist die
Darstellung von hohem ikonographischem Interesse. Sie zeigt, wie die Entste-
hung jener typischen Bildergruppe zu verstehen ist, die von Sybel kürzlich unter
der Bezeichnung zusammengefaßt hat: Der Herr zwischen Peter und Paul. Der
thronende und lehrende
Christus, wie ihn etwa die
schöne, oben S. 74 er-
wähnte Berliner Elfen-
beinpyxis oder das Fresko
der rechten Apsis der
Bäckergruft von S. Domi-
tilla in Rom aus der Mitte
des IV. Jahrh. zeigen, ist
in das typische römische
Doppelbildnis der beiden
Apostel eingeschoben
worden. Andere römische
Goldgläser (Garrucci 180,
2, 3 und 9) haben statt
seiner nur das Mono-
gramm, eines (Garrucci
185, 5) Christus selbst
stehend und wie im Ge-
spräche mit den beiden.
Demgegenüber scheint
mir von Sybels Erklärung,
man habe in dem alten Typus des „Herrn der Seligkeit", nach Sybel fälschlich
„traditio legis" genannt, „den Petrus mit Paulus den Platz tauschen" lassen,
„um dem widerstrebenden Bildtypus die Idee des Primates Petri aufzuzwingen",
sehr gezwungen und kaum haltbar zu sein4.
Die Vorderwand (Abb. 2), in der em Ausschnitt den Platz des Schlosses anzeigt,
enthält Job, dem sein Weib an einem Stocke ein Brot reicht. So erscheint Job, den
die zömeteriale Malerei des III. Jahrh. allein darstellt, zuerst auf einem Fresko in
Abb. 1.
3 Garrucci, Storia 180,6. Hier hält Christus in der Linken eine Rolle, auf der DOMINUS
(wohl zu ergänzen legem dat) zu lesen ist. Paulus steht zu seiner Rechten, Petrus mit
Kreuz zur Linken. Noch ähnlicher sind die Stricheleien, die den Felsen bei dem Quell-
wunder (Garrucci 179,9) anzeigen sollen. Oder dürfte man an einen Rollenbehälter,
wie zu Füßen des thronenden Christus in der Bäckergruft von S. Domitilla, W i I p e r t
Taf. 193, denken?
4 L. v. S y b e 1 , Der Herr der Seligkeit, Marburg 1903, S. 30.