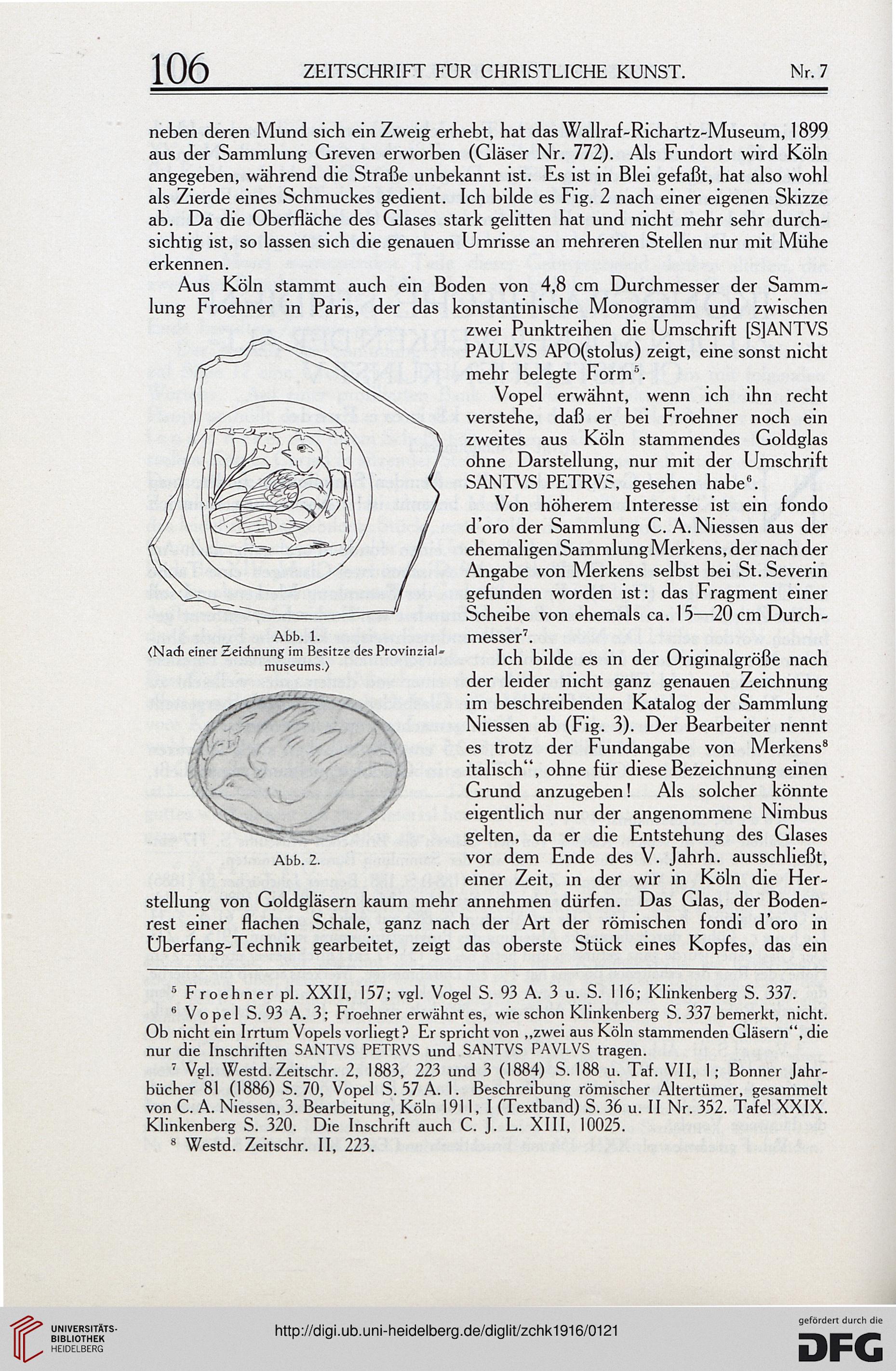106
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Mr. 7
neben deren Mund sich ein Zweig erhebt, hat das Wallraf-Richartz-Museum, 1899
aus der Sammlung Greven erworben (Gläser Nr. 772). Als Fundort wird Köln
angegeben, während die Straße unbekannt ist. Es ist in Blei gefaßt, hat also wohl
als Zierde eines Schmuckes gedient. Ich bilde es Fig. 2 nach einer eigenen Skizze
ab. Da die Oberfläche des Glases stark gelitten hat und nicht mehr sehr durch-
sichtig ist, so lassen sich die genauen Umrisse an mehreren Stellen nur mit Mühe
erkennen.
Aus Köln stammt auch ein Boden von 4,8 cm Durchmesser der Samm-
lung Froehner in Paris, der das konstantinische Monogramm und zwischen
zwei Punktreihen die Umschrift [SjANTVS
PAULVS APO(stolus) zeigt, eine sonst nicht
mehr belegte Form5.
Vopel erwähnt, wenn ich ihn recht
verstehe, daß er bei Froehner noch ein
zweites aus Köln stammendes Goldglas
ohne Darstellung, nur mit der Umschrift
SANTVS PETRV5, gesehen habe6.
Von höherem Interesse ist ein fondo
d'oro der Sammlung C. A. Niessen aus der
ehemaligen Sammlung Merkens, der nach der
Angabe von Merkens selbst bei St. Severin
gefunden worden ist: das Fragment einer
Scheibe von ehemals ca. 15—20 cm Durch-
messer7.
Ich bilde es in der Originalgröße nach
der leider nicht ganz genauen Zeichnung
im beschreibenden Katalog der Sammlung
Niessen ab (Fig. 3). Der Bearbeiter nennt
es trotz der Fundangabe von Merkens8
italisch", ohne für diese Bezeichnung einen
Abb. 1.
(Nach einer Zeichnung im Besitze des ProvinziaU
museums.)
Grund anzugeben! Als solcher könnte
eigentlich nur der angenommene Nimbus
gelten, da er die Entstehung des Glases
Abb. 2. vor dem Ende des V. Jahrh. ausschließt,
einer Zeit, in der wir in Köln die Her-
stellung von Goldgläsern kaum mehr annehmen dürfen. Das Glas, der Boden-
rest einer flachen Schale, ganz nach der Art der römischen fondi d'oro in
Uberfang-Technik gearbeitet, zeigt das oberste Stück eines Kopfes, das ein
5 Froehner pl. XXII, 157; vgl. Vogel S. 93 A. 3 u. S. 116; Klinkenberg S. 337.
6 Vopel S. 93 A. 3; Froehner erwähnt es, wie schon Klinkenberg S. 337 bemerkt, nicht.
Ob nicht ein Irrtum Vopels vorliegt ? Er spricht von „zwei aus Köln stammenden Gläsern", die
nur die Inschriften SANTVS PETRVS und SANTVS PAVLVS tragen.
7 Vgl. Westd. Zeitschr. 2, 1883, 223 und 3 (1884) S. 188 u. Taf. VII, 1 ; Bonner Jahr-
bücher 81 (1886) S. 70, Vopel S. 57 A. 1. Beschreibung römischer Altertümer, gesammelt
von C. A. Niessen, 3. Bearbeitung, Köln 1911, I (Textband) S. 36 u. II Nr. 352. Tafel XXIX.
Klinkenberg S. 320. Die Inschrift auch C. J. L. XIII, 10025.
8 Westd. Zeitschr. II, 223.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Mr. 7
neben deren Mund sich ein Zweig erhebt, hat das Wallraf-Richartz-Museum, 1899
aus der Sammlung Greven erworben (Gläser Nr. 772). Als Fundort wird Köln
angegeben, während die Straße unbekannt ist. Es ist in Blei gefaßt, hat also wohl
als Zierde eines Schmuckes gedient. Ich bilde es Fig. 2 nach einer eigenen Skizze
ab. Da die Oberfläche des Glases stark gelitten hat und nicht mehr sehr durch-
sichtig ist, so lassen sich die genauen Umrisse an mehreren Stellen nur mit Mühe
erkennen.
Aus Köln stammt auch ein Boden von 4,8 cm Durchmesser der Samm-
lung Froehner in Paris, der das konstantinische Monogramm und zwischen
zwei Punktreihen die Umschrift [SjANTVS
PAULVS APO(stolus) zeigt, eine sonst nicht
mehr belegte Form5.
Vopel erwähnt, wenn ich ihn recht
verstehe, daß er bei Froehner noch ein
zweites aus Köln stammendes Goldglas
ohne Darstellung, nur mit der Umschrift
SANTVS PETRV5, gesehen habe6.
Von höherem Interesse ist ein fondo
d'oro der Sammlung C. A. Niessen aus der
ehemaligen Sammlung Merkens, der nach der
Angabe von Merkens selbst bei St. Severin
gefunden worden ist: das Fragment einer
Scheibe von ehemals ca. 15—20 cm Durch-
messer7.
Ich bilde es in der Originalgröße nach
der leider nicht ganz genauen Zeichnung
im beschreibenden Katalog der Sammlung
Niessen ab (Fig. 3). Der Bearbeiter nennt
es trotz der Fundangabe von Merkens8
italisch", ohne für diese Bezeichnung einen
Abb. 1.
(Nach einer Zeichnung im Besitze des ProvinziaU
museums.)
Grund anzugeben! Als solcher könnte
eigentlich nur der angenommene Nimbus
gelten, da er die Entstehung des Glases
Abb. 2. vor dem Ende des V. Jahrh. ausschließt,
einer Zeit, in der wir in Köln die Her-
stellung von Goldgläsern kaum mehr annehmen dürfen. Das Glas, der Boden-
rest einer flachen Schale, ganz nach der Art der römischen fondi d'oro in
Uberfang-Technik gearbeitet, zeigt das oberste Stück eines Kopfes, das ein
5 Froehner pl. XXII, 157; vgl. Vogel S. 93 A. 3 u. S. 116; Klinkenberg S. 337.
6 Vopel S. 93 A. 3; Froehner erwähnt es, wie schon Klinkenberg S. 337 bemerkt, nicht.
Ob nicht ein Irrtum Vopels vorliegt ? Er spricht von „zwei aus Köln stammenden Gläsern", die
nur die Inschriften SANTVS PETRVS und SANTVS PAVLVS tragen.
7 Vgl. Westd. Zeitschr. 2, 1883, 223 und 3 (1884) S. 188 u. Taf. VII, 1 ; Bonner Jahr-
bücher 81 (1886) S. 70, Vopel S. 57 A. 1. Beschreibung römischer Altertümer, gesammelt
von C. A. Niessen, 3. Bearbeitung, Köln 1911, I (Textband) S. 36 u. II Nr. 352. Tafel XXIX.
Klinkenberg S. 320. Die Inschrift auch C. J. L. XIII, 10025.
8 Westd. Zeitschr. II, 223.