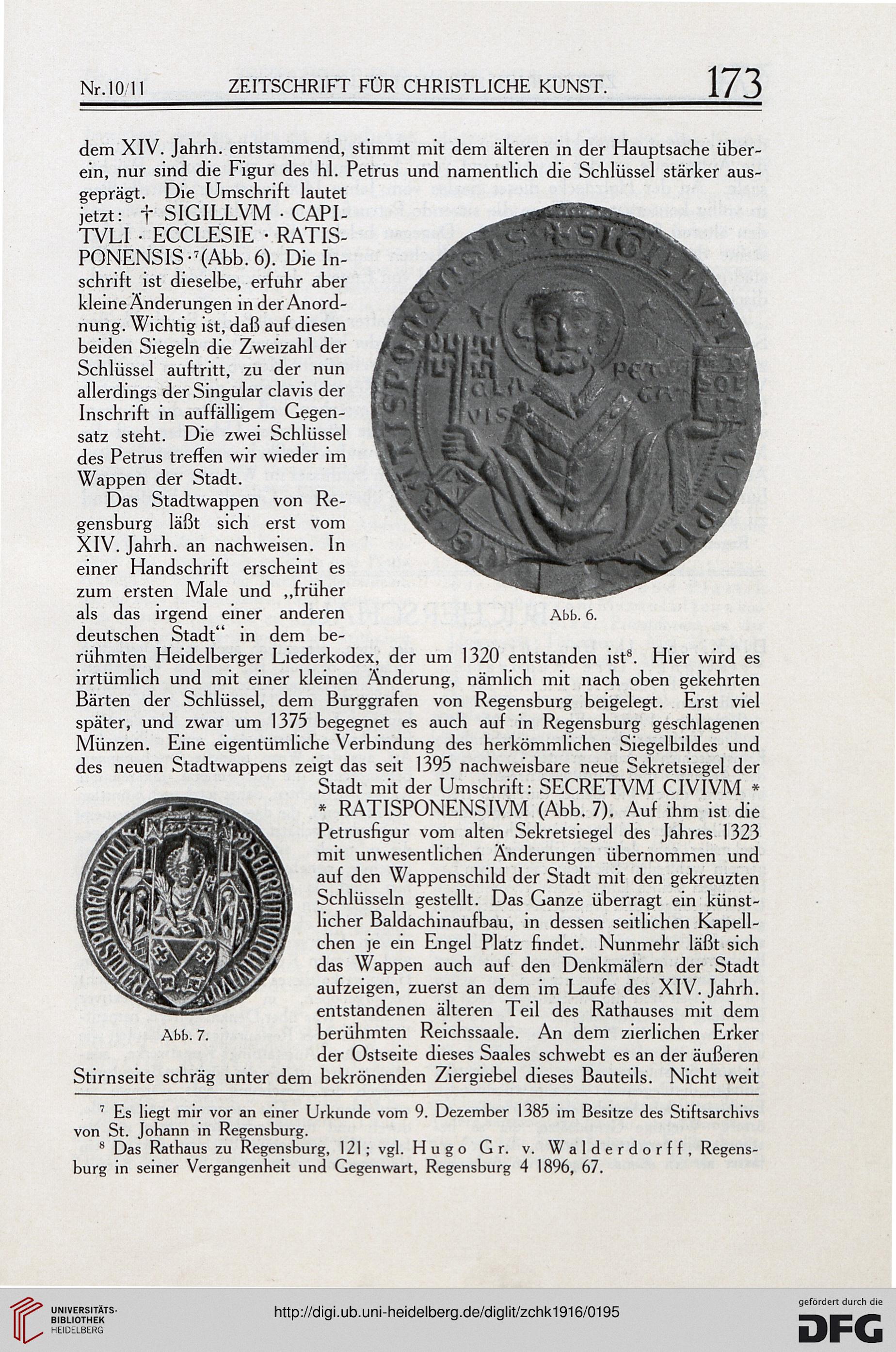Nr. 10/
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
173
dem XIV. Jahrh. entstammend, stimmt mit dem älteren in der Hauptsache über-
ein, nur sind die Figur des hl. Petrus und namentlich die Schlüssel stärker aus-
geprägt. Die Umschrift lautet
jetzt: t SIGILLVM • CAPI-
TVLI • ECCLESIE • RATIS-
PONENSIS-7(Abb.6). Die In-
schrift ist dieselbe, erfuhr aber
kleine Änderungen in der Anord-
nung. Wichtig ist, daß auf diesen
beiden Siegeln die Zweizahl der
Schlüssel auftritt, zu der nun
allerdings der Singular clavis der
Inschrift in auffälligem Gegen-
satz steht. Die zwei Schlüssel
des Petrus treffen wir wieder im
Wappen der Stadt.
Das Stadtwappen von Re-
gensburg läßt sich erst vom
XIV. Jahrh. an nachweisen. In
einer Handschrift erscheint es
zum ersten Male und „früher
als das irgend einer anderen
deutschen Stadt" in dem be-
rühmten Heidelberger Liederkodex, der um 1320 entstanden ist8. Hier wird es
irrtümlich und mit einer kleinen Änderung, nämlich mit nach oben gekehrten
Barten der Schlüssel, dem Burggrafen von Regensburg beigelegt. Erst viel
später, und zwar um 1375 begegnet es auch auf in Regensburg geschlagenen
Münzen. Eine eigentümliche Verbindung des herkömmlichen Siegelbildes und
des neuen Stadtwappens zeigt das seit 1395 nachweisbare neue Sekretsiegel der
Stadt mit der Umschrift: SECRETVM CIVIVM *
* RATISPONENSIVM (Abb. 7). Auf ihm ist die
Petrusfigur vom alten Sekretsiegel des Jahres 1323
mit unwesentlichen Änderungen übernommen und
auf den Wappenschild der Stadt mit den gekreuzten
Schlüsseln gestellt. Das Ganze überragt ein künst-
licher Baldachinaufbau, in dessen seitlichen Kapell-
chen je ein Engel Platz findet. Nunmehr läßt sich
das Wappen auch auf den Denkmälern der Stadt
aufzeigen, zuerst an dem im Laufe des XIV. Jahrh.
entstandenen älteren Teil des Rathauses mit dem
berühmten Reichssaale. An dem zierlichen Erker
der Ostseite dieses Saales schwebt es an der äußeren
Stirnseite schräg unter dem bekrönenden Ziergiebel dieses Bauteils. Nicht weit
Abb. 6.
Abb. 7.
7 Es liegt mir vor an einer Urkunde vom 9. Dezember 1385 im Besitze des Stiftsarchivs
von St. Johann in Regensburg.
8 Das Rathaus zu Regensburg, 121; vgl. Hugo Gr. v. Walderdorff, Regens-
burg in seiner Vergangenheit und Gegenwart, Regensburg 4 1896, 67.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
173
dem XIV. Jahrh. entstammend, stimmt mit dem älteren in der Hauptsache über-
ein, nur sind die Figur des hl. Petrus und namentlich die Schlüssel stärker aus-
geprägt. Die Umschrift lautet
jetzt: t SIGILLVM • CAPI-
TVLI • ECCLESIE • RATIS-
PONENSIS-7(Abb.6). Die In-
schrift ist dieselbe, erfuhr aber
kleine Änderungen in der Anord-
nung. Wichtig ist, daß auf diesen
beiden Siegeln die Zweizahl der
Schlüssel auftritt, zu der nun
allerdings der Singular clavis der
Inschrift in auffälligem Gegen-
satz steht. Die zwei Schlüssel
des Petrus treffen wir wieder im
Wappen der Stadt.
Das Stadtwappen von Re-
gensburg läßt sich erst vom
XIV. Jahrh. an nachweisen. In
einer Handschrift erscheint es
zum ersten Male und „früher
als das irgend einer anderen
deutschen Stadt" in dem be-
rühmten Heidelberger Liederkodex, der um 1320 entstanden ist8. Hier wird es
irrtümlich und mit einer kleinen Änderung, nämlich mit nach oben gekehrten
Barten der Schlüssel, dem Burggrafen von Regensburg beigelegt. Erst viel
später, und zwar um 1375 begegnet es auch auf in Regensburg geschlagenen
Münzen. Eine eigentümliche Verbindung des herkömmlichen Siegelbildes und
des neuen Stadtwappens zeigt das seit 1395 nachweisbare neue Sekretsiegel der
Stadt mit der Umschrift: SECRETVM CIVIVM *
* RATISPONENSIVM (Abb. 7). Auf ihm ist die
Petrusfigur vom alten Sekretsiegel des Jahres 1323
mit unwesentlichen Änderungen übernommen und
auf den Wappenschild der Stadt mit den gekreuzten
Schlüsseln gestellt. Das Ganze überragt ein künst-
licher Baldachinaufbau, in dessen seitlichen Kapell-
chen je ein Engel Platz findet. Nunmehr läßt sich
das Wappen auch auf den Denkmälern der Stadt
aufzeigen, zuerst an dem im Laufe des XIV. Jahrh.
entstandenen älteren Teil des Rathauses mit dem
berühmten Reichssaale. An dem zierlichen Erker
der Ostseite dieses Saales schwebt es an der äußeren
Stirnseite schräg unter dem bekrönenden Ziergiebel dieses Bauteils. Nicht weit
Abb. 6.
Abb. 7.
7 Es liegt mir vor an einer Urkunde vom 9. Dezember 1385 im Besitze des Stiftsarchivs
von St. Johann in Regensburg.
8 Das Rathaus zu Regensburg, 121; vgl. Hugo Gr. v. Walderdorff, Regens-
burg in seiner Vergangenheit und Gegenwart, Regensburg 4 1896, 67.