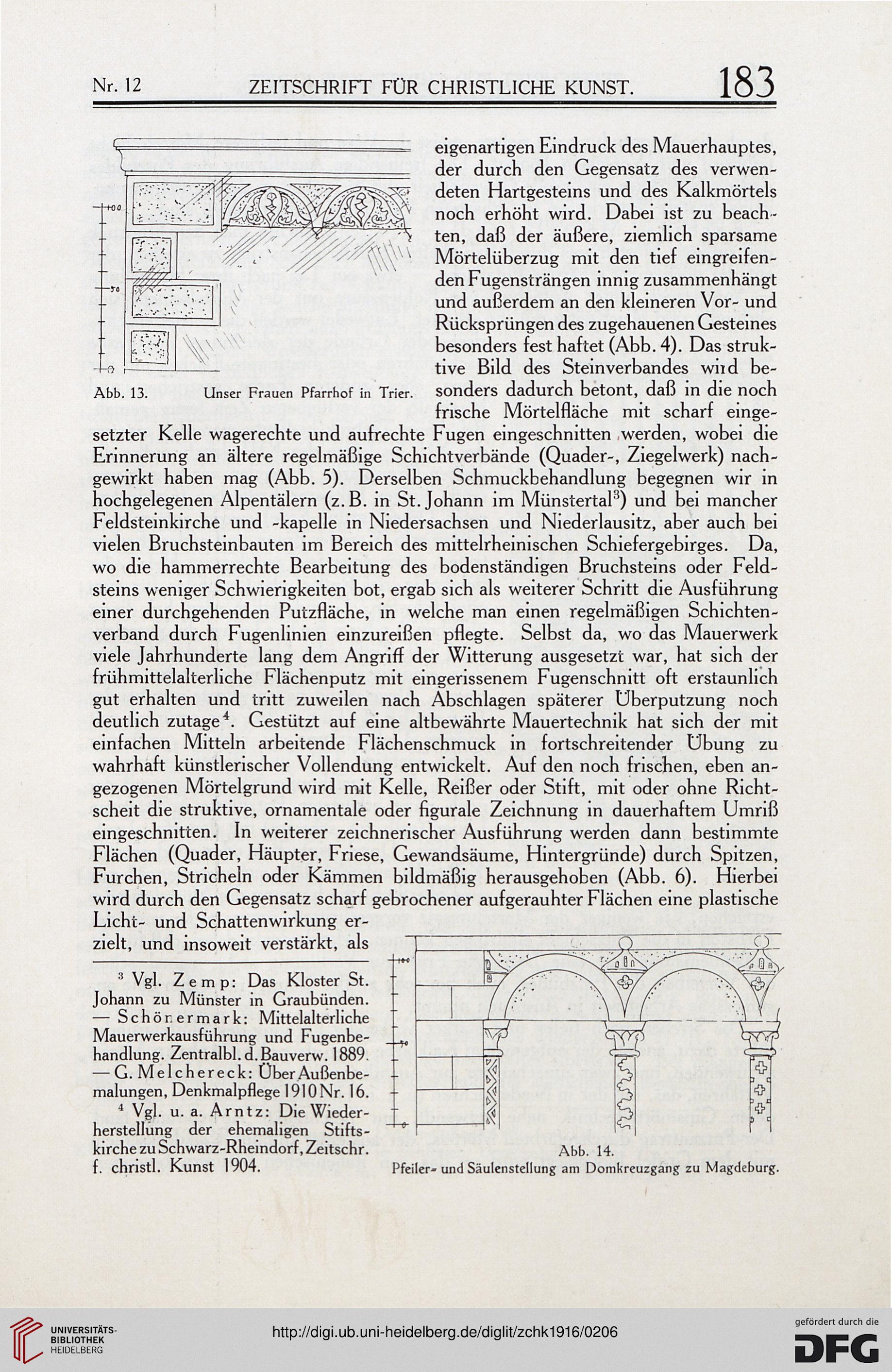Nr. 12
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
183
Abb. 13.
Unser Frauen Pfarrhof in Trier.
eigenartigen Eindruck des Mauerhauptes,
der durch den Gegensatz des verwen-
deten Hartgesteins und des Kalkmörtels
noch erhöht wird. Dabei ist zu beach-
ten, daß der äußere, ziemlich sparsame
Mörtelüberzug mit den tief eingreifen-
den Fugensträngen innig zusammenhängt
und außerdem an den kleineren Vor- und
Rücksprüngen des zugehauenen Gesteines
besonders fest haftet (Abb. 4). Das struk-
tive Bild des Steinverbandes wird be-
sonders dadurch betont, daß in die noch
frische Mörtelfläche mit scharf einge-
setzter Kelle wagerechte und aufrechte Fugen eingeschnitten werden, wobei die
Erinnerung an ältere regelmäßige Schichtverbände (Quader-, Ziegelwerk) nach-
gewirkt haben mag (Abb. 5). Derselben Schmuckbehandlung begegnen wir in
hochgelegenen Alpentälern (z.B. in St.Johann im Münstertal3) und bei mancher
Feldsteinkirche und -kapeile in Niedersachsen und Niederlausitz, aber auch bei
vielen Bruchsteinbauten im Bereich des mittelrheinischen Schiefergebirges. Da,
wo die hammerrechte Bearbeitung des bodenständigen Bruchsteins oder Feld-
steins weniger Schwierigkeiten bot, ergab sich als weiterer Schritt die Ausführung
einer durchgehenden Putzfläche, in welche man einen regelmäßigen Schichten-
verband durch Fugenlinien einzureißen pflegte. Selbst da, wo das Mauerwerk
viele Jahrhunderte lang dem Angriff der Witterung ausgesetzt war, hat sich der
frühmittelalterliche Flächenputz mit eingerissenem Fugenschnitt oft erstaunlich
gut erhalten und tritt zuweilen nach Abschlagen späterer Uberputzung noch
deutlich zutage4. Gestützt auf eine altbewährte Mauertechnik hat sich der mit
einfachen Mitteln arbeitende Flächenschmuck in fortschreitender Übung zu
wahrhaft künstlerischer Vollendung entwickelt. Auf den noch frischen, eben an-
gezogenen Mörtelgrund wird mit Kelle, Reißer oder Stift, mit oder ohne Richt-
scheit die struktive, ornamentale oder figurale Zeichnung in dauerhaftem Umriß
eingeschnitten. In weiterer zeichnerischer Ausführung werden dann bestimmte
Flächen (Quader, Häupter, Friese, Gewandsäume, Hintergründe) durch Spitzen,
Furchen, Stricheln oder Kämmen bildmäßig herausgehoben (Abb. 6). Hierbei
wird durch den Gegensatz scharf gebrochener aufgerauhter Flächen eine plastische
Licht- und Schattenwirkung er-
zielt, und insoweit verstärkt, als
;! Vgl. Z e m p: Das Kloster St.
Johann zu Münster in Graubünden.
— Schön ermark: Mittelalterliche
Mauerwerkausführung und Fugenbe-
handlung. Zentralbl.d.Bauverw. 1889.
— G.Melchereck: ÜberAußenbe-
malungen, Denkmalpflege 1910 Nr. 16.
4 Vgl. u. a. Arntz: Die Wieder-
herstellung der ehemaligen Stifts-
kirche zu Schwarz-Rheindorf, Zeitschr.
f. christl. Kunst 1904.
Abb. 14.
Pfeiler- und Säulenstellung am Domkreuzgang zu Magdeburg.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
183
Abb. 13.
Unser Frauen Pfarrhof in Trier.
eigenartigen Eindruck des Mauerhauptes,
der durch den Gegensatz des verwen-
deten Hartgesteins und des Kalkmörtels
noch erhöht wird. Dabei ist zu beach-
ten, daß der äußere, ziemlich sparsame
Mörtelüberzug mit den tief eingreifen-
den Fugensträngen innig zusammenhängt
und außerdem an den kleineren Vor- und
Rücksprüngen des zugehauenen Gesteines
besonders fest haftet (Abb. 4). Das struk-
tive Bild des Steinverbandes wird be-
sonders dadurch betont, daß in die noch
frische Mörtelfläche mit scharf einge-
setzter Kelle wagerechte und aufrechte Fugen eingeschnitten werden, wobei die
Erinnerung an ältere regelmäßige Schichtverbände (Quader-, Ziegelwerk) nach-
gewirkt haben mag (Abb. 5). Derselben Schmuckbehandlung begegnen wir in
hochgelegenen Alpentälern (z.B. in St.Johann im Münstertal3) und bei mancher
Feldsteinkirche und -kapeile in Niedersachsen und Niederlausitz, aber auch bei
vielen Bruchsteinbauten im Bereich des mittelrheinischen Schiefergebirges. Da,
wo die hammerrechte Bearbeitung des bodenständigen Bruchsteins oder Feld-
steins weniger Schwierigkeiten bot, ergab sich als weiterer Schritt die Ausführung
einer durchgehenden Putzfläche, in welche man einen regelmäßigen Schichten-
verband durch Fugenlinien einzureißen pflegte. Selbst da, wo das Mauerwerk
viele Jahrhunderte lang dem Angriff der Witterung ausgesetzt war, hat sich der
frühmittelalterliche Flächenputz mit eingerissenem Fugenschnitt oft erstaunlich
gut erhalten und tritt zuweilen nach Abschlagen späterer Uberputzung noch
deutlich zutage4. Gestützt auf eine altbewährte Mauertechnik hat sich der mit
einfachen Mitteln arbeitende Flächenschmuck in fortschreitender Übung zu
wahrhaft künstlerischer Vollendung entwickelt. Auf den noch frischen, eben an-
gezogenen Mörtelgrund wird mit Kelle, Reißer oder Stift, mit oder ohne Richt-
scheit die struktive, ornamentale oder figurale Zeichnung in dauerhaftem Umriß
eingeschnitten. In weiterer zeichnerischer Ausführung werden dann bestimmte
Flächen (Quader, Häupter, Friese, Gewandsäume, Hintergründe) durch Spitzen,
Furchen, Stricheln oder Kämmen bildmäßig herausgehoben (Abb. 6). Hierbei
wird durch den Gegensatz scharf gebrochener aufgerauhter Flächen eine plastische
Licht- und Schattenwirkung er-
zielt, und insoweit verstärkt, als
;! Vgl. Z e m p: Das Kloster St.
Johann zu Münster in Graubünden.
— Schön ermark: Mittelalterliche
Mauerwerkausführung und Fugenbe-
handlung. Zentralbl.d.Bauverw. 1889.
— G.Melchereck: ÜberAußenbe-
malungen, Denkmalpflege 1910 Nr. 16.
4 Vgl. u. a. Arntz: Die Wieder-
herstellung der ehemaligen Stifts-
kirche zu Schwarz-Rheindorf, Zeitschr.
f. christl. Kunst 1904.
Abb. 14.
Pfeiler- und Säulenstellung am Domkreuzgang zu Magdeburg.