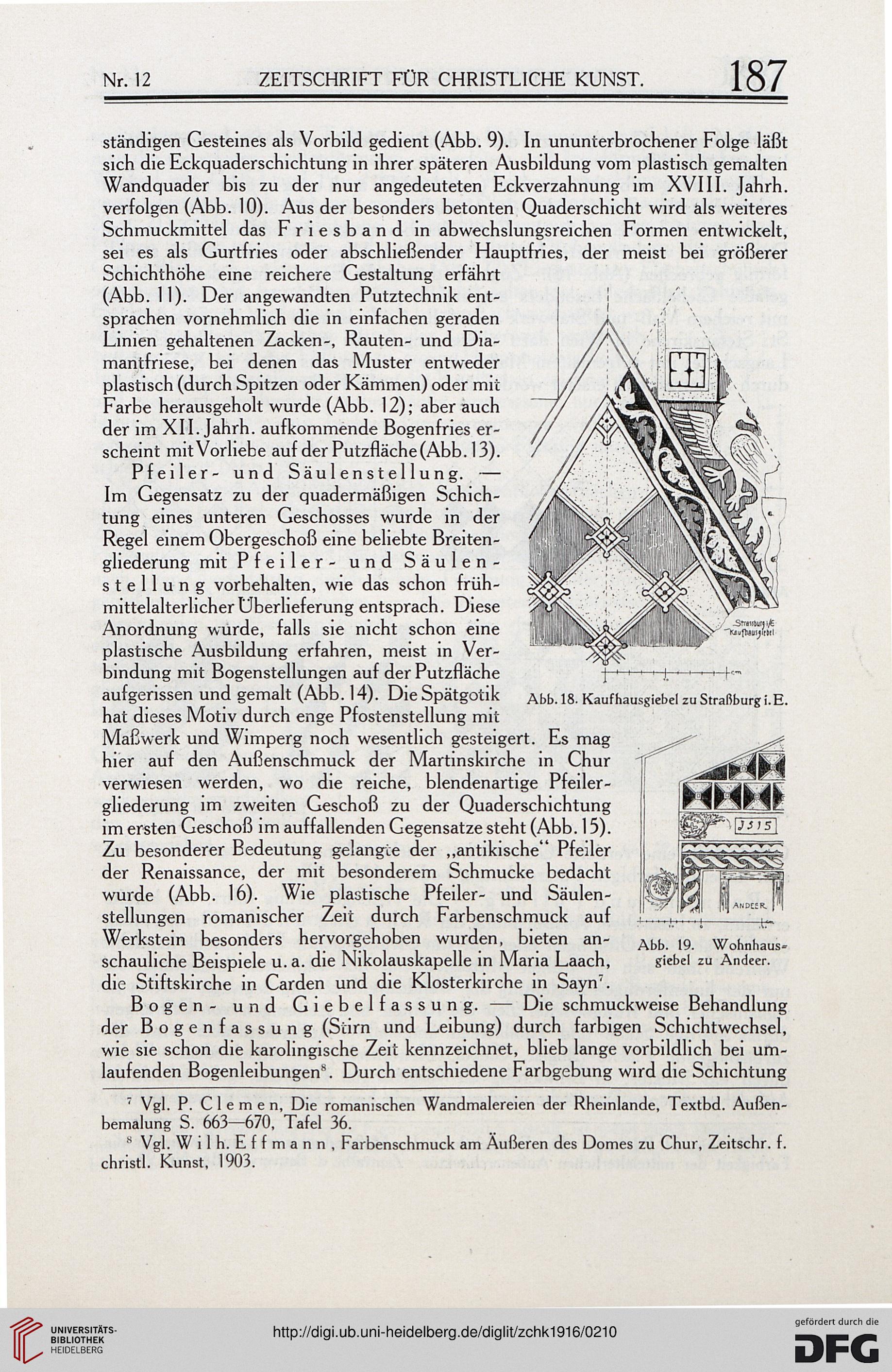Nr. 12
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
187
ständigen Gesteines als Vorbild gedient (Abb. 9). In ununterbrochener Folge läßt
sich die Eckquaderschichtung in ihrer späteren Ausbildung vom plastisch gemalten
Wandquader bis zu der nur angedeuteten Eckverzahnung im XVIII. Jahrh.
verfolgen (Abb. 10). Aus der besonders betonten Quaderschicht wird als weiteres
Schmuckmittel das Friesband in abwechslungsreichen Formen entwickelt,
sei es als Gurtfries oder abschließender Hauptfries, der meist bei größerer
Schichthöhe eine reichere Gestaltung erfährt
(Abb. 11). Der angewandten Putztechnik ent-
sprachen vornehmlich die in einfachen geraden
Linien gehaltenen Zacken-, Rauten- und Dia-
mantfriese, bei denen das Muster entweder
plastisch (durch Spitzen oder Kämmen) oder mit
Farbe herausgeholt wurde (Abb. 12); aber auch
der im XII. Jahrh. aufkommende Bogenfries er-
scheint mit Vorliebe auf der Putzfläche (Abb. 13).
Pfeiler- und Säulenstellung. —
Im Gegensatz zu der quadermäßigen Schich-
tung eines unteren Geschosses wurde in der
Regel einem Obergeschoß eine behebte Breiten-
gliederung mit Pfeiler- und Säulen-
stellung vorbehalten, wie das schon früh-
mittelalterlicher Überlieferung entsprach. Diese
Anordnung wurde, falls sie nicht schon eine
plastische Ausbildung erfahren, meist in Ver-
bindung mit Bogenstellungen auf der Putzfläche
aufgerissen und gemalt (Abb. 14). Die Spätgotik
hat dieses Motiv durch enge Pfostenstellung mit
Maßwerk und Wimperg noch wesentlich gesteigert. Es mag
hier auf den Außenschmuck der Martinskirche in Chur
verwiesen werden, wo die reiche, blendenartige Pfeiler-
gliederung im zweiten Geschoß zu der Quaderschichtung
im ersten Geschoß im auffallenden Gegensatze steht (Abb. 15).
Zu besonderer Bedeutung gelangte der „antikische" Pfeiler
der Renaissance, der mit besonderem Schmucke bedacht
wurde (Abb. 16). Wie plastische Pfeiler- und Säulen-
stellungen romanischer Zeit durch Farbenschmuck auf
Werkstein besonders hervorgehoben wurden, bieten an-
schauliche Beispiele u.a. die Nikolauskapelle in Maria Laach,
die Stiftskirche in Carden und die Klosterkirche in Sayn7.
Bogen- und Giebelfassung. — Die schmuckweise Behandlung
der Bogenfassung (Stirn und Leibung) durch farbigen Schichtwechsel,
wie sie schon die karolingische Zeit kennzeichnet, blieb lange vorbildlich bei um-
laufenden Bogenleibungen8. Durch entschiedene Farbgebung wird die Schichtung
7 Vgl. P. C 1 e m e n, Die romanischen Wandmalereien der Rheinlande, Textbd. Außen-
bemalung S. 663—670, Tafel 36.
8 Vgl. Wilh. Effmann, Farbenschmuck am Äußeren des Domes zu Chur, Zeitschr. f.
christl. Kunst, 1903.
Abb. 18. Kauf hausgiebel zu Straßburg i.E.
Abb. 19. Wohnhaus»
giebel zu Andeer.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
187
ständigen Gesteines als Vorbild gedient (Abb. 9). In ununterbrochener Folge läßt
sich die Eckquaderschichtung in ihrer späteren Ausbildung vom plastisch gemalten
Wandquader bis zu der nur angedeuteten Eckverzahnung im XVIII. Jahrh.
verfolgen (Abb. 10). Aus der besonders betonten Quaderschicht wird als weiteres
Schmuckmittel das Friesband in abwechslungsreichen Formen entwickelt,
sei es als Gurtfries oder abschließender Hauptfries, der meist bei größerer
Schichthöhe eine reichere Gestaltung erfährt
(Abb. 11). Der angewandten Putztechnik ent-
sprachen vornehmlich die in einfachen geraden
Linien gehaltenen Zacken-, Rauten- und Dia-
mantfriese, bei denen das Muster entweder
plastisch (durch Spitzen oder Kämmen) oder mit
Farbe herausgeholt wurde (Abb. 12); aber auch
der im XII. Jahrh. aufkommende Bogenfries er-
scheint mit Vorliebe auf der Putzfläche (Abb. 13).
Pfeiler- und Säulenstellung. —
Im Gegensatz zu der quadermäßigen Schich-
tung eines unteren Geschosses wurde in der
Regel einem Obergeschoß eine behebte Breiten-
gliederung mit Pfeiler- und Säulen-
stellung vorbehalten, wie das schon früh-
mittelalterlicher Überlieferung entsprach. Diese
Anordnung wurde, falls sie nicht schon eine
plastische Ausbildung erfahren, meist in Ver-
bindung mit Bogenstellungen auf der Putzfläche
aufgerissen und gemalt (Abb. 14). Die Spätgotik
hat dieses Motiv durch enge Pfostenstellung mit
Maßwerk und Wimperg noch wesentlich gesteigert. Es mag
hier auf den Außenschmuck der Martinskirche in Chur
verwiesen werden, wo die reiche, blendenartige Pfeiler-
gliederung im zweiten Geschoß zu der Quaderschichtung
im ersten Geschoß im auffallenden Gegensatze steht (Abb. 15).
Zu besonderer Bedeutung gelangte der „antikische" Pfeiler
der Renaissance, der mit besonderem Schmucke bedacht
wurde (Abb. 16). Wie plastische Pfeiler- und Säulen-
stellungen romanischer Zeit durch Farbenschmuck auf
Werkstein besonders hervorgehoben wurden, bieten an-
schauliche Beispiele u.a. die Nikolauskapelle in Maria Laach,
die Stiftskirche in Carden und die Klosterkirche in Sayn7.
Bogen- und Giebelfassung. — Die schmuckweise Behandlung
der Bogenfassung (Stirn und Leibung) durch farbigen Schichtwechsel,
wie sie schon die karolingische Zeit kennzeichnet, blieb lange vorbildlich bei um-
laufenden Bogenleibungen8. Durch entschiedene Farbgebung wird die Schichtung
7 Vgl. P. C 1 e m e n, Die romanischen Wandmalereien der Rheinlande, Textbd. Außen-
bemalung S. 663—670, Tafel 36.
8 Vgl. Wilh. Effmann, Farbenschmuck am Äußeren des Domes zu Chur, Zeitschr. f.
christl. Kunst, 1903.
Abb. 18. Kauf hausgiebel zu Straßburg i.E.
Abb. 19. Wohnhaus»
giebel zu Andeer.