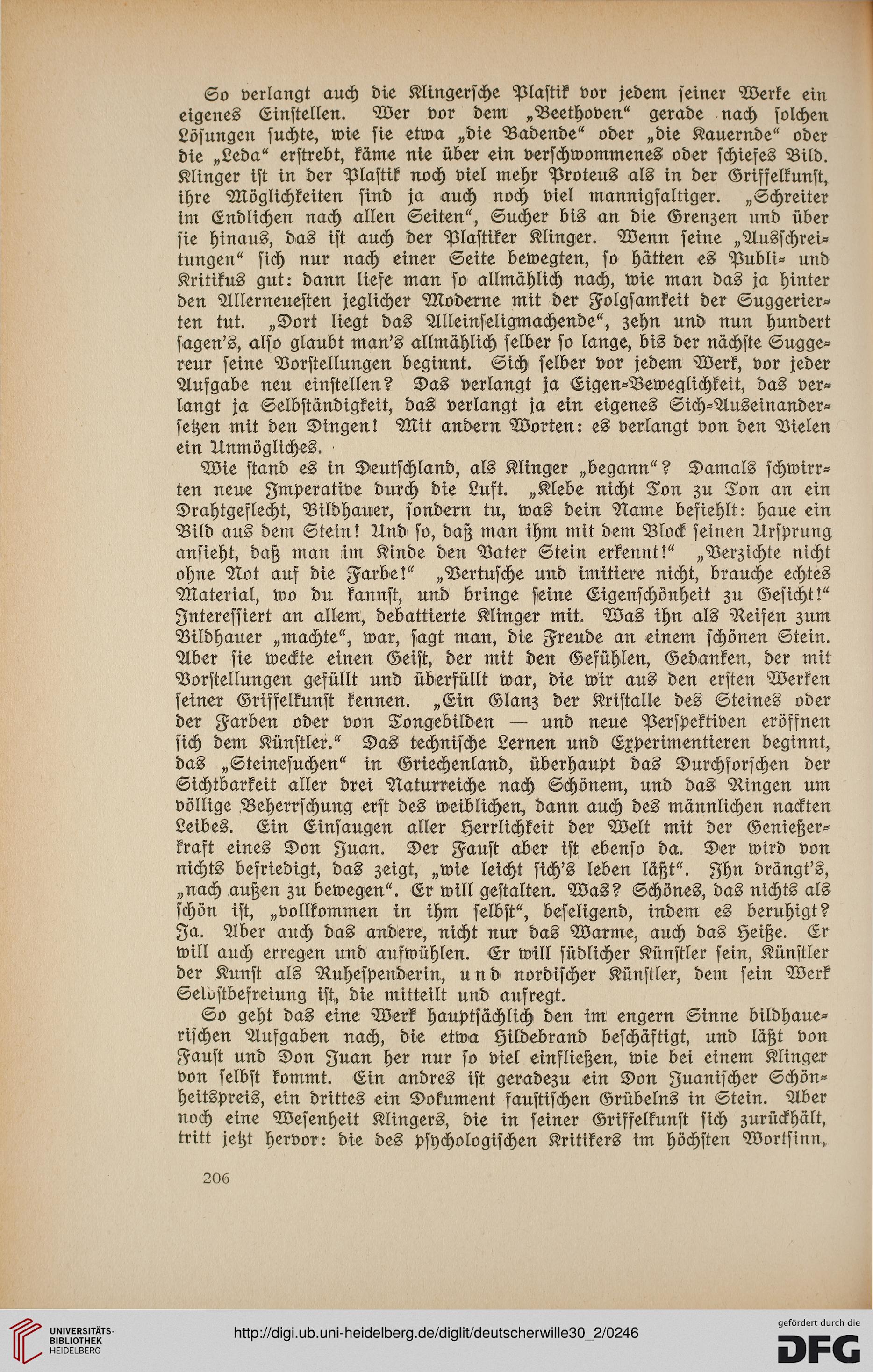So verlangt auch dre Klingersche Plastik vor jedem seiner Werke ein
eigenes (Linstellen. Wer vor dem „Beethoven" gerade nach solchen
Lösungen suchte, wie sie etwa „die Badende" oder „die Kauernde" oder
die „Leda" erstrebt, kame nie über ein verschwommenes oder schiefes Bild.
Klinger ist in der Plastik noch viel mehr Proteus als in der Griffelkunst,
ihre Möglichkeiten sind ja auch noch viel mannigfaltiger. „Schreiter
im Lndlichen nach allen Seiten", Sucher bis an die Grenzen und über
sie hinaus, das ist auch der Plastiker Klinger. Wenn seine „Ausschrei-
tungen" sich nur nach einer Seite bewegten, so hatten es Publi- und
Kritikus gut: dann liefe man so allmahlich nach, wie man das ja hinter
den Allerneuesten jeglicher Moderne mit der Folgsamkeit der Suggerier-
ten tut. „Dort liegt das Alleinseligmachende", zehn und nun hundert
sagen's, also glaubt man's allmahlich selber so lange, bis der nächste Sugge«
reur seine Vorstellungen beginnt. Sich selber vor jedem Werk, vor jeder
Ausgabe neu einstellen? Das verlangt ja Eigen-Beweglichkeit, das ver--
langt ja Selbständigkeit, das verlangt ja ein eigenes Sich-Auseinander«
setzen mit den Dingen! Mit andern Worten: es verlangt von den Vielen
ein Unmögliches.
Wie stand es in Deutschland, als Klinger „begann"? Damals schwirr-
ten neue Imperative durch die Luft. „Klebe nicht Ton zu Ton an ein
Drahtgeflecht, Bildhauer, sondern tu, was dein Äame befiehlt: haue ein
Bild aus dem Stein! Uüd so, daß man ihm mit dem Block seinen Ursprung
ansieht, daß man >im Kinde den Vater Stein erkennt!^ „Verzichte nicht
ohne Not auf die Farbe!" „Vertusche und imitiere nicht, brauche echtes
Material, wo du kannst, und bringe seine Eigenschönheit zu Gesicht!"
Interessiert an allem, debaLtierte Klinger mit. Was ihn als Reifen zum
Bildhauer „machte", war, sagt man, die Freude an einem schönen SLein.
Aber sie weckte einen Geist, der mit den Gefühlen, Gedanken, der mit
Vorstellungen gefüllt und überfüllt war, die wir aus den ersten Werken
seiner Griffelkunst kennen. „Ein Glanz der Kristalle des SLeines oder
der Farben oder von Tongebilden — und neue Perspektiven eröffnen
sich dem Künstler/ Das technische Lernen und Experimentieren beginnt,
das „Steinesuchen" in Griechenland, überhaupt das Durchforschen der
Sichtbarkeit aller drei Naturreiche nach Schönem, und das Ringen um
völlige Beherrschung erst des weiblichen, dann auch des männlichen nackten
Leibes. Ein Linsaugen aller tzerrlichkeit der Welt mit der Genießer-
kraft eines Don Iuan. Der Faust aber ist ebenso da. Der wird von
nichts befriedigt, das zeigt, „wie leicht sich's leben läßt^. Ihn drängt's,
„nach außen zu bewegen". Er will gestalten. Was? Schönes, das nichts als
schön ist, „vollkommen in ihm selbst", beseligend, indem es beruhigt?
Ia. Aber auch das andere, nicht nur das Warme, auch das tzeiße. Er
will auch erregen und aufwühlen. Er wrll südlicher Künstler sein, Künstler
der Kunst als Ruhespenderin, u nd nordischer Künstler, dem sein Werk
Selustbefreiung ist, die mitteilt und aufregl.
So geht das eine Werk hauptsächlich den im engern Sinne bildhaue-
rischen Aufgaben nach, die etwa tzildebrand beschäftigt, und läßt von
Faust und Don Iuan her nur so viel einfließen, wie bei einem Klinger
von selbst kommt. Ein andres ist geradezu ein Don Iuanischer Schön«
Heitspreis) ein drittes ein Dokument faustischen Grübelns in Stein. Aber
noch eine Wesenheit Klingers, die in seiner Griffelkunst sich zurückhält,
tritt jetzt hervor: die des psychologischen Kritikers im höchsten Wortsinn,
206
eigenes (Linstellen. Wer vor dem „Beethoven" gerade nach solchen
Lösungen suchte, wie sie etwa „die Badende" oder „die Kauernde" oder
die „Leda" erstrebt, kame nie über ein verschwommenes oder schiefes Bild.
Klinger ist in der Plastik noch viel mehr Proteus als in der Griffelkunst,
ihre Möglichkeiten sind ja auch noch viel mannigfaltiger. „Schreiter
im Lndlichen nach allen Seiten", Sucher bis an die Grenzen und über
sie hinaus, das ist auch der Plastiker Klinger. Wenn seine „Ausschrei-
tungen" sich nur nach einer Seite bewegten, so hatten es Publi- und
Kritikus gut: dann liefe man so allmahlich nach, wie man das ja hinter
den Allerneuesten jeglicher Moderne mit der Folgsamkeit der Suggerier-
ten tut. „Dort liegt das Alleinseligmachende", zehn und nun hundert
sagen's, also glaubt man's allmahlich selber so lange, bis der nächste Sugge«
reur seine Vorstellungen beginnt. Sich selber vor jedem Werk, vor jeder
Ausgabe neu einstellen? Das verlangt ja Eigen-Beweglichkeit, das ver--
langt ja Selbständigkeit, das verlangt ja ein eigenes Sich-Auseinander«
setzen mit den Dingen! Mit andern Worten: es verlangt von den Vielen
ein Unmögliches.
Wie stand es in Deutschland, als Klinger „begann"? Damals schwirr-
ten neue Imperative durch die Luft. „Klebe nicht Ton zu Ton an ein
Drahtgeflecht, Bildhauer, sondern tu, was dein Äame befiehlt: haue ein
Bild aus dem Stein! Uüd so, daß man ihm mit dem Block seinen Ursprung
ansieht, daß man >im Kinde den Vater Stein erkennt!^ „Verzichte nicht
ohne Not auf die Farbe!" „Vertusche und imitiere nicht, brauche echtes
Material, wo du kannst, und bringe seine Eigenschönheit zu Gesicht!"
Interessiert an allem, debaLtierte Klinger mit. Was ihn als Reifen zum
Bildhauer „machte", war, sagt man, die Freude an einem schönen SLein.
Aber sie weckte einen Geist, der mit den Gefühlen, Gedanken, der mit
Vorstellungen gefüllt und überfüllt war, die wir aus den ersten Werken
seiner Griffelkunst kennen. „Ein Glanz der Kristalle des SLeines oder
der Farben oder von Tongebilden — und neue Perspektiven eröffnen
sich dem Künstler/ Das technische Lernen und Experimentieren beginnt,
das „Steinesuchen" in Griechenland, überhaupt das Durchforschen der
Sichtbarkeit aller drei Naturreiche nach Schönem, und das Ringen um
völlige Beherrschung erst des weiblichen, dann auch des männlichen nackten
Leibes. Ein Linsaugen aller tzerrlichkeit der Welt mit der Genießer-
kraft eines Don Iuan. Der Faust aber ist ebenso da. Der wird von
nichts befriedigt, das zeigt, „wie leicht sich's leben läßt^. Ihn drängt's,
„nach außen zu bewegen". Er will gestalten. Was? Schönes, das nichts als
schön ist, „vollkommen in ihm selbst", beseligend, indem es beruhigt?
Ia. Aber auch das andere, nicht nur das Warme, auch das tzeiße. Er
will auch erregen und aufwühlen. Er wrll südlicher Künstler sein, Künstler
der Kunst als Ruhespenderin, u nd nordischer Künstler, dem sein Werk
Selustbefreiung ist, die mitteilt und aufregl.
So geht das eine Werk hauptsächlich den im engern Sinne bildhaue-
rischen Aufgaben nach, die etwa tzildebrand beschäftigt, und läßt von
Faust und Don Iuan her nur so viel einfließen, wie bei einem Klinger
von selbst kommt. Ein andres ist geradezu ein Don Iuanischer Schön«
Heitspreis) ein drittes ein Dokument faustischen Grübelns in Stein. Aber
noch eine Wesenheit Klingers, die in seiner Griffelkunst sich zurückhält,
tritt jetzt hervor: die des psychologischen Kritikers im höchsten Wortsinn,
206