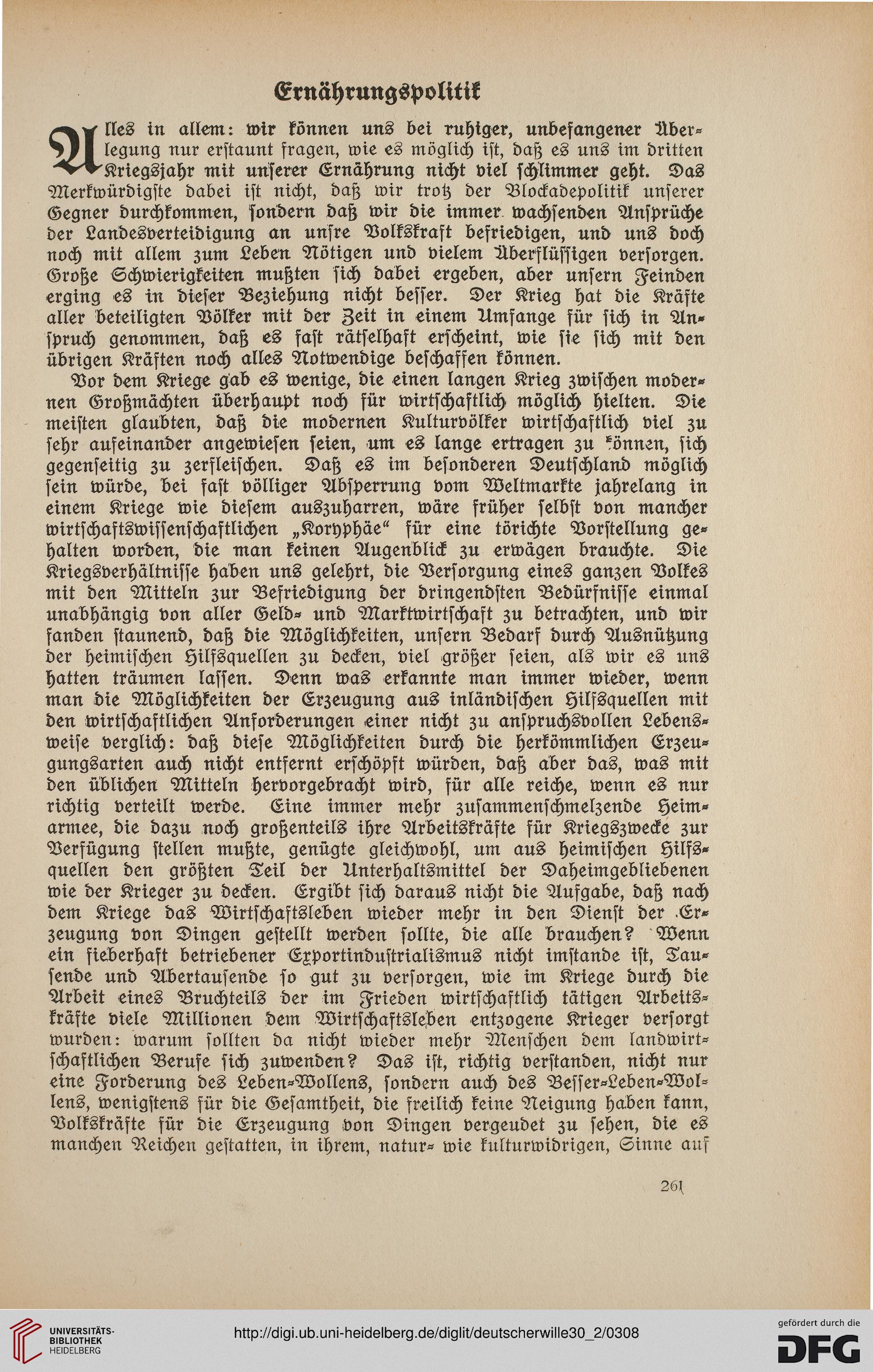Ernährrmgspolitik
lles in allem: wir können uns bei ruhiger, unbefangener Aber«
legung nur erstaunt fragen, wie es möglich ist, daß es uns im dritten
^v^Kriegsjahr mit unserer Ernahrung nicht viel schlimmer geht. Das
Merkwürdigste dabei ist nicht, daß wir trotz der Blockadepolitik unserer
Gegner durchkommen, sondern dah wir die immer wachsenden Ansprüche
der Landesverteidigung an unsre Volkskraft befriedigen, und uns doch
noch mit allem zum Leben Nötigen und vielem Aberflüssigen versorgen.
Große Schwierigkeiten mußten sich dabei ergeben, aber unsern Feinden
erging es in dieser Beziehung nicht besser. Der Krieg hat die Kräfte
aller beteiligten Völker mit der Zeit in einem Umfange für sich in An-
spruch genommen, daß es fast ratselhaft erscheint, wie sie sich mit den
übrigen Kräften noch alles Notwendige beschaffen können.
Vor dem Kriege gab es wenige, die einen langen Krieg zwischen moder-
nen Großmächten überhaupt noch für wirtschaftlich möglich hielten. Die
meisten gtaübten, daß die modernen Kulturvölker wirtschaftlich viel zu
sehr aufeinaüder angewiesen seien, um es lange ertragen zu ^önnen, sich
gegenseitig zu zerfleischen. Daß es im besonderen Deutschland möglich
sein würde, bei fast völliger Absperrung vom Weltmarkte jahrelang in
einem Kriege wie diesem auszuharren, wäre früher selbst von mancher
wirtschaftswissenschaftlichen „Koryphäe" für eine törichte Vorstellung ge-
halten worden, die man keinen Augenblick zu erwägen brauchte. Die
Kriegsverhältnisse häben uns gelehrt, die Versorgung eines ganzen Volkes
mit den Mitteln zur Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse einmal
unäbhängig von aller Geld» und Marktwirtschaft zu betrachten, und wir
fanden staunend, daß die Möglichkeiten, unsern Bedarf durch Ausnützung
der heimischen tzilfsquellen zu decken, viel größer seien, als wir es uns
hatten träumen lassen. Denn was erkannte man immer wieder, wenn
man die Möglichkeiten der Erzeugung aus inländischen tzilfsquellen mit
den wirtschaftlichen Anforderungen.einer nicht zu anspruchsvollen Lebens-
weise verglich: daß diese Möglichkeiten durch die herkömmlichen Erzeu-
gungsarten auch nicht entfernt erschöpft würden, daß äber das, was mit
den üblichen Mitteln hervorgebracht wird, für alle reiche, wenn es nur
richtig verteilt werde. Eine immer mehr zusammenschmelzende tzeim«
armee, die dazu noch großenteils ihre Arbeitskräfte für Kriegszwecke zur
Verfügung stellen mußte, genügte gleichwohl, um aus heimischen tzilfs-
quellen den größten Teil der Unterhaltsmittel der Daheimgebliebenen
wie der Krieger zu decken. Ergibt sich daraus nicht die Aufgabe, daß nach
dem Kriege das Wirtschaftsleben wieder mehr in den Dienst der Er-
zeugung von Dingen gestellt werden sollte, die alle brauchen? Wenn
ein fieberhaft betriebener Exportindustrialismus nicht imstande ist, Tau-
sende und Abertausende so gut zu versorgen, wie im Kriege durch die
Arbeit eines Bruchteils der im Frieden wirtschaftlich tätigen Arbeits-
kräfte viele Millionen dem WirLschaftslehen entzogene Krieger versorgt
wurden: warum sollten da nicht wieder mehr Menschen dem landwirt-
schaftlichen Berufe sich zuwenden? Das ist, richtig verstanden, nicht nur
eine Forderung des Leben-Wollens, sondern auch des Besser-Leben»Wol-
lens, wenigstens für die Gesamtheit, die freilich keine Neigung haben kann,
Volkskräfte für die Erzeugung von Dingen vergeudet zu sehen, die es
manchen Reichen gestatten, in ihrem, natur- wie kulturwidrigen, Sinne auf
26^
lles in allem: wir können uns bei ruhiger, unbefangener Aber«
legung nur erstaunt fragen, wie es möglich ist, daß es uns im dritten
^v^Kriegsjahr mit unserer Ernahrung nicht viel schlimmer geht. Das
Merkwürdigste dabei ist nicht, daß wir trotz der Blockadepolitik unserer
Gegner durchkommen, sondern dah wir die immer wachsenden Ansprüche
der Landesverteidigung an unsre Volkskraft befriedigen, und uns doch
noch mit allem zum Leben Nötigen und vielem Aberflüssigen versorgen.
Große Schwierigkeiten mußten sich dabei ergeben, aber unsern Feinden
erging es in dieser Beziehung nicht besser. Der Krieg hat die Kräfte
aller beteiligten Völker mit der Zeit in einem Umfange für sich in An-
spruch genommen, daß es fast ratselhaft erscheint, wie sie sich mit den
übrigen Kräften noch alles Notwendige beschaffen können.
Vor dem Kriege gab es wenige, die einen langen Krieg zwischen moder-
nen Großmächten überhaupt noch für wirtschaftlich möglich hielten. Die
meisten gtaübten, daß die modernen Kulturvölker wirtschaftlich viel zu
sehr aufeinaüder angewiesen seien, um es lange ertragen zu ^önnen, sich
gegenseitig zu zerfleischen. Daß es im besonderen Deutschland möglich
sein würde, bei fast völliger Absperrung vom Weltmarkte jahrelang in
einem Kriege wie diesem auszuharren, wäre früher selbst von mancher
wirtschaftswissenschaftlichen „Koryphäe" für eine törichte Vorstellung ge-
halten worden, die man keinen Augenblick zu erwägen brauchte. Die
Kriegsverhältnisse häben uns gelehrt, die Versorgung eines ganzen Volkes
mit den Mitteln zur Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse einmal
unäbhängig von aller Geld» und Marktwirtschaft zu betrachten, und wir
fanden staunend, daß die Möglichkeiten, unsern Bedarf durch Ausnützung
der heimischen tzilfsquellen zu decken, viel größer seien, als wir es uns
hatten träumen lassen. Denn was erkannte man immer wieder, wenn
man die Möglichkeiten der Erzeugung aus inländischen tzilfsquellen mit
den wirtschaftlichen Anforderungen.einer nicht zu anspruchsvollen Lebens-
weise verglich: daß diese Möglichkeiten durch die herkömmlichen Erzeu-
gungsarten auch nicht entfernt erschöpft würden, daß äber das, was mit
den üblichen Mitteln hervorgebracht wird, für alle reiche, wenn es nur
richtig verteilt werde. Eine immer mehr zusammenschmelzende tzeim«
armee, die dazu noch großenteils ihre Arbeitskräfte für Kriegszwecke zur
Verfügung stellen mußte, genügte gleichwohl, um aus heimischen tzilfs-
quellen den größten Teil der Unterhaltsmittel der Daheimgebliebenen
wie der Krieger zu decken. Ergibt sich daraus nicht die Aufgabe, daß nach
dem Kriege das Wirtschaftsleben wieder mehr in den Dienst der Er-
zeugung von Dingen gestellt werden sollte, die alle brauchen? Wenn
ein fieberhaft betriebener Exportindustrialismus nicht imstande ist, Tau-
sende und Abertausende so gut zu versorgen, wie im Kriege durch die
Arbeit eines Bruchteils der im Frieden wirtschaftlich tätigen Arbeits-
kräfte viele Millionen dem WirLschaftslehen entzogene Krieger versorgt
wurden: warum sollten da nicht wieder mehr Menschen dem landwirt-
schaftlichen Berufe sich zuwenden? Das ist, richtig verstanden, nicht nur
eine Forderung des Leben-Wollens, sondern auch des Besser-Leben»Wol-
lens, wenigstens für die Gesamtheit, die freilich keine Neigung haben kann,
Volkskräfte für die Erzeugung von Dingen vergeudet zu sehen, die es
manchen Reichen gestatten, in ihrem, natur- wie kulturwidrigen, Sinne auf
26^