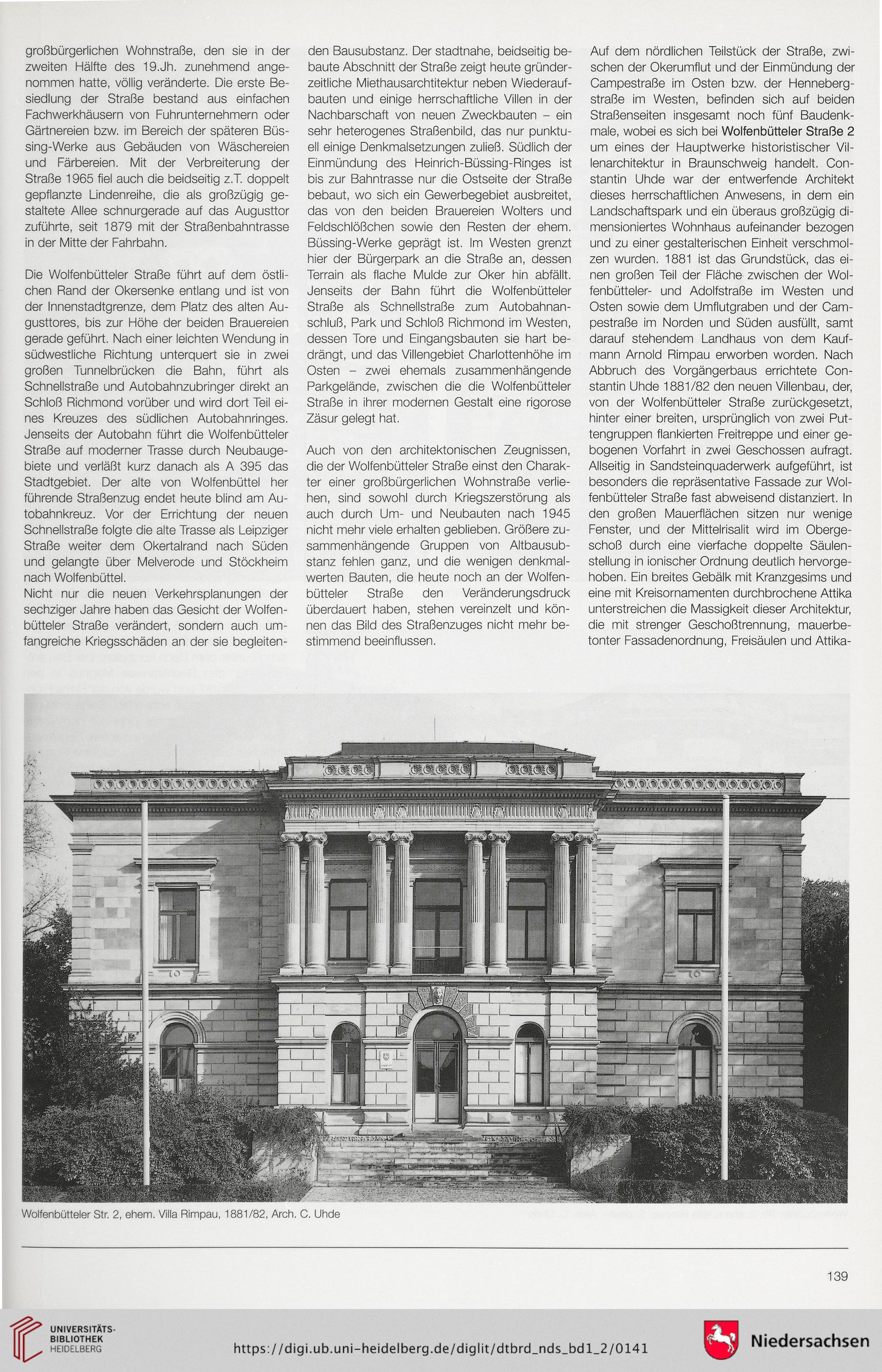großbürgerlichen Wohnstraße, den sie in der
zweiten Hälfte des 19.Jh. zunehmend ange-
nommen hatte, völlig veränderte. Die erste Be-
siedlung der Straße bestand aus einfachen
Fachwerkhäusern von Fuhrunternehmern oder
Gärtnereien bzw. im Bereich der späteren Büs-
sing-Werke aus Gebäuden von Wäschereien
und Färbereien. Mit der Verbreiterung der
Straße 1965 fiel auch die beidseitig z.T. doppelt
gepflanzte Lindenreihe, die als großzügig ge-
staltete Allee schnurgerade auf das Augusttor
zuführte, seit 1879 mit der Straßenbahntrasse
in der Mitte der Fahrbahn.
Die Wolfenbütteler Straße führt auf dem östli-
chen Rand der Okersenke entlang und ist von
der Innenstadtgrenze, dem Platz des alten Au-
gusttores, bis zur Höhe der beiden Brauereien
gerade geführt. Nach einer leichten Wendung in
südwestliche Richtung unterquert sie in zwei
großen Tunnelbrücken die Bahn, führt als
Schnellstraße und Autobahnzubringer direkt an
Schloß Richmond vorüber und wird dort Teil ei-
nes Kreuzes des südlichen Autobahnringes.
Jenseits der Autobahn führt die Wolfenbütteler
Straße auf moderner Trasse durch Neubauge-
biete und verläßt kurz danach als A 395 das
Stadtgebiet. Der alte von Wolfenbüttel her
führende Straßenzug endet heute blind am Au-
tobahnkreuz. Vor der Errichtung der neuen
Schnellstraße folgte die alte Trasse als Leipziger
Straße weiter dem Okertalrand nach Süden
und gelangte über Melverode und Stockheim
nach Wolfenbüttel.
Nicht nur die neuen Verkehrsplanungen der
sechziger Jahre haben das Gesicht der Wolfen-
bütteler Straße verändert, sondern auch um-
fangreiche Kriegsschäden an der sie begleiten-
den Bausubstanz. Der stadtnahe, beidseitig be-
baute Abschnitt der Straße zeigt heute gründer-
zeitliche Miethausarchtitektur neben Wiederauf-
bauten und einige herrschaftliche Villen in der
Nachbarschaft von neuen Zweckbauten - ein
sehr heterogenes Straßenbild, das nur punktu-
ell einige Denkmalsetzungen zuließ. Südlich der
Einmündung des Heinrich-Büssing-Ringes ist
bis zur Bahntrasse nur die Ostseite der Straße
bebaut, wo sich ein Gewerbegebiet ausbreitet,
das von den beiden Brauereien Wolters und
Feldschlößchen sowie den Resten der ehern.
Büssing-Werke geprägt ist. Im Westen grenzt
hier der Bürgerpark an die Straße an, dessen
Terrain als flache Mulde zur Oker hin abfällt.
Jenseits der Bahn führt die Wolfenbütteler
Straße als Schnellstraße zum Autobahnan-
schluß, Park und Schloß Richmond im Westen,
dessen Tore und Eingangsbauten sie hart be-
drängt, und das Villengebiet Charlottenhöhe im
Osten - zwei ehemals zusammenhängende
Parkgelände, zwischen die die Wolfenbütteler
Straße in ihrer modernen Gestalt eine rigorose
Zäsur gelegt hat.
Auch von den architektonischen Zeugnissen,
die der Wolfenbütteler Straße einst den Charak-
ter einer großbürgerlichen Wohnstraße verlie-
hen, sind sowohl durch Kriegszerstörung als
auch durch Um- und Neubauten nach 1945
nicht mehr viele erhalten geblieben. Größere zu-
sammenhängende Gruppen von Altbausub-
stanz fehlen ganz, und die wenigen denkmal-
werten Bauten, die heute noch an der Wolfen-
bütteler Straße den Veränderungsdruck
überdauert haben, stehen vereinzelt und kön-
nen das Bild des Straßenzuges nicht mehr be-
stimmend beeinflussen.
Auf dem nördlichen Teilstück der Straße, zwi-
schen der Okerumflut und der Einmündung der
Campestraße im Osten bzw. der Henneberg-
straße im Westen, befinden sich auf beiden
Straßenseiten insgesamt noch fünf Baudenk-
male, wobei es sich bei Wolfenbütteler Straße 2
um eines der Hauptwerke historistischer Vil-
lenarchitektur in Braunschweig handelt. Con-
stantin Uhde war der entwerfende Architekt
dieses herrschaftlichen Anwesens, in dem ein
Landschaftspark und ein überaus großzügig di-
mensioniertes Wohnhaus aufeinander bezogen
und zu einer gestalterischen Einheit verschmol-
zen wurden. 1881 ist das Grundstück, das ei-
nen großen Teil der Fläche zwischen der Wol-
fenbütteler- und Adolfstraße im Westen und
Osten sowie dem Umflutgraben und der Cam-
pestraße im Norden und Süden ausfüllt, samt
darauf stehendem Landhaus von dem Kauf-
mann Arnold Rimpau erworben worden. Nach
Abbruch des Vorgängerbaus errichtete Con-
stantin Uhde 1881/82 den neuen Villenbau, der,
von der Wolfenbütteler Straße zurückgesetzt,
hinter einer breiten, ursprünglich von zwei Put-
tengruppen flankierten Freitreppe und einer ge-
bogenen Vorfahrt in zwei Geschossen aufragt.
Allseitig in Sandsteinquaderwerk aufgeführt, ist
besonders die repräsentative Fassade zur Wol-
fenbütteler Straße fast abweisend distanziert. In
den großen Mauerflächen sitzen nur wenige
Fenster, und der Mittelrisalit wird im Oberge-
schoß durch eine vierfache doppelte Säulen-
stellung in ionischer Ordnung deutlich hervorge-
hoben. Ein breites Gebälk mit Kranzgesims und
eine mit Kreisornamenten durchbrochene Attika
unterstreichen die Massigkeit dieser Architektur,
die mit strenger Geschoßtrennung, mauerbe-
tonter Fassadenordnung, Freisäulen und Attika-
Wolfenbütteler Str. 2, ehern. Villa Rimpau, 1881/82, Arch. C. Uhde
139
zweiten Hälfte des 19.Jh. zunehmend ange-
nommen hatte, völlig veränderte. Die erste Be-
siedlung der Straße bestand aus einfachen
Fachwerkhäusern von Fuhrunternehmern oder
Gärtnereien bzw. im Bereich der späteren Büs-
sing-Werke aus Gebäuden von Wäschereien
und Färbereien. Mit der Verbreiterung der
Straße 1965 fiel auch die beidseitig z.T. doppelt
gepflanzte Lindenreihe, die als großzügig ge-
staltete Allee schnurgerade auf das Augusttor
zuführte, seit 1879 mit der Straßenbahntrasse
in der Mitte der Fahrbahn.
Die Wolfenbütteler Straße führt auf dem östli-
chen Rand der Okersenke entlang und ist von
der Innenstadtgrenze, dem Platz des alten Au-
gusttores, bis zur Höhe der beiden Brauereien
gerade geführt. Nach einer leichten Wendung in
südwestliche Richtung unterquert sie in zwei
großen Tunnelbrücken die Bahn, führt als
Schnellstraße und Autobahnzubringer direkt an
Schloß Richmond vorüber und wird dort Teil ei-
nes Kreuzes des südlichen Autobahnringes.
Jenseits der Autobahn führt die Wolfenbütteler
Straße auf moderner Trasse durch Neubauge-
biete und verläßt kurz danach als A 395 das
Stadtgebiet. Der alte von Wolfenbüttel her
führende Straßenzug endet heute blind am Au-
tobahnkreuz. Vor der Errichtung der neuen
Schnellstraße folgte die alte Trasse als Leipziger
Straße weiter dem Okertalrand nach Süden
und gelangte über Melverode und Stockheim
nach Wolfenbüttel.
Nicht nur die neuen Verkehrsplanungen der
sechziger Jahre haben das Gesicht der Wolfen-
bütteler Straße verändert, sondern auch um-
fangreiche Kriegsschäden an der sie begleiten-
den Bausubstanz. Der stadtnahe, beidseitig be-
baute Abschnitt der Straße zeigt heute gründer-
zeitliche Miethausarchtitektur neben Wiederauf-
bauten und einige herrschaftliche Villen in der
Nachbarschaft von neuen Zweckbauten - ein
sehr heterogenes Straßenbild, das nur punktu-
ell einige Denkmalsetzungen zuließ. Südlich der
Einmündung des Heinrich-Büssing-Ringes ist
bis zur Bahntrasse nur die Ostseite der Straße
bebaut, wo sich ein Gewerbegebiet ausbreitet,
das von den beiden Brauereien Wolters und
Feldschlößchen sowie den Resten der ehern.
Büssing-Werke geprägt ist. Im Westen grenzt
hier der Bürgerpark an die Straße an, dessen
Terrain als flache Mulde zur Oker hin abfällt.
Jenseits der Bahn führt die Wolfenbütteler
Straße als Schnellstraße zum Autobahnan-
schluß, Park und Schloß Richmond im Westen,
dessen Tore und Eingangsbauten sie hart be-
drängt, und das Villengebiet Charlottenhöhe im
Osten - zwei ehemals zusammenhängende
Parkgelände, zwischen die die Wolfenbütteler
Straße in ihrer modernen Gestalt eine rigorose
Zäsur gelegt hat.
Auch von den architektonischen Zeugnissen,
die der Wolfenbütteler Straße einst den Charak-
ter einer großbürgerlichen Wohnstraße verlie-
hen, sind sowohl durch Kriegszerstörung als
auch durch Um- und Neubauten nach 1945
nicht mehr viele erhalten geblieben. Größere zu-
sammenhängende Gruppen von Altbausub-
stanz fehlen ganz, und die wenigen denkmal-
werten Bauten, die heute noch an der Wolfen-
bütteler Straße den Veränderungsdruck
überdauert haben, stehen vereinzelt und kön-
nen das Bild des Straßenzuges nicht mehr be-
stimmend beeinflussen.
Auf dem nördlichen Teilstück der Straße, zwi-
schen der Okerumflut und der Einmündung der
Campestraße im Osten bzw. der Henneberg-
straße im Westen, befinden sich auf beiden
Straßenseiten insgesamt noch fünf Baudenk-
male, wobei es sich bei Wolfenbütteler Straße 2
um eines der Hauptwerke historistischer Vil-
lenarchitektur in Braunschweig handelt. Con-
stantin Uhde war der entwerfende Architekt
dieses herrschaftlichen Anwesens, in dem ein
Landschaftspark und ein überaus großzügig di-
mensioniertes Wohnhaus aufeinander bezogen
und zu einer gestalterischen Einheit verschmol-
zen wurden. 1881 ist das Grundstück, das ei-
nen großen Teil der Fläche zwischen der Wol-
fenbütteler- und Adolfstraße im Westen und
Osten sowie dem Umflutgraben und der Cam-
pestraße im Norden und Süden ausfüllt, samt
darauf stehendem Landhaus von dem Kauf-
mann Arnold Rimpau erworben worden. Nach
Abbruch des Vorgängerbaus errichtete Con-
stantin Uhde 1881/82 den neuen Villenbau, der,
von der Wolfenbütteler Straße zurückgesetzt,
hinter einer breiten, ursprünglich von zwei Put-
tengruppen flankierten Freitreppe und einer ge-
bogenen Vorfahrt in zwei Geschossen aufragt.
Allseitig in Sandsteinquaderwerk aufgeführt, ist
besonders die repräsentative Fassade zur Wol-
fenbütteler Straße fast abweisend distanziert. In
den großen Mauerflächen sitzen nur wenige
Fenster, und der Mittelrisalit wird im Oberge-
schoß durch eine vierfache doppelte Säulen-
stellung in ionischer Ordnung deutlich hervorge-
hoben. Ein breites Gebälk mit Kranzgesims und
eine mit Kreisornamenten durchbrochene Attika
unterstreichen die Massigkeit dieser Architektur,
die mit strenger Geschoßtrennung, mauerbe-
tonter Fassadenordnung, Freisäulen und Attika-
Wolfenbütteler Str. 2, ehern. Villa Rimpau, 1881/82, Arch. C. Uhde
139