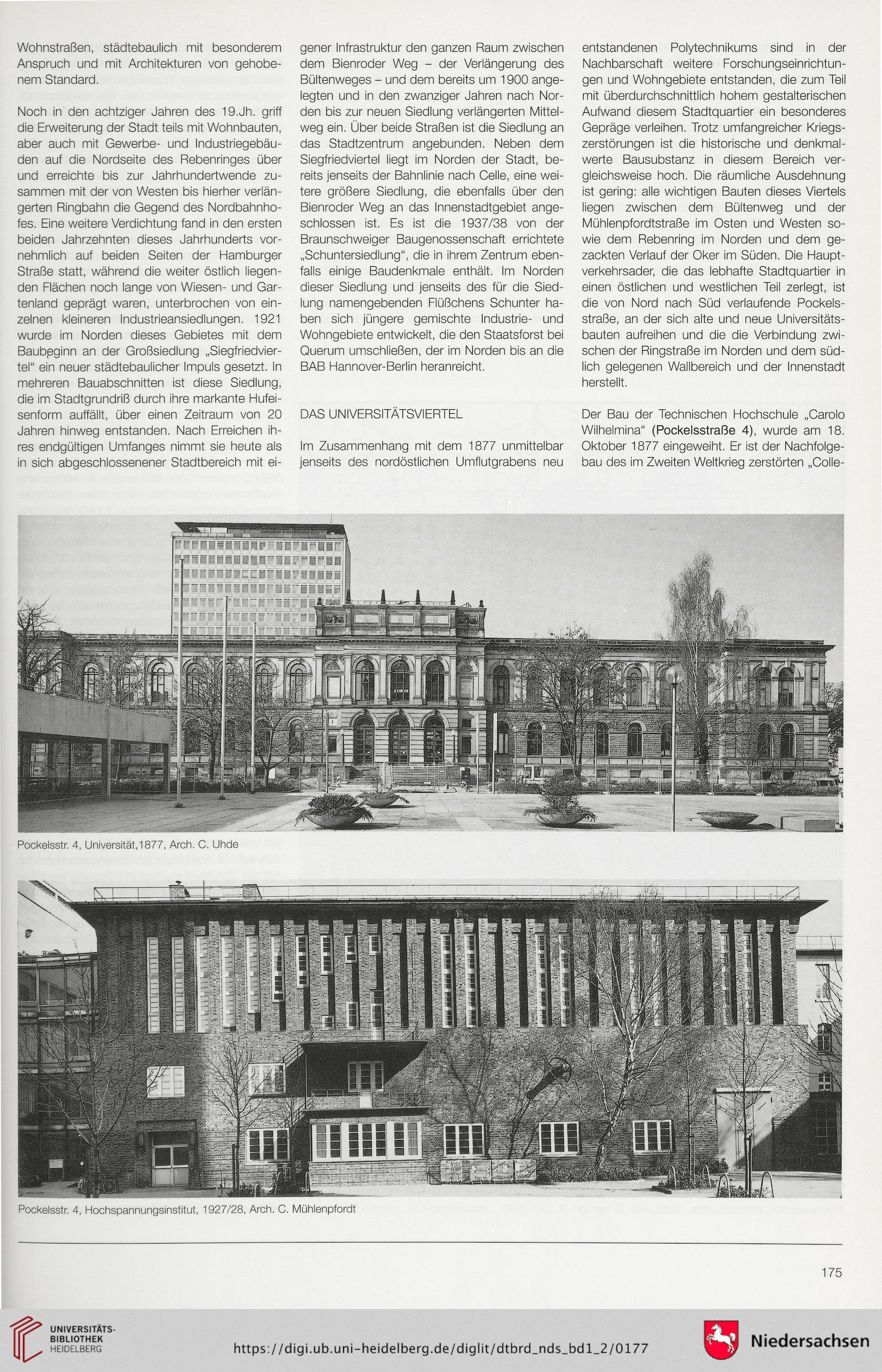Wohnstraßen, städtebaulich mit besonderem
Anspruch und mit Architekturen von gehobe-
nem Standard.
Noch in den achtziger Jahren des 19.Jh. griff
die Erweiterung der Stadt teils mit Wohnbauten,
aber auch mit Gewerbe- und Industriegebäu-
den auf die Nordseite des Rebenringes über
und erreichte bis zur Jahrhundertwende zu-
sammen mit der von Westen bis hierher verlän-
gerten Ringbahn die Gegend des Nordbahnho-
fes. Eine weitere Verdichtung fand in den ersten
beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts vor-
nehmlich auf beiden Seiten der Hamburger
Straße statt, während die weiter östlich liegen-
den Flächen noch lange von Wiesen- und Gar-
tenland geprägt waren, unterbrochen von ein-
zelnen kleineren Industrieansiedlungen. 1921
wurde im Norden dieses Gebietes mit dem
Baubeginn an der Großsiedlung „Siegfriedvier-
tel“ ein neuer städtebaulicher Impuls gesetzt. In
mehreren Bauabschnitten ist diese Siedlung,
die im Stadtgrundriß durch ihre markante Hufei-
senform auffällt, über einen Zeitraum von 20
Jahren hinweg entstanden. Nach Erreichen ih-
res endgültigen Umfanges nimmt sie heute als
in sich abgeschlossenener Stadtbereich mit ei-
gener Infrastruktur den ganzen Raum zwischen
dem Bienroder Weg - der Verlängerung des
Bültenweges - und dem bereits um 1900 ange-
legten und in den zwanziger Jahren nach Nor-
den bis zur neuen Siedlung verlängerten Mittel-
weg ein. Über beide Straßen ist die Siedlung an
das Stadtzentrum angebunden. Neben dem
Siegfriedviertel liegt im Norden der Stadt, be-
reits jenseits der Bahnlinie nach Celle, eine wei-
tere größere Siedlung, die ebenfalls über den
Bienroder Weg an das Innenstadtgebiet ange-
schlossen ist. Es ist die 1937/38 von der
Braunschweiger Baugenossenschaft errichtete
„Schuntersiedlung“, die in ihrem Zentrum eben-
falls einige Baudenkmale enthält. Im Norden
dieser Siedlung und jenseits des für die Sied-
lung namengebenden Flüßchens Schunter ha-
ben sich jüngere gemischte Industrie- und
Wohngebiete entwickelt, die den Staatsforst bei
Querum umschließen, der im Norden bis an die
BAB Hannover-Berlin heranreicht.
DAS UNIVERSITÄTSVIERTEL
Im Zusammenhang mit dem 1877 unmittelbar
jenseits des nordöstlichen Umflutgrabens neu
entstandenen Polytechnikums sind in der
Nachbarschaft weitere Forschungseinrichtun-
gen und Wohngebiete entstanden, die zum Teil
mit überdurchschnittlich hohem gestalterischen
Aufwand diesem Stadtquartier ein besonderes
Gepräge verleihen. Trotz umfangreicher Kriegs-
zerstörungen ist die historische und denkmal-
werte Bausubstanz in diesem Bereich ver-
gleichsweise hoch. Die räumliche Ausdehnung
ist gering: alle wichtigen Bauten dieses Viertels
liegen zwischen dem Bültenweg und der
Mühlenpfordtstraße im Osten und Westen so-
wie dem Rebenring im Norden und dem ge-
zackten Verlauf der Oker im Süden. Die Haupt-
verkehrsader, die das lebhafte Stadtquartier in
einen östlichen und westlichen Teil zerlegt, ist
die von Nord nach Süd verlaufende Pockels-
straße, an der sich alte und neue Universitäts-
bauten aufreihen und die die Verbindung zwi-
schen der Ringstraße im Norden und dem süd-
lich gelegenen Wallbereich und der Innenstadt
herstellt.
Der Bau der Technischen Hochschule „Carolo
Wilhelmina“ (Pockelsstraße 4), wurde am 18.
Oktober 1877 eingeweiht. Er ist der Nachfolge-
bau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten „Colle-
Pockelsstr. 4, Universität, 1877, Arch. C. Uhde
Pockelsstr. 4, Hochspannungsinstitut, 1927/28, Arch. C. Mühlenpfordt
175
Anspruch und mit Architekturen von gehobe-
nem Standard.
Noch in den achtziger Jahren des 19.Jh. griff
die Erweiterung der Stadt teils mit Wohnbauten,
aber auch mit Gewerbe- und Industriegebäu-
den auf die Nordseite des Rebenringes über
und erreichte bis zur Jahrhundertwende zu-
sammen mit der von Westen bis hierher verlän-
gerten Ringbahn die Gegend des Nordbahnho-
fes. Eine weitere Verdichtung fand in den ersten
beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts vor-
nehmlich auf beiden Seiten der Hamburger
Straße statt, während die weiter östlich liegen-
den Flächen noch lange von Wiesen- und Gar-
tenland geprägt waren, unterbrochen von ein-
zelnen kleineren Industrieansiedlungen. 1921
wurde im Norden dieses Gebietes mit dem
Baubeginn an der Großsiedlung „Siegfriedvier-
tel“ ein neuer städtebaulicher Impuls gesetzt. In
mehreren Bauabschnitten ist diese Siedlung,
die im Stadtgrundriß durch ihre markante Hufei-
senform auffällt, über einen Zeitraum von 20
Jahren hinweg entstanden. Nach Erreichen ih-
res endgültigen Umfanges nimmt sie heute als
in sich abgeschlossenener Stadtbereich mit ei-
gener Infrastruktur den ganzen Raum zwischen
dem Bienroder Weg - der Verlängerung des
Bültenweges - und dem bereits um 1900 ange-
legten und in den zwanziger Jahren nach Nor-
den bis zur neuen Siedlung verlängerten Mittel-
weg ein. Über beide Straßen ist die Siedlung an
das Stadtzentrum angebunden. Neben dem
Siegfriedviertel liegt im Norden der Stadt, be-
reits jenseits der Bahnlinie nach Celle, eine wei-
tere größere Siedlung, die ebenfalls über den
Bienroder Weg an das Innenstadtgebiet ange-
schlossen ist. Es ist die 1937/38 von der
Braunschweiger Baugenossenschaft errichtete
„Schuntersiedlung“, die in ihrem Zentrum eben-
falls einige Baudenkmale enthält. Im Norden
dieser Siedlung und jenseits des für die Sied-
lung namengebenden Flüßchens Schunter ha-
ben sich jüngere gemischte Industrie- und
Wohngebiete entwickelt, die den Staatsforst bei
Querum umschließen, der im Norden bis an die
BAB Hannover-Berlin heranreicht.
DAS UNIVERSITÄTSVIERTEL
Im Zusammenhang mit dem 1877 unmittelbar
jenseits des nordöstlichen Umflutgrabens neu
entstandenen Polytechnikums sind in der
Nachbarschaft weitere Forschungseinrichtun-
gen und Wohngebiete entstanden, die zum Teil
mit überdurchschnittlich hohem gestalterischen
Aufwand diesem Stadtquartier ein besonderes
Gepräge verleihen. Trotz umfangreicher Kriegs-
zerstörungen ist die historische und denkmal-
werte Bausubstanz in diesem Bereich ver-
gleichsweise hoch. Die räumliche Ausdehnung
ist gering: alle wichtigen Bauten dieses Viertels
liegen zwischen dem Bültenweg und der
Mühlenpfordtstraße im Osten und Westen so-
wie dem Rebenring im Norden und dem ge-
zackten Verlauf der Oker im Süden. Die Haupt-
verkehrsader, die das lebhafte Stadtquartier in
einen östlichen und westlichen Teil zerlegt, ist
die von Nord nach Süd verlaufende Pockels-
straße, an der sich alte und neue Universitäts-
bauten aufreihen und die die Verbindung zwi-
schen der Ringstraße im Norden und dem süd-
lich gelegenen Wallbereich und der Innenstadt
herstellt.
Der Bau der Technischen Hochschule „Carolo
Wilhelmina“ (Pockelsstraße 4), wurde am 18.
Oktober 1877 eingeweiht. Er ist der Nachfolge-
bau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten „Colle-
Pockelsstr. 4, Universität, 1877, Arch. C. Uhde
Pockelsstr. 4, Hochspannungsinstitut, 1927/28, Arch. C. Mühlenpfordt
175