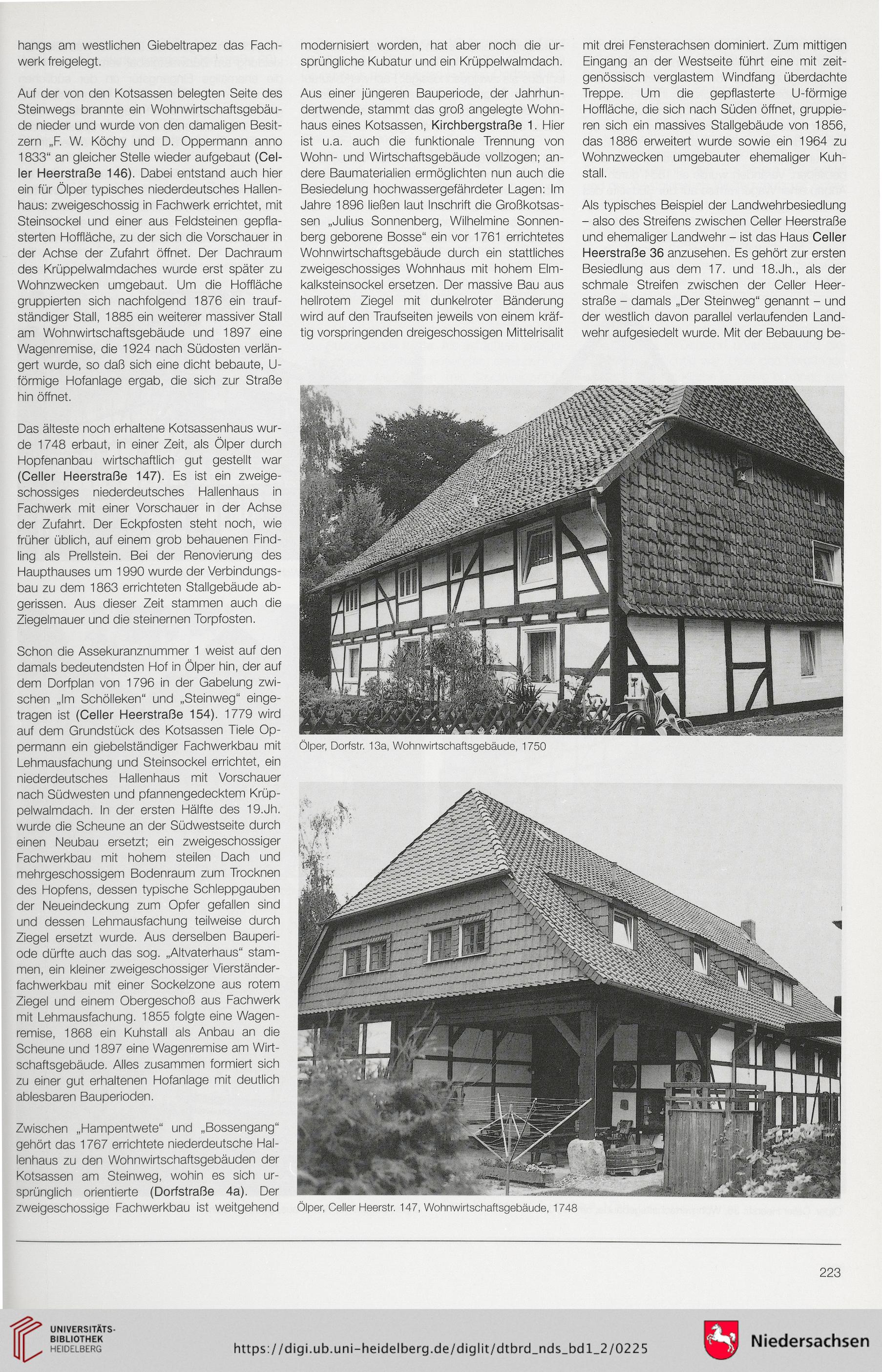hangs am westlichen Giebeltrapez das Fach-
werk freigelegt.
Auf der von den Kotsassen belegten Seite des
Steinwegs brannte ein Wohnwirtschaftsgebäu-
de nieder und wurde von den damaligen Besit-
zern „F. W. Köchy und D. Oppermann anno
1833“ an gleicher Stelle wieder aufgebaut (Cel-
ler Heerstraße 146). Dabei entstand auch hier
ein für Ölper typisches niederdeutsches Hallen-
haus: zweigeschossig in Fachwerk errichtet, mit
Steinsockel und einer aus Feldsteinen gepfla-
sterten Hoffläche, zu der sich die Vorschauer in
der Achse der Zufahrt öffnet. Der Dachraum
des Krüppelwalmdaches wurde erst später zu
Wohnzwecken umgebaut. Um die Hoffläche
gruppierten sich nachfolgend 1876 ein trauf-
ständiger Stall, 1885 ein weiterer massiver Stall
am Wohnwirtschaftsgebäude und 1897 eine
Wagenremise, die 1924 nach Südosten verlän-
gert wurde, so daß sich eine dicht bebaute, U-
förmige Hofanlage ergab, die sich zur Straße
hin öffnet.
Das älteste noch erhaltene Kotsassenhaus wur-
de 1748 erbaut, in einer Zeit, als Ölper durch
Hopfenanbau wirtschaftlich gut gestellt war
(Celler Heerstraße 147). Es ist ein zweige-
schossiges niederdeutsches Hallenhaus in
Fachwerk mit einer Vorschauer in der Achse
der Zufahrt. Der Eckpfosten steht noch, wie
früher üblich, auf einem grob behauenen Find-
ling als Prellstein. Bei der Renovierung des
Haupthauses um 1990 wurde der Verbindungs-
bau zu dem 1863 errichteten Stallgebäude ab-
gerissen. Aus dieser Zeit stammen auch die
Ziegelmauer und die steinernen Torpfosten.
Schon die Assekuranznummer 1 weist auf den
damals bedeutendsten Hof in Ölper hin, der auf
dem Dorfplan von 1796 in der Gabelung zwi-
schen „Im Schölleken“ und „Steinweg“ einge-
tragen ist (Celler Heerstraße 154). 1779 wird
auf dem Grundstück des Kotsassen Tiele Op-
permann ein giebelständiger Fachwerkbau mit
Lehmausfachung und Steinsockel errichtet, ein
niederdeutsches Hallenhaus mit Vorschauer
nach Südwesten und pfannengedecktem Krüp-
pelwalmdach. In der ersten Hälfte des 19.Jh.
wurde die Scheune an der Südwestseite durch
einen Neubau ersetzt; ein zweigeschossiger
Fachwerkbau mit hohem steilen Dach und
mehrgeschossigem Bodenraum zum Trocknen
des Hopfens, dessen typische Schleppgauben
der Neueindeckung zum Opfer gefallen sind
und dessen Lehmausfachung teilweise durch
Ziegel ersetzt wurde. Aus derselben Bauperi-
ode dürfte auch das sog. „Altvaterhaus“ stam-
men, ein kleiner zweigeschossiger Vierständer-
fachwerkbau mit einer Sockelzone aus rotem
Ziegel und einem Obergeschoß aus Fachwerk
mit Lehmausfachung. 1855 folgte eine Wagen-
remise, 1868 ein Kuhstall als Anbau an die
Scheune und 1897 eine Wagenremise am Wirt-
schaftsgebäude. Alles zusammen formiert sich
zu einer gut erhaltenen Hofanlage mit deutlich
ablesbaren Bauperioden.
Zwischen „Hampentwete“ und „Bossengang“
gehört das 1767 errichtete niederdeutsche Hal-
lenhaus zu den Wohnwirtschaftsgebäuden der
Kotsassen am Steinweg, wohin es sich ur-
sprünglich orientierte (Dorfstraße 4a). Der
zweigeschossige Fachwerkbau ist weitgehend
modernisiert worden, hat aber noch die ur-
sprüngliche Kubatur und ein Krüppelwalmdach.
Aus einer jüngeren Bauperiode, der Jahrhun-
dertwende, stammt das groß angelegte Wohn-
haus eines Kotsassen, Kirchbergstraße 1. Hier
ist u.a. auch die funktionale Trennung von
Wohn- und Wirtschaftsgebäude vollzogen; an-
dere Baumaterialien ermöglichten nun auch die
Besiedelung hochwassergefährdeter Lagen: Im
Jahre 1896 ließen laut Inschrift die Großkotsas-
sen „Julius Sonnenberg, Wilhelmine Sonnen-
berg geborene Bosse“ ein vor 1761 errichtetes
Wohnwirtschaftsgebäude durch ein stattliches
zweigeschossiges Wohnhaus mit hohem Elm-
kalksteinsockel ersetzen. Der massive Bau aus
hellrotem Ziegel mit dunkelroter Bänderung
wird auf den Traufseiten jeweils von einem kräf-
tig vorspringenden dreigeschossigen Mittelrisalit
mit drei Fensterachsen dominiert. Zum mittigen
Eingang an der Westseite führt eine mit zeit-
genössisch verglastem Windfang überdachte
Treppe. Um die gepflasterte U-förmige
Hoffläche, die sich nach Süden öffnet, gruppie-
ren sich ein massives Stallgebäude von 1856,
das 1886 erweitert wurde sowie ein 1964 zu
Wohnzwecken umgebauter ehemaliger Kuh-
stall.
Als typisches Beispiel der Landwehrbesiedlung
- also des Streifens zwischen Celler Heerstraße
und ehemaliger Landwehr - ist das Haus Celler
Heerstraße 36 anzusehen. Es gehört zur ersten
Besiedlung aus dem 17. und 18.Jh., als der
schmale Streifen zwischen der Celler Heer-
straße - damals „Der Steinweg“ genannt - und
der westlich davon parallel verlaufenden Land-
wehr aufgesiedelt wurde. Mit der Bebauung be-
Ölper, Dorfstr. 13a, Wohnwirtschaftsgebäude, 1750
Ölper, Celler Heerstr. 147, Wohnwirtschaftsgebäude, 1748
223
werk freigelegt.
Auf der von den Kotsassen belegten Seite des
Steinwegs brannte ein Wohnwirtschaftsgebäu-
de nieder und wurde von den damaligen Besit-
zern „F. W. Köchy und D. Oppermann anno
1833“ an gleicher Stelle wieder aufgebaut (Cel-
ler Heerstraße 146). Dabei entstand auch hier
ein für Ölper typisches niederdeutsches Hallen-
haus: zweigeschossig in Fachwerk errichtet, mit
Steinsockel und einer aus Feldsteinen gepfla-
sterten Hoffläche, zu der sich die Vorschauer in
der Achse der Zufahrt öffnet. Der Dachraum
des Krüppelwalmdaches wurde erst später zu
Wohnzwecken umgebaut. Um die Hoffläche
gruppierten sich nachfolgend 1876 ein trauf-
ständiger Stall, 1885 ein weiterer massiver Stall
am Wohnwirtschaftsgebäude und 1897 eine
Wagenremise, die 1924 nach Südosten verlän-
gert wurde, so daß sich eine dicht bebaute, U-
förmige Hofanlage ergab, die sich zur Straße
hin öffnet.
Das älteste noch erhaltene Kotsassenhaus wur-
de 1748 erbaut, in einer Zeit, als Ölper durch
Hopfenanbau wirtschaftlich gut gestellt war
(Celler Heerstraße 147). Es ist ein zweige-
schossiges niederdeutsches Hallenhaus in
Fachwerk mit einer Vorschauer in der Achse
der Zufahrt. Der Eckpfosten steht noch, wie
früher üblich, auf einem grob behauenen Find-
ling als Prellstein. Bei der Renovierung des
Haupthauses um 1990 wurde der Verbindungs-
bau zu dem 1863 errichteten Stallgebäude ab-
gerissen. Aus dieser Zeit stammen auch die
Ziegelmauer und die steinernen Torpfosten.
Schon die Assekuranznummer 1 weist auf den
damals bedeutendsten Hof in Ölper hin, der auf
dem Dorfplan von 1796 in der Gabelung zwi-
schen „Im Schölleken“ und „Steinweg“ einge-
tragen ist (Celler Heerstraße 154). 1779 wird
auf dem Grundstück des Kotsassen Tiele Op-
permann ein giebelständiger Fachwerkbau mit
Lehmausfachung und Steinsockel errichtet, ein
niederdeutsches Hallenhaus mit Vorschauer
nach Südwesten und pfannengedecktem Krüp-
pelwalmdach. In der ersten Hälfte des 19.Jh.
wurde die Scheune an der Südwestseite durch
einen Neubau ersetzt; ein zweigeschossiger
Fachwerkbau mit hohem steilen Dach und
mehrgeschossigem Bodenraum zum Trocknen
des Hopfens, dessen typische Schleppgauben
der Neueindeckung zum Opfer gefallen sind
und dessen Lehmausfachung teilweise durch
Ziegel ersetzt wurde. Aus derselben Bauperi-
ode dürfte auch das sog. „Altvaterhaus“ stam-
men, ein kleiner zweigeschossiger Vierständer-
fachwerkbau mit einer Sockelzone aus rotem
Ziegel und einem Obergeschoß aus Fachwerk
mit Lehmausfachung. 1855 folgte eine Wagen-
remise, 1868 ein Kuhstall als Anbau an die
Scheune und 1897 eine Wagenremise am Wirt-
schaftsgebäude. Alles zusammen formiert sich
zu einer gut erhaltenen Hofanlage mit deutlich
ablesbaren Bauperioden.
Zwischen „Hampentwete“ und „Bossengang“
gehört das 1767 errichtete niederdeutsche Hal-
lenhaus zu den Wohnwirtschaftsgebäuden der
Kotsassen am Steinweg, wohin es sich ur-
sprünglich orientierte (Dorfstraße 4a). Der
zweigeschossige Fachwerkbau ist weitgehend
modernisiert worden, hat aber noch die ur-
sprüngliche Kubatur und ein Krüppelwalmdach.
Aus einer jüngeren Bauperiode, der Jahrhun-
dertwende, stammt das groß angelegte Wohn-
haus eines Kotsassen, Kirchbergstraße 1. Hier
ist u.a. auch die funktionale Trennung von
Wohn- und Wirtschaftsgebäude vollzogen; an-
dere Baumaterialien ermöglichten nun auch die
Besiedelung hochwassergefährdeter Lagen: Im
Jahre 1896 ließen laut Inschrift die Großkotsas-
sen „Julius Sonnenberg, Wilhelmine Sonnen-
berg geborene Bosse“ ein vor 1761 errichtetes
Wohnwirtschaftsgebäude durch ein stattliches
zweigeschossiges Wohnhaus mit hohem Elm-
kalksteinsockel ersetzen. Der massive Bau aus
hellrotem Ziegel mit dunkelroter Bänderung
wird auf den Traufseiten jeweils von einem kräf-
tig vorspringenden dreigeschossigen Mittelrisalit
mit drei Fensterachsen dominiert. Zum mittigen
Eingang an der Westseite führt eine mit zeit-
genössisch verglastem Windfang überdachte
Treppe. Um die gepflasterte U-förmige
Hoffläche, die sich nach Süden öffnet, gruppie-
ren sich ein massives Stallgebäude von 1856,
das 1886 erweitert wurde sowie ein 1964 zu
Wohnzwecken umgebauter ehemaliger Kuh-
stall.
Als typisches Beispiel der Landwehrbesiedlung
- also des Streifens zwischen Celler Heerstraße
und ehemaliger Landwehr - ist das Haus Celler
Heerstraße 36 anzusehen. Es gehört zur ersten
Besiedlung aus dem 17. und 18.Jh., als der
schmale Streifen zwischen der Celler Heer-
straße - damals „Der Steinweg“ genannt - und
der westlich davon parallel verlaufenden Land-
wehr aufgesiedelt wurde. Mit der Bebauung be-
Ölper, Dorfstr. 13a, Wohnwirtschaftsgebäude, 1750
Ölper, Celler Heerstr. 147, Wohnwirtschaftsgebäude, 1748
223