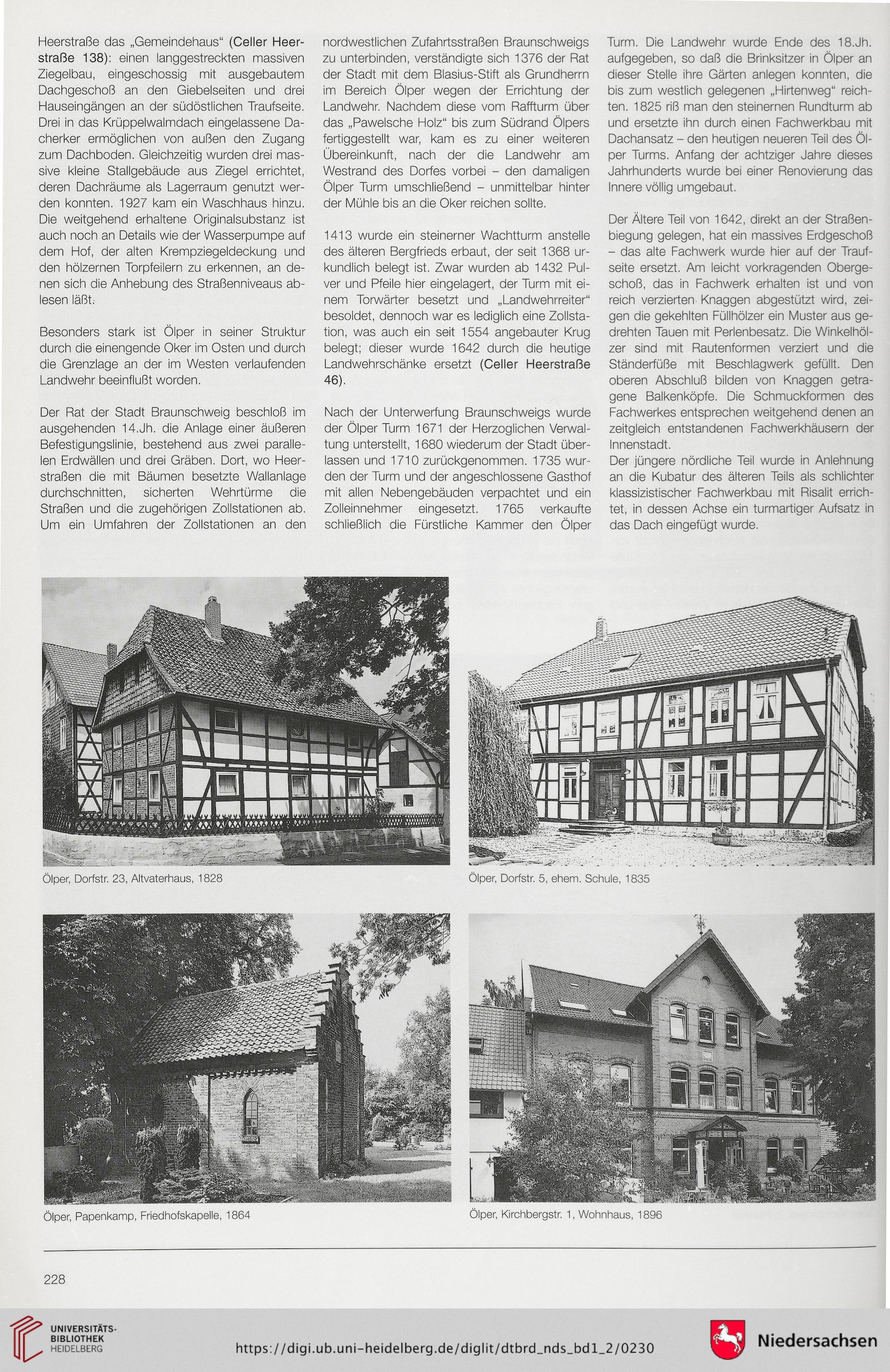Heerstraße das „Gemeindehaus“ (Celler Heer-
straße 138): einen langgestreckten massiven
Ziegelbau, eingeschossig mit ausgebautem
Dachgeschoß an den Giebelseiten und drei
Hauseingängen an der südöstlichen Traufseite.
Drei in das Krüppelwalmdach eingelassene Da-
cherker ermöglichen von außen den Zugang
zum Dachboden. Gleichzeitig wurden drei mas-
sive kleine Stallgebäude aus Ziegel errichtet,
deren Dachräume als Lagerraum genutzt wer-
den konnten. 1927 kam ein Waschhaus hinzu.
Die weitgehend erhaltene Originalsubstanz ist
auch noch an Details wie der Wasserpumpe auf
dem Hof, der alten Krempziegeldeckung und
den hölzernen Torpfeilern zu erkennen, an de-
nen sich die Anhebung des Straßenniveaus ab-
lesen läßt.
Besonders stark ist Ölper in seiner Struktur
durch die einengende Oker im Osten und durch
die Grenzlage an der im Westen verlaufenden
Landwehr beeinflußt worden.
nordwestlichen Zufahrtsstraßen Braunschweigs
zu unterbinden, verständigte sich 1376 der Rat
der Stadt mit dem Blasius-Stift als Grundherrn
im Bereich Ölper wegen der Errichtung der
Landwehr. Nachdem diese vom Raffturm über
das „Pawelsche Holz“ bis zum Südrand Ölpers
fertiggestellt war, kam es zu einer weiteren
Übereinkunft, nach der die Landwehr am
Westrand des Dorfes vorbei - den damaligen
Ölper Turm umschließend - unmittelbar hinter
der Mühle bis an die Oker reichen sollte.
1413 wurde ein steinerner Wachtturm anstelle
des älteren Bergfrieds erbaut, der seit 1368 ur-
kundlich belegt ist. Zwar wurden ab 1432 Pul-
ver und Pfeile hier eingelagert, der Turm mit ei-
nem Torwärter besetzt und „Landwehrreiter“
besoldet, dennoch war es lediglich eine Zollsta-
tion, was auch ein seit 1554 angebauter Krug
belegt; dieser wurde 1642 durch die heutige
Landwehrschänke ersetzt (Celler Heerstraße
46).
Der Rat der Stadt Braunschweig beschloß im
ausgehenden 14.Jh. die Anlage einer äußeren
Befestigungslinie, bestehend aus zwei paralle-
len Erdwällen und drei Gräben. Dort, wo Heer-
straßen die mit Bäumen besetzte Wallanlage
durchschnitten, sicherten Wehrtürme die
Straßen und die zugehörigen Zollstationen ab.
Um ein Umfahren der Zollstationen an den
Nach der Unterwerfung Braunschweigs wurde
der Ölper Turm 1671 der Herzoglichen Verwal-
tung unterstellt, 1680 wiederum der Stadt über-
lassen und 1710 zurückgenommen. 1735 wur-
den der Turm und der angeschlossene Gasthof
mit allen Nebengebäuden verpachtet und ein
Zolleinnehmer eingesetzt. 1765 verkaufte
schließlich die Fürstliche Kammer den Ölper
Turm. Die Landwehr wurde Ende des 18.Jh.
aufgegeben, so daß die Brinksitzer in Ölper an
dieser Stelle ihre Gärten anlegen konnten, die
bis zum westlich gelegenen „Hirtenweg“ reich-
ten. 1825 riß man den steinernen Rundturm ab
und ersetzte ihn durch einen Fachwerkbau mit
Dachansatz - den heutigen neueren Teil des Öl-
per Turms. Anfang der achtziger Jahre dieses
Jahrhunderts wurde bei einer Renovierung das
Innere völlig umgebaut.
Der Ältere Teil von 1642, direkt an der Straßen-
biegung gelegen, hat ein massives Erdgeschoß
- das alte Fachwerk wurde hier auf der Trauf-
seite ersetzt. Am leicht vorkragenden Oberge-
schoß, das in Fachwerk erhalten ist und von
reich verzierten Knaggen abgestützt wird, zei-
gen die gekehlten Füllhölzer ein Muster aus ge-
drehten Tauen mit Perlenbesatz. Die Winkelhöl-
zer sind mit Rautenformen verziert und die
Ständerfüße mit Beschlagwerk gefüllt. Den
oberen Abschluß bilden von Knaggen getra-
gene Balkenköpfe. Die Schmuckformen des
Fachwerkes entsprechen weitgehend denen an
zeitgleich entstandenen Fachwerkhäusern der
Innenstadt.
Der jüngere nördliche Teil wurde in Anlehnung
an die Kubatur des älteren Teils als schlichter
klassizistischer Fachwerkbau mit Risalit errich-
tet, in dessen Achse ein turmartiger Aufsatz in
das Dach eingefügt wurde.
Ölper, Dorfstr. 23, Altvaterhaus, 1828
Ölper, Dorfstr. 5, ehern. Schule, 1835
Ölper, Papenkamp, Friedhofskapelle, 1864
Ölper, Kirchbergstr. 1, Wohnhaus, 1896
228
straße 138): einen langgestreckten massiven
Ziegelbau, eingeschossig mit ausgebautem
Dachgeschoß an den Giebelseiten und drei
Hauseingängen an der südöstlichen Traufseite.
Drei in das Krüppelwalmdach eingelassene Da-
cherker ermöglichen von außen den Zugang
zum Dachboden. Gleichzeitig wurden drei mas-
sive kleine Stallgebäude aus Ziegel errichtet,
deren Dachräume als Lagerraum genutzt wer-
den konnten. 1927 kam ein Waschhaus hinzu.
Die weitgehend erhaltene Originalsubstanz ist
auch noch an Details wie der Wasserpumpe auf
dem Hof, der alten Krempziegeldeckung und
den hölzernen Torpfeilern zu erkennen, an de-
nen sich die Anhebung des Straßenniveaus ab-
lesen läßt.
Besonders stark ist Ölper in seiner Struktur
durch die einengende Oker im Osten und durch
die Grenzlage an der im Westen verlaufenden
Landwehr beeinflußt worden.
nordwestlichen Zufahrtsstraßen Braunschweigs
zu unterbinden, verständigte sich 1376 der Rat
der Stadt mit dem Blasius-Stift als Grundherrn
im Bereich Ölper wegen der Errichtung der
Landwehr. Nachdem diese vom Raffturm über
das „Pawelsche Holz“ bis zum Südrand Ölpers
fertiggestellt war, kam es zu einer weiteren
Übereinkunft, nach der die Landwehr am
Westrand des Dorfes vorbei - den damaligen
Ölper Turm umschließend - unmittelbar hinter
der Mühle bis an die Oker reichen sollte.
1413 wurde ein steinerner Wachtturm anstelle
des älteren Bergfrieds erbaut, der seit 1368 ur-
kundlich belegt ist. Zwar wurden ab 1432 Pul-
ver und Pfeile hier eingelagert, der Turm mit ei-
nem Torwärter besetzt und „Landwehrreiter“
besoldet, dennoch war es lediglich eine Zollsta-
tion, was auch ein seit 1554 angebauter Krug
belegt; dieser wurde 1642 durch die heutige
Landwehrschänke ersetzt (Celler Heerstraße
46).
Der Rat der Stadt Braunschweig beschloß im
ausgehenden 14.Jh. die Anlage einer äußeren
Befestigungslinie, bestehend aus zwei paralle-
len Erdwällen und drei Gräben. Dort, wo Heer-
straßen die mit Bäumen besetzte Wallanlage
durchschnitten, sicherten Wehrtürme die
Straßen und die zugehörigen Zollstationen ab.
Um ein Umfahren der Zollstationen an den
Nach der Unterwerfung Braunschweigs wurde
der Ölper Turm 1671 der Herzoglichen Verwal-
tung unterstellt, 1680 wiederum der Stadt über-
lassen und 1710 zurückgenommen. 1735 wur-
den der Turm und der angeschlossene Gasthof
mit allen Nebengebäuden verpachtet und ein
Zolleinnehmer eingesetzt. 1765 verkaufte
schließlich die Fürstliche Kammer den Ölper
Turm. Die Landwehr wurde Ende des 18.Jh.
aufgegeben, so daß die Brinksitzer in Ölper an
dieser Stelle ihre Gärten anlegen konnten, die
bis zum westlich gelegenen „Hirtenweg“ reich-
ten. 1825 riß man den steinernen Rundturm ab
und ersetzte ihn durch einen Fachwerkbau mit
Dachansatz - den heutigen neueren Teil des Öl-
per Turms. Anfang der achtziger Jahre dieses
Jahrhunderts wurde bei einer Renovierung das
Innere völlig umgebaut.
Der Ältere Teil von 1642, direkt an der Straßen-
biegung gelegen, hat ein massives Erdgeschoß
- das alte Fachwerk wurde hier auf der Trauf-
seite ersetzt. Am leicht vorkragenden Oberge-
schoß, das in Fachwerk erhalten ist und von
reich verzierten Knaggen abgestützt wird, zei-
gen die gekehlten Füllhölzer ein Muster aus ge-
drehten Tauen mit Perlenbesatz. Die Winkelhöl-
zer sind mit Rautenformen verziert und die
Ständerfüße mit Beschlagwerk gefüllt. Den
oberen Abschluß bilden von Knaggen getra-
gene Balkenköpfe. Die Schmuckformen des
Fachwerkes entsprechen weitgehend denen an
zeitgleich entstandenen Fachwerkhäusern der
Innenstadt.
Der jüngere nördliche Teil wurde in Anlehnung
an die Kubatur des älteren Teils als schlichter
klassizistischer Fachwerkbau mit Risalit errich-
tet, in dessen Achse ein turmartiger Aufsatz in
das Dach eingefügt wurde.
Ölper, Dorfstr. 23, Altvaterhaus, 1828
Ölper, Dorfstr. 5, ehern. Schule, 1835
Ölper, Papenkamp, Friedhofskapelle, 1864
Ölper, Kirchbergstr. 1, Wohnhaus, 1896
228