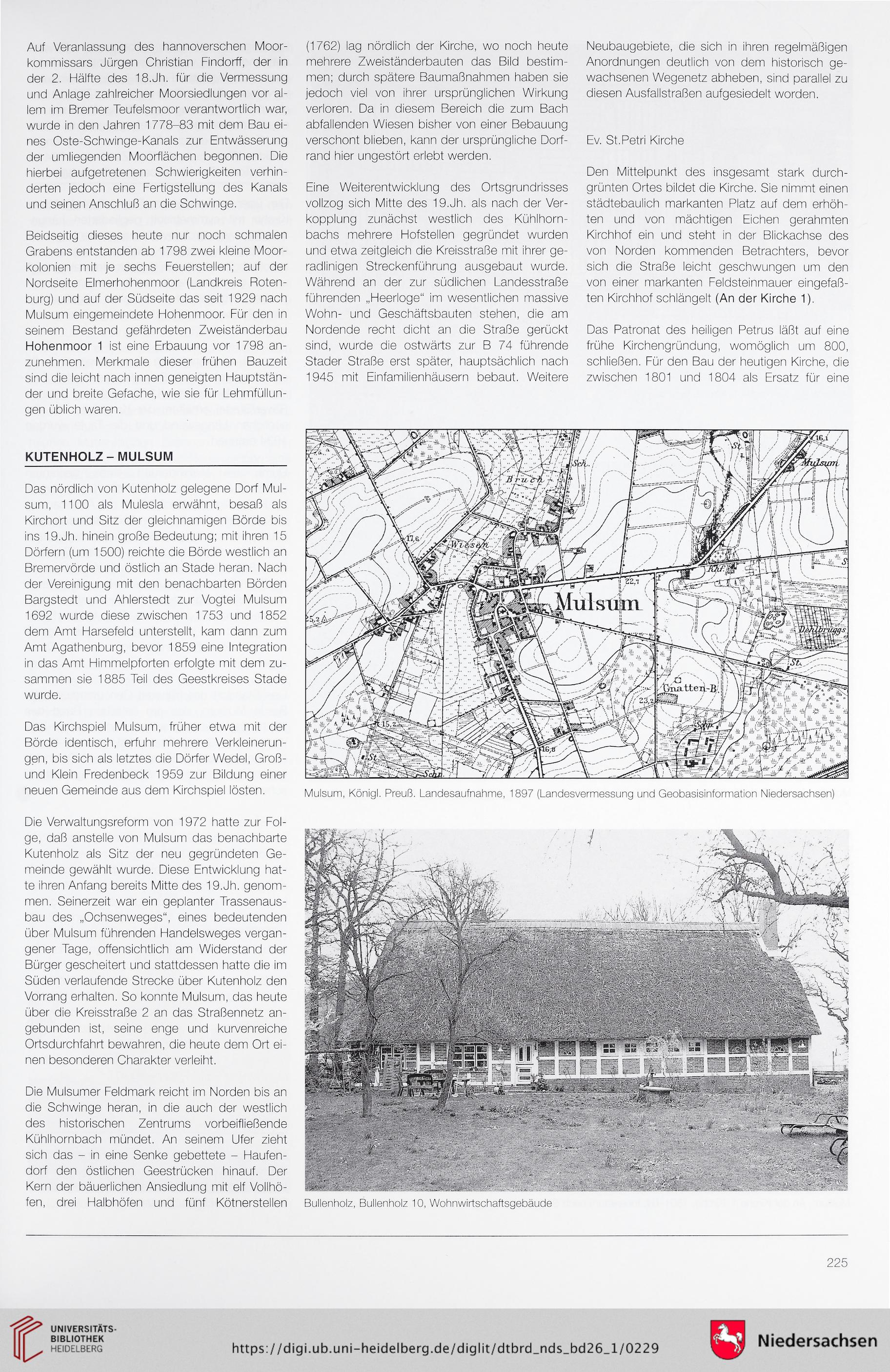Auf Veranlassung des hannoverschen Moor-
kommissars Jürgen Christian Findorff, der in
der 2. Hälfte des 18.Jh. für die Vermessung
und Anlage zahlreicher Moorsiedlungen vor al-
lem im Bremer Teufelsmoor verantwortlich war,
wurde in den Jahren 1778-83 mit dem Bau ei-
nes Oste-Schwinge-Kanals zur Entwässerung
der umliegenden Moorflächen begonnen. Die
hierbei aufgetretenen Schwierigkeiten verhin-
derten jedoch eine Fertigstellung des Kanals
und seinen Anschluß an die Schwinge.
Beidseitig dieses heute nur noch schmalen
Grabens entstanden ab 1798 zwei kleine Moor-
kolonien mit je sechs Feuerstellen; auf der
Nordseite Eimerhohenmoor (Landkreis Roten-
burg) und auf der Südseite das seit 1929 nach
Mulsum eingemeindete Hohenmoor. Für den in
seinem Bestand gefährdeten Zweiständerbau
Hohenmoor 1 ist eine Erbauung vor 1798 an-
zunehmen. Merkmale dieser frühen Bauzeit
sind die leicht nach innen geneigten Hauptstän-
der und breite Gefache, wie sie für Lehmfüllun-
gen üblich waren.
(1762) lag nördlich der Kirche, wo noch heute
mehrere Zweiständerbauten das Bild bestim-
men; durch spätere Baumaßnahmen haben sie
jedoch viel von ihrer ursprünglichen Wirkung
verloren. Da in diesem Bereich die zum Bach
abfallenden Wiesen bisher von einer Bebauung
verschont blieben, kann der ursprüngliche Dorf-
rand hier ungestört erlebt werden.
Eine Weiterentwicklung des Ortsgrundrisses
vollzog sich Mitte des 19.Jh. als nach der Ver-
kopplung zunächst westlich des Kühlhorn-
bachs mehrere Hofstellen gegründet wurden
und etwa zeitgleich die Kreisstraße mit ihrer ge-
radlinigen Streckenführung ausgebaut wurde.
Während an der zur südlichen Landesstraße
führenden „Heerloge“ im wesentlichen massive
Wohn- und Geschäftsbauten stehen, die am
Nordende recht dicht an die Straße gerückt
sind, wurde die ostwärts zur B 74 führende
Stader Straße erst später, hauptsächlich nach
1945 mit Einfamilienhäusern bebaut. Weitere
Neubaugebiete, die sich in ihren regelmäßigen
Anordnungen deutlich von dem historisch ge-
wachsenen Wegenetz abheben, sind parallel zu
diesen Ausfallstraßen aufgesiedelt worden.
Ev. St.Petri Kirche
Den Mittelpunkt des insgesamt stark durch-
grünten Ortes bildet die Kirche. Sie nimmt einen
städtebaulich markanten Platz auf dem erhöh-
ten und von mächtigen Eichen gerahmten
Kirchhof ein und steht in der Blickachse des
von Norden kommenden Betrachters, bevor
sich die Straße leicht geschwungen um den
von einer markanten Feldsteinmauer eingefaß-
ten Kirchhof schlängelt (An der Kirche 1).
Das Patronat des heiligen Petrus läßt auf eine
frühe Kirchengründung, womöglich um 800,
schließen. Für den Bau der heutigen Kirche, die
zwischen 1801 und 1804 als Ersatz für eine
KUTENHOLZ - MULSUM
Das nördlich von Kutenholz gelegene Dorf Mul-
sum, 1100 als Mulesla erwähnt, besaß als
Kirchort und Sitz der gleichnamigen Börde bis
ins 19.Jh. hinein große Bedeutung; mit ihren 15
Dörfern (um 1500) reichte die Börde westlich an
Bremervörde und östlich an Stade heran. Nach
der Vereinigung mit den benachbarten Börden
Bargstedt und Ahlerstedt zur Vogtei Mulsum
1692 wurde diese zwischen 1753 und 1852
dem Amt Harsefeld unterstellt, kam dann zum
Amt Agathenburg, bevor 1859 eine Integration
in das Amt Himmelpforten erfolgte mit dem zu-
sammen sie 1885 Teil des Geestkreises Stade
wurde.
Das Kirchspiel Mulsum, früher etwa mit der
Börde identisch, erfuhr mehrere Verkleinerun-
gen, bis sich als letztes die Dörfer Wedel, Groß-
und Klein Fredenbeck 1959 zur Bildung einer
neuen Gemeinde aus dem Kirchspiel lösten.
Mulsum, Königl. Preuß. Landesaufnahme, 1897 (Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen)
Die Verwaltungsreform von 1972 hatte zur Fol-
ge, daß anstelle von Mulsum das benachbarte
Kutenholz als Sitz der neu gegründeten Ge-
meinde gewählt wurde. Diese Entwicklung hat-
te ihren Anfang bereits Mitte des 19.Jh. genom-
men. Seinerzeit war ein geplanter Trassenaus-
bau des „Ochsenweges“, eines bedeutenden
über Mulsum führenden Handelsweges vergan-
gener Tage, offensichtlich am Widerstand der
Bürger gescheitert und stattdessen hatte die im
Süden verlaufende Strecke über Kutenholz den
Vorrang erhalten. So konnte Mulsum, das heute
über die Kreisstraße 2 an das Straßennetz an-
gebunden ist, seine enge und kurvenreiche
Ortsdurchfahrt bewahren, die heute dem Ort ei-
nen besonderen Charakter verleiht.
Die Mulsumer Feldmark reicht im Norden bis an
die Schwinge heran, in die auch der westlich
des historischen Zentrums vorbeifließende
Kühlhornbach mündet. An seinem Ufer zieht
sich das - in eine Senke gebettete - Haufen-
dorf den östlichen Geestrücken hinauf. Der
Kern der bäuerlichen Ansiedlung mit elf Vollhö-
fen, drei Halbhöfen und fünf Kötnerstellen
Bullenholz, Bullenholz 10, Wohnwirtschaftsgebäude
225
kommissars Jürgen Christian Findorff, der in
der 2. Hälfte des 18.Jh. für die Vermessung
und Anlage zahlreicher Moorsiedlungen vor al-
lem im Bremer Teufelsmoor verantwortlich war,
wurde in den Jahren 1778-83 mit dem Bau ei-
nes Oste-Schwinge-Kanals zur Entwässerung
der umliegenden Moorflächen begonnen. Die
hierbei aufgetretenen Schwierigkeiten verhin-
derten jedoch eine Fertigstellung des Kanals
und seinen Anschluß an die Schwinge.
Beidseitig dieses heute nur noch schmalen
Grabens entstanden ab 1798 zwei kleine Moor-
kolonien mit je sechs Feuerstellen; auf der
Nordseite Eimerhohenmoor (Landkreis Roten-
burg) und auf der Südseite das seit 1929 nach
Mulsum eingemeindete Hohenmoor. Für den in
seinem Bestand gefährdeten Zweiständerbau
Hohenmoor 1 ist eine Erbauung vor 1798 an-
zunehmen. Merkmale dieser frühen Bauzeit
sind die leicht nach innen geneigten Hauptstän-
der und breite Gefache, wie sie für Lehmfüllun-
gen üblich waren.
(1762) lag nördlich der Kirche, wo noch heute
mehrere Zweiständerbauten das Bild bestim-
men; durch spätere Baumaßnahmen haben sie
jedoch viel von ihrer ursprünglichen Wirkung
verloren. Da in diesem Bereich die zum Bach
abfallenden Wiesen bisher von einer Bebauung
verschont blieben, kann der ursprüngliche Dorf-
rand hier ungestört erlebt werden.
Eine Weiterentwicklung des Ortsgrundrisses
vollzog sich Mitte des 19.Jh. als nach der Ver-
kopplung zunächst westlich des Kühlhorn-
bachs mehrere Hofstellen gegründet wurden
und etwa zeitgleich die Kreisstraße mit ihrer ge-
radlinigen Streckenführung ausgebaut wurde.
Während an der zur südlichen Landesstraße
führenden „Heerloge“ im wesentlichen massive
Wohn- und Geschäftsbauten stehen, die am
Nordende recht dicht an die Straße gerückt
sind, wurde die ostwärts zur B 74 führende
Stader Straße erst später, hauptsächlich nach
1945 mit Einfamilienhäusern bebaut. Weitere
Neubaugebiete, die sich in ihren regelmäßigen
Anordnungen deutlich von dem historisch ge-
wachsenen Wegenetz abheben, sind parallel zu
diesen Ausfallstraßen aufgesiedelt worden.
Ev. St.Petri Kirche
Den Mittelpunkt des insgesamt stark durch-
grünten Ortes bildet die Kirche. Sie nimmt einen
städtebaulich markanten Platz auf dem erhöh-
ten und von mächtigen Eichen gerahmten
Kirchhof ein und steht in der Blickachse des
von Norden kommenden Betrachters, bevor
sich die Straße leicht geschwungen um den
von einer markanten Feldsteinmauer eingefaß-
ten Kirchhof schlängelt (An der Kirche 1).
Das Patronat des heiligen Petrus läßt auf eine
frühe Kirchengründung, womöglich um 800,
schließen. Für den Bau der heutigen Kirche, die
zwischen 1801 und 1804 als Ersatz für eine
KUTENHOLZ - MULSUM
Das nördlich von Kutenholz gelegene Dorf Mul-
sum, 1100 als Mulesla erwähnt, besaß als
Kirchort und Sitz der gleichnamigen Börde bis
ins 19.Jh. hinein große Bedeutung; mit ihren 15
Dörfern (um 1500) reichte die Börde westlich an
Bremervörde und östlich an Stade heran. Nach
der Vereinigung mit den benachbarten Börden
Bargstedt und Ahlerstedt zur Vogtei Mulsum
1692 wurde diese zwischen 1753 und 1852
dem Amt Harsefeld unterstellt, kam dann zum
Amt Agathenburg, bevor 1859 eine Integration
in das Amt Himmelpforten erfolgte mit dem zu-
sammen sie 1885 Teil des Geestkreises Stade
wurde.
Das Kirchspiel Mulsum, früher etwa mit der
Börde identisch, erfuhr mehrere Verkleinerun-
gen, bis sich als letztes die Dörfer Wedel, Groß-
und Klein Fredenbeck 1959 zur Bildung einer
neuen Gemeinde aus dem Kirchspiel lösten.
Mulsum, Königl. Preuß. Landesaufnahme, 1897 (Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen)
Die Verwaltungsreform von 1972 hatte zur Fol-
ge, daß anstelle von Mulsum das benachbarte
Kutenholz als Sitz der neu gegründeten Ge-
meinde gewählt wurde. Diese Entwicklung hat-
te ihren Anfang bereits Mitte des 19.Jh. genom-
men. Seinerzeit war ein geplanter Trassenaus-
bau des „Ochsenweges“, eines bedeutenden
über Mulsum führenden Handelsweges vergan-
gener Tage, offensichtlich am Widerstand der
Bürger gescheitert und stattdessen hatte die im
Süden verlaufende Strecke über Kutenholz den
Vorrang erhalten. So konnte Mulsum, das heute
über die Kreisstraße 2 an das Straßennetz an-
gebunden ist, seine enge und kurvenreiche
Ortsdurchfahrt bewahren, die heute dem Ort ei-
nen besonderen Charakter verleiht.
Die Mulsumer Feldmark reicht im Norden bis an
die Schwinge heran, in die auch der westlich
des historischen Zentrums vorbeifließende
Kühlhornbach mündet. An seinem Ufer zieht
sich das - in eine Senke gebettete - Haufen-
dorf den östlichen Geestrücken hinauf. Der
Kern der bäuerlichen Ansiedlung mit elf Vollhö-
fen, drei Halbhöfen und fünf Kötnerstellen
Bullenholz, Bullenholz 10, Wohnwirtschaftsgebäude
225