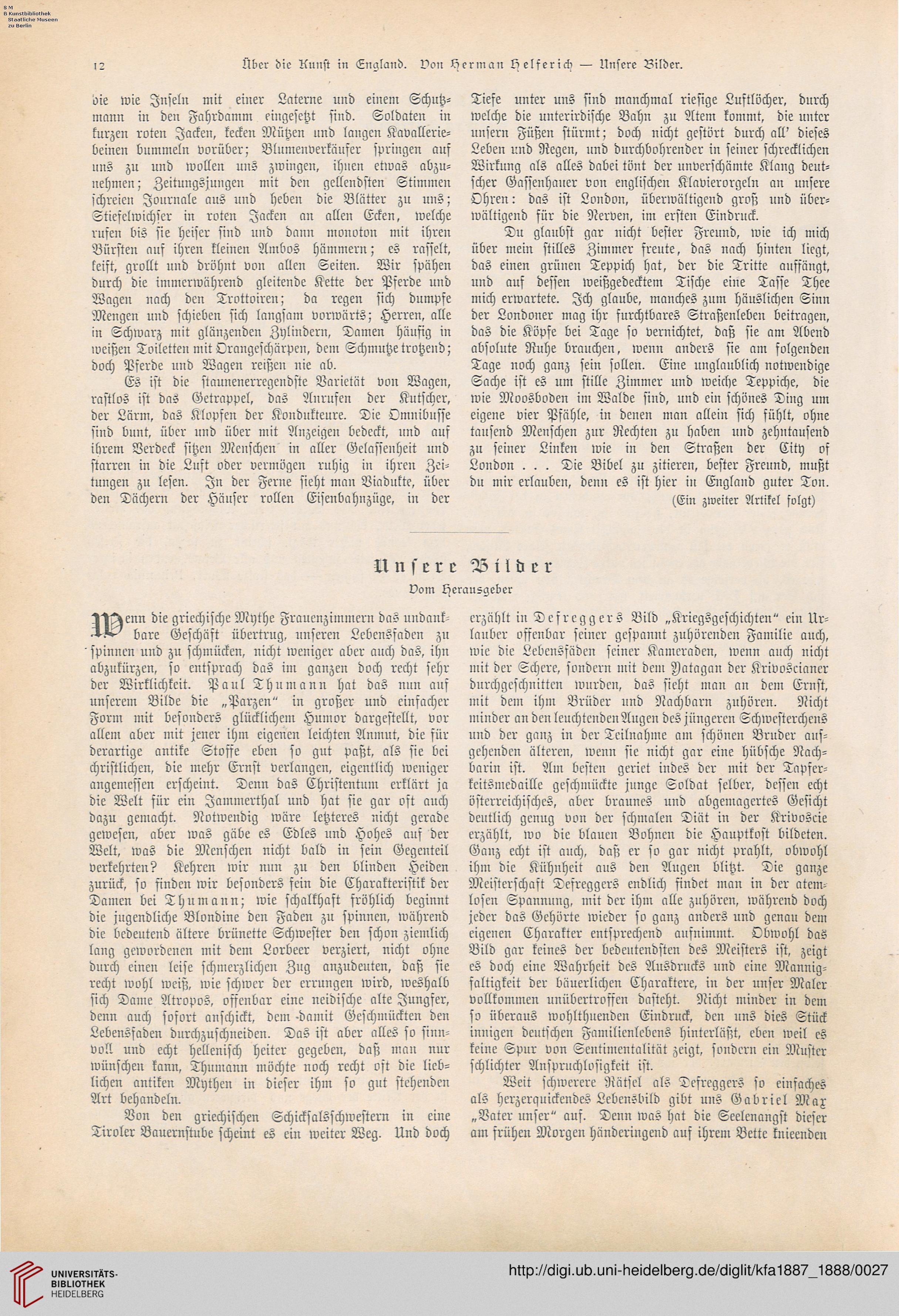12
Über die Kunst in England. von Ycrman Helferich — Unsere Bilder.
die wie Inseln mit einer Laterne und einem Schutz-
mann in den Fahrdamm eingesetzt sind. Soldaten in
kurzen roten Jacken, kecken Mützen und langen Kavallerie-
beinen bummeln vorüber; Blumenverkäufcr springen auf
uns zu und wollen uns zwingen, ihnen etwas abzu-
nehmen; Zeitungsjungen mit den gellendsten Stimmen
schreien Journale aus und heben die Blätter zu uns;
Stiefelwichser in roten Jacken an allen Ecken, welche
rufen bis sie heiser sind und dann monoton mit ihren
Bürsten auf ihren kleinen Ambos hämmern; es rasselt,
keift, grollt und dröhnt von allen Seiten. Wir spähen
durch die immerwährend gleitende Kette der Pferde und
Wagen nach den Trottoiren; da regen sich dumpfe
Mengen und schieben sich langsam vorwärts; Herren, alle
in Schwarz mit glänzenden Zylindern, Damen häufig in
weißen Toiletten mit Orangeschärpen, dem Schmutze trotzend;
doch Pferde und Wagen reißen nie ab.
Es ist die staunenerregendste Varietät von Wagen,
rastlos ist das Getrappel, das Anrufen der Kutscher,
der Lärm, das Klopfen der Kondukteure. Die Omnibusse
sind bunt, über und über mit Anzeigen bedeckt, und auf
ihrem Verdeck sitzen Menschen in aller Gelassenheit und
starren in die Luft oder vermögen ruhig in ihren Zei-
tungen zu lesen. In der Ferne sieht man Viadukte, über
den Dächern der Häuser rollen Eisenbahnzüge, in der
Tiefe unter uns sind manchmal riesige Luftlöcher, durch
welche die unterirdische Bahn zu Atem kommt, die unter
unfern Füßen stürmt; doch nicht gestört durch all' dieses
Leben und Regen, und durchbohrender in seiner schrecklichen
Wirkung als alles dabei tönt der unverschämte Klang deut-
scher Gassenhauer von englischen Klavierorgeln an unsere
Ohren: das ist London, überwältigend groß und über-
wältigend für die Nerven, im ersten Eindruck.
Du glaubst gar nicht bester Freund, wie ich mich
über mein stilles Zimmer freute, das nach hinten liegt,
das einen grünen Teppich hat, der die Tritte auffängt,
und auf dessen weißgedecktem Tische eine Tasse Thee
mich erwartete. Ich glaube, manches zum häuslichen Sinn
der Londoner mag ihr furchtbares Straßenleben beitragen,
das die Köpfe bei Tage so vernichtet, daß sie am Abend
absolute Ruhe brauchen, wenn anders sie am folgenden
Tage noch ganz sein sollen. Eine unglaublich notwendige
Sache ist es um stille Zimmer und weiche Teppiche, die
wie Moosboden im Walde sind, und ein schönes Ding um
eigene vier Pfähle, in denen man allein sich fühlt, ohne
tausend Menschen zur Rechten zu haben und zehntausend
zu seiner Linken wie in den Straßen der City of
London . . . Die Bibel zu zitieren, bester Freund, mußt
du mir erlauben, denn es ist hier in England guter Ton.
(Ein zweiter Artikel folgt)
Unsere N d c r
vom Herausgeber
enn die griechische Mythe Frauenzimmern das undank-
bare Geschäft übertrug, unseren Lebensfaden zu
spinnen und zu schmücken, nicht weniger aber auch das, ihn
abzukürzen, so entsprach das im ganzen doch recht sehr
der Wirklichkeit. Paul Thu mann hat das nun auf
unserem Bilde die „Parzen" in großer und einfacher
Form mit besonders glücklichem Humor dargestellt, vor
allem aber mit jener ihm eigenen leichten Anmut, die für
derartige antike Stoffe eben so gut paßt, als sie bei
christlichen, die mehr Ernst verlangen, eigentlich weniger
angemessen erscheint. Denn das Christentum erklärt ja
die Welt für ein Jammerthal und hat sie gar oft auch
dazu gemacht. Notwendig wäre letzteres nicht gerade
gewesen, aber was gäbe es Edles und Hohes auf der
Welt, was die Menschen nicht bald in sein Gegenteil
verkehrten? Kehren wir nun zu den blinden Heiden
zurück, so finden wir besonders fein die Charakteristik der
Damen bei Thumann; wie schalkhaft fröhlich beginnt
die jugendliche Blondine den Faden zu spinnen, während
die bedeutend ältere brünette Schwester den schon ziemlich
lang gewordenen mit dem Lorbeer verziert, nicht ohne
durch einen leise schmerzlichen Zug anzudeuten, daß sie
recht wohl weiß, wie schwer der errungen wird, weshalb
sich Dame Atropos, offenbar eine neidische alte Jungfer,
denn auch sofort anschickt, dem -damit Geschmückten den
Lebensfaden durchzuschneiden. Das ist aber alles so sinn-
voll und echt hellenisch heiter gegeben, daß man nur
wünschen kann, Thumann möchte noch recht oft die lieb-
lichen antiken Mythen in dieser ihm so gut stehenden
Art behandeln.
Von den griechischen Schicksalsschwestern in eine
Tiroler Bauernstube scheint es ein weiter Weg. Und doch
erzählt in Defreggers Bild „Kriegsgeschichten" ein Ur-
lauber offenbar seiner gespannt zuhörenden Familie auch,
wie die Lebensfäden seiner Kameraden, wenn auch nicht
mit der Schere, sondern mit dem Jatagan der Krivoscianer
durchgeschnitten wurden, das sieht man an dem Ernst,
mit dem ihm Brüder und Nachbarn zuhören. Nicht
minder an den leuchtenden Augen des jüngeren Schwesterchens
und der ganz in der Teilnahme am schönen Bruder aus-
gehenden älteren, wenn sie nicht gar eine hübsche Nach-
barin ist. Am besten geriet indes der mit der Tapfer-
keitsmedaille geschmückte junge Soldat selber, dessen echt
österreichisches, aber braunes und abgemagertes Gesicht
deutlich genug von der schmalen Diät in der Krivoscie
erzählt, wo die blauen Bohnen die Hauptkost bildeten.
Ganz echt ist auch, daß er so gar nicht prahlt, obwohl
ihm die Kühnheit ans den Augen blitzt. Die ganze
Meisterschaft Defreggers endlich findet man in der atem-
losen Spannung, mit der ihm alle zuhörcn, während doch
jeder das Gehörte wieder so ganz anders und genau dem
eigenen Charakter entsprechend aufnimmt. Obwohl das
Bild gar keines der bedeutendsten des Meisters ist, zeigt
es doch eine Wahrheit des Ausdrucks und eine Mannig-
faltigkeit der bäuerlichen Charaktere, in der unser Maler
vollkommen unübertroffen dasteht. Nicht minder in dem
so überaus wohlthuendcn Eindruck, den uns dies Stück
innigen deutschen Familienlebens hinterläßt, eben weil es
keine Spur von Sentimentalität zeigt, sondern ein Muster
schlichter Anspruchlvsigkeit ist.
Weit schwerere Rätsel als Defreggers so einfaches
als herzerquickendes Lebensbild gibt uns Gabriel Max
„Vater unser" auf. Denn was hat die Seelenangst dieser
am frühen Morgen händeringend auf ihrem Bette knieenden
Über die Kunst in England. von Ycrman Helferich — Unsere Bilder.
die wie Inseln mit einer Laterne und einem Schutz-
mann in den Fahrdamm eingesetzt sind. Soldaten in
kurzen roten Jacken, kecken Mützen und langen Kavallerie-
beinen bummeln vorüber; Blumenverkäufcr springen auf
uns zu und wollen uns zwingen, ihnen etwas abzu-
nehmen; Zeitungsjungen mit den gellendsten Stimmen
schreien Journale aus und heben die Blätter zu uns;
Stiefelwichser in roten Jacken an allen Ecken, welche
rufen bis sie heiser sind und dann monoton mit ihren
Bürsten auf ihren kleinen Ambos hämmern; es rasselt,
keift, grollt und dröhnt von allen Seiten. Wir spähen
durch die immerwährend gleitende Kette der Pferde und
Wagen nach den Trottoiren; da regen sich dumpfe
Mengen und schieben sich langsam vorwärts; Herren, alle
in Schwarz mit glänzenden Zylindern, Damen häufig in
weißen Toiletten mit Orangeschärpen, dem Schmutze trotzend;
doch Pferde und Wagen reißen nie ab.
Es ist die staunenerregendste Varietät von Wagen,
rastlos ist das Getrappel, das Anrufen der Kutscher,
der Lärm, das Klopfen der Kondukteure. Die Omnibusse
sind bunt, über und über mit Anzeigen bedeckt, und auf
ihrem Verdeck sitzen Menschen in aller Gelassenheit und
starren in die Luft oder vermögen ruhig in ihren Zei-
tungen zu lesen. In der Ferne sieht man Viadukte, über
den Dächern der Häuser rollen Eisenbahnzüge, in der
Tiefe unter uns sind manchmal riesige Luftlöcher, durch
welche die unterirdische Bahn zu Atem kommt, die unter
unfern Füßen stürmt; doch nicht gestört durch all' dieses
Leben und Regen, und durchbohrender in seiner schrecklichen
Wirkung als alles dabei tönt der unverschämte Klang deut-
scher Gassenhauer von englischen Klavierorgeln an unsere
Ohren: das ist London, überwältigend groß und über-
wältigend für die Nerven, im ersten Eindruck.
Du glaubst gar nicht bester Freund, wie ich mich
über mein stilles Zimmer freute, das nach hinten liegt,
das einen grünen Teppich hat, der die Tritte auffängt,
und auf dessen weißgedecktem Tische eine Tasse Thee
mich erwartete. Ich glaube, manches zum häuslichen Sinn
der Londoner mag ihr furchtbares Straßenleben beitragen,
das die Köpfe bei Tage so vernichtet, daß sie am Abend
absolute Ruhe brauchen, wenn anders sie am folgenden
Tage noch ganz sein sollen. Eine unglaublich notwendige
Sache ist es um stille Zimmer und weiche Teppiche, die
wie Moosboden im Walde sind, und ein schönes Ding um
eigene vier Pfähle, in denen man allein sich fühlt, ohne
tausend Menschen zur Rechten zu haben und zehntausend
zu seiner Linken wie in den Straßen der City of
London . . . Die Bibel zu zitieren, bester Freund, mußt
du mir erlauben, denn es ist hier in England guter Ton.
(Ein zweiter Artikel folgt)
Unsere N d c r
vom Herausgeber
enn die griechische Mythe Frauenzimmern das undank-
bare Geschäft übertrug, unseren Lebensfaden zu
spinnen und zu schmücken, nicht weniger aber auch das, ihn
abzukürzen, so entsprach das im ganzen doch recht sehr
der Wirklichkeit. Paul Thu mann hat das nun auf
unserem Bilde die „Parzen" in großer und einfacher
Form mit besonders glücklichem Humor dargestellt, vor
allem aber mit jener ihm eigenen leichten Anmut, die für
derartige antike Stoffe eben so gut paßt, als sie bei
christlichen, die mehr Ernst verlangen, eigentlich weniger
angemessen erscheint. Denn das Christentum erklärt ja
die Welt für ein Jammerthal und hat sie gar oft auch
dazu gemacht. Notwendig wäre letzteres nicht gerade
gewesen, aber was gäbe es Edles und Hohes auf der
Welt, was die Menschen nicht bald in sein Gegenteil
verkehrten? Kehren wir nun zu den blinden Heiden
zurück, so finden wir besonders fein die Charakteristik der
Damen bei Thumann; wie schalkhaft fröhlich beginnt
die jugendliche Blondine den Faden zu spinnen, während
die bedeutend ältere brünette Schwester den schon ziemlich
lang gewordenen mit dem Lorbeer verziert, nicht ohne
durch einen leise schmerzlichen Zug anzudeuten, daß sie
recht wohl weiß, wie schwer der errungen wird, weshalb
sich Dame Atropos, offenbar eine neidische alte Jungfer,
denn auch sofort anschickt, dem -damit Geschmückten den
Lebensfaden durchzuschneiden. Das ist aber alles so sinn-
voll und echt hellenisch heiter gegeben, daß man nur
wünschen kann, Thumann möchte noch recht oft die lieb-
lichen antiken Mythen in dieser ihm so gut stehenden
Art behandeln.
Von den griechischen Schicksalsschwestern in eine
Tiroler Bauernstube scheint es ein weiter Weg. Und doch
erzählt in Defreggers Bild „Kriegsgeschichten" ein Ur-
lauber offenbar seiner gespannt zuhörenden Familie auch,
wie die Lebensfäden seiner Kameraden, wenn auch nicht
mit der Schere, sondern mit dem Jatagan der Krivoscianer
durchgeschnitten wurden, das sieht man an dem Ernst,
mit dem ihm Brüder und Nachbarn zuhören. Nicht
minder an den leuchtenden Augen des jüngeren Schwesterchens
und der ganz in der Teilnahme am schönen Bruder aus-
gehenden älteren, wenn sie nicht gar eine hübsche Nach-
barin ist. Am besten geriet indes der mit der Tapfer-
keitsmedaille geschmückte junge Soldat selber, dessen echt
österreichisches, aber braunes und abgemagertes Gesicht
deutlich genug von der schmalen Diät in der Krivoscie
erzählt, wo die blauen Bohnen die Hauptkost bildeten.
Ganz echt ist auch, daß er so gar nicht prahlt, obwohl
ihm die Kühnheit ans den Augen blitzt. Die ganze
Meisterschaft Defreggers endlich findet man in der atem-
losen Spannung, mit der ihm alle zuhörcn, während doch
jeder das Gehörte wieder so ganz anders und genau dem
eigenen Charakter entsprechend aufnimmt. Obwohl das
Bild gar keines der bedeutendsten des Meisters ist, zeigt
es doch eine Wahrheit des Ausdrucks und eine Mannig-
faltigkeit der bäuerlichen Charaktere, in der unser Maler
vollkommen unübertroffen dasteht. Nicht minder in dem
so überaus wohlthuendcn Eindruck, den uns dies Stück
innigen deutschen Familienlebens hinterläßt, eben weil es
keine Spur von Sentimentalität zeigt, sondern ein Muster
schlichter Anspruchlvsigkeit ist.
Weit schwerere Rätsel als Defreggers so einfaches
als herzerquickendes Lebensbild gibt uns Gabriel Max
„Vater unser" auf. Denn was hat die Seelenangst dieser
am frühen Morgen händeringend auf ihrem Bette knieenden