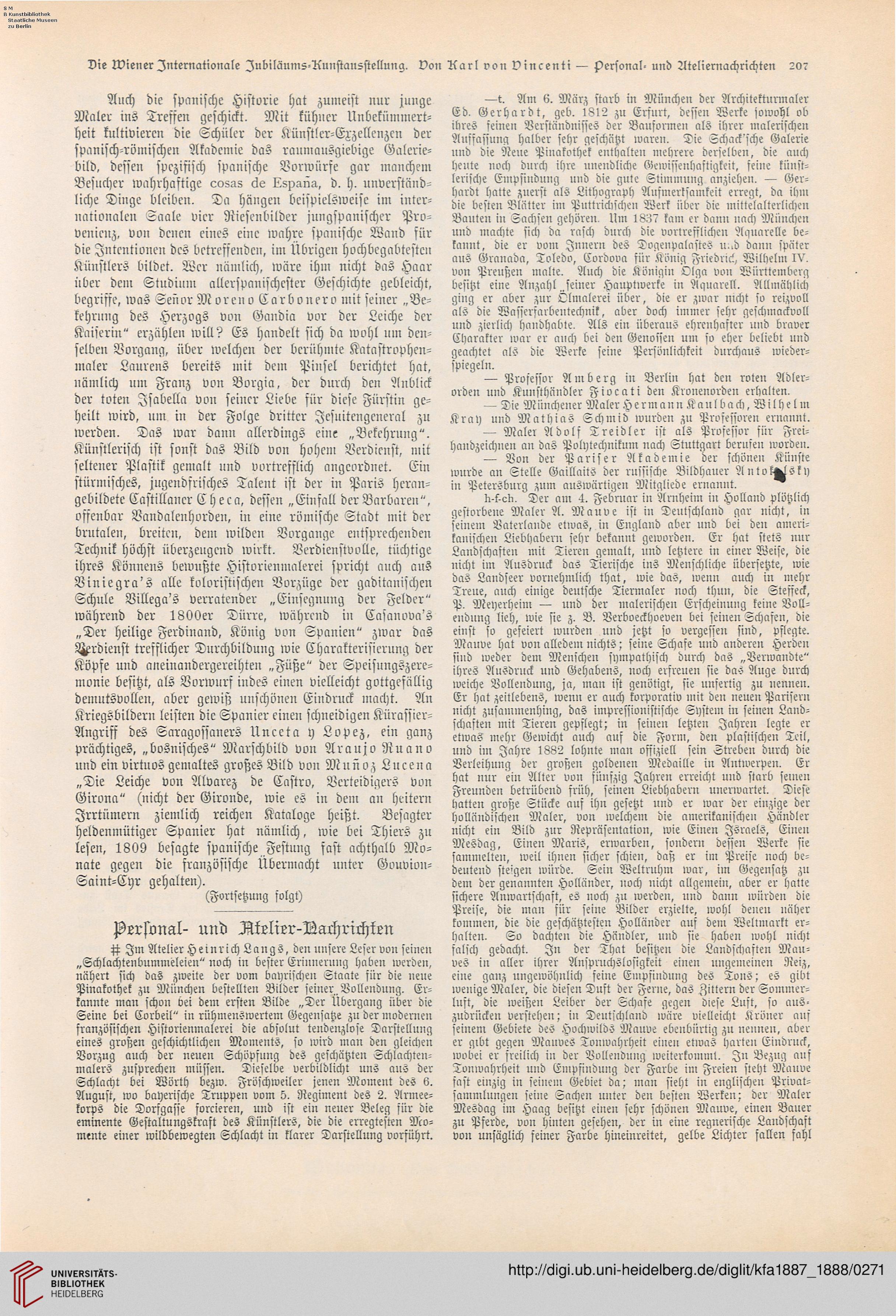Die Wiener Internationale Iubiläums-Kunstansstellung. von Karl von vincenti — Personal- und Ateliernachrichten 207
Auch die spanische Historie hat zumeist nur junge
Maler ins Treffen geschickt. Mit kühner Unbekümmert-
heit kultivieren die Schüler der Künstler-Exzellenzen der
spanisch-römischen Akademie das ranmansgiebige Galerie-
bild, dessen spezifisch spanische Vorwürfe gar manchem
Besucher wahrhaftige cosas cke Kspunu, d. h. unverständ-
liche Dinge bleiben. Da hängen beispielsweise im inter-
nationalen Saale vier Riesenbilder jungspanischer Pro-
venienz, von denen eines eine wahre spanische Wand für
die Intentionen des betreffenden, im Übrigen hochbegabteste»
Künstlers bildet. Wer nämlich, wäre ihm nicht das Haar
über dem Studium allerspanischcster Geschichte gebleicht,
begriffe, was Tenor M oren 0 Carbonero mit seiner „Be-
kehrung des Herzogs von Gandia vor der Leiche der
Kaiserin" erzählen will? Es handelt sich da wohl um den-
selben Vorgang, über welchen der berühmte Katastrophen-
maler Laurens bereits mit dem Pinsel berichtet hat,
nämlich um Franz von Borgia, der durch den Anblick
der toten Jsabella von seiner Liebe für diese Fürstin ge-
heilt wird, um in der Folge dritter Jesnitengeneral zu
werden. Das war dann allerdings eine „Bekehrung".
Künstlerisch ist sonst das Bild von hohem Verdienst, niit
seltener Plastik gemalt und vortrefflich angcordnet. Ein
stürmisches, jugendfrisches Talent ist der in Paris heran-
gebildete Castillancr Checa, dessen „Einfall der Barbaren",
offenbar Vandalenhorden, in eine römische Stadt mit der
brutalen, breiten, dem wilden Vorgänge entsprechenden
Technik höchst überzeugend wirkt. Verdienstvolle, tüchtige
ihres Könnens bewußte Historienmalerei spricht auch ans
Viniegra's alle koloristischen Vorzüge der gaditanischen
Schule Villega's verratender „Einsegnung der Felder"
während der 1800er Dürre, während in Casanova's
„Der heilige Ferdinand, König von Spanien" zwar das
sjjprdienst trefflicher Durchbildung wie Charakterisierung der
Köpfe und aneinandergereihten „Füße" der Speisungszere-
monie besitzt, als Vorwurf indes einen vielleicht gottgefällig
demutsvollen, aber gewiß unschönen Eindruck macht. An
Kriegsbildern leisten die Spanier einen schneidigen Kürassier-
Angriff des Saragossaners llnceta y Lopez, ein ganz
prächtiges, „bosnisches" Marschbild von Araujo Ruano
und ein virtuos genialtes großes Bild von Mnnoz Lucena
„Die Leiche von Alvarez de Castro, Verteidigers von
Girona" (nicht der Gironde, wie es in dem an heitern
Jrrtiimern ziemlich reichen Kataloge heißt. Besagter
heldenmütiger Spanier hat nämlich, wie bei Thiers zu
lesen, 1809 besagte spanische Festung fast achthalb Mo-
nate gegen die französische Übermacht unter Gouvivn-
Saint-Cyr gehalten).
(Fortsetzung folgt)
Personal- und Mrlirr-Nachrichien
Pt Im Atelier Heinrich Längs, den unsere Leser von seinen
„Schlachtenbummeleien" noch in bester Erinnerung haben werden,
nähert sich das zweite der vom bayrischen Staate sür die neue
Pinakothek zu München bestellten Bilder seiner, Vollendung. Er-
kannte man schon bei dem ersten Bilde „Der Übergang über die
Seine bei Corbeil" in rühmenswertem Gegensätze zu der modernen
französischen Historienmalerei die absolut teudenzlose Darstellung
eines großen geschichtlichen Moments, so wird man den gleichen
Vorzug auch der neuen Schöpfung des geschätzten Schlachten-
malers zusprechen müssen. Dieselbe verbildlicht uns aus der
Schlacht bei Wörth bezw. Fröschweiler jenen Moment des 6.
August, wo bayerische Truppen vom 5. Regiment des 2. Armee-
korps die Dorfgasse forcieren, und ist ein neuer Beleg für die
eminente Gestaltungskraft des Künstlers, die die erregtesten Mo-
mente einer wildbewegten Schlacht in klarer Darstellung vorführt.
—t. Am 6. März starb in München der Architekturmaler
Ed. Gerhardt, geb. 1812 zu Erfurt, dessen Werke sowohl ob
ibres feinen Verständnisses der Bauformeii als ihrer malerischen
Ansfassung halber sehr geschätzt waren. Die Schack'sche Galerie
und die Nene Pinakothek enthalten mehrere derselben, die auch
heute noch durch ihre unendliche Gewissenhaftigkeit, feine künst-
lerische Empsindung und die gute Stimmung anzieheu. — Ger-
hardt hatte zuerst als Lithograph Aufmerksamkeit erregt, da ihm
die besten Blätter im Puttricln'chc» Werk über die mittelalterlichen
Bauten in Sachsen gehöre». Um 1837 kam er dann nach München
und machte sich da rasch durch die vortrefflichen Aquarelle be-
kannt, die er vom Innern des Dogenpalastes rn.d dann später
aus Granada, Toledo, Cordova für König Friedrich Wilhelm IV.
von Preußen malte. Auch die Königin Olga von Württemberg
besitzt eine Anzahl „seiner Hauptwerke in Aquarell. Allmählich
ging er aber zur Ölmalerei über, die er zwar nicht so reizvoll
als die Wasserfarbentechnik, aber doch immer sehr geschmackvoll
und zierlich handhabte. Als ein überaus ehrenhafter und braver
Charakter war er auch bei den Genossen um so eher beliebt und
geachtet als die Werke seine Persönlichkeit durchaus wieder-
spiegeln.
— Professor Amberg in Berlin hat den roten Adler-
orden und Kunsthändler Fivcati den Kronenorden erhalten.
— Die Münchener MalerHermannKaulbach, Wilhelm
Kray und Mathias Schmid wurden zu Professoren ernannt.
— Maler Adolf Treidler ist als Professor für Frei-
handzeichnen an das Polytechnikum nach Stuttgart berufe» worden.
— Von der Pariser Akademie der schönen Künste
wurde an Stelle GaillaitS der russische Bildhauer AntotMsky
in Petersburg zum auswärtigen Mitglieds ernannt.
ü-f-cb. Der am 4. Februar in Arnheim in Holland plötzlich
gestorbene Maler A. Mauve ist in Deutschland gar nicht, in
seinem Vaterlande etwas, in England aber und bei den ameri-
kanischen Liebhabern sehr bekannt geworden. Er hat stets nur
Landschaften mit Tieren gemalt, rind letztere in einer Weise, die
nicht i», Ausdruck das Tierische ins Menschliche übersetzte, wie
das Landseer vornehmlich that, wie das, wenn auch in mehr
Treue, auch einige deutsche Tiermaler noch thun, die Steffeck,
P. Meyerheim — und der malerischen Erscheinung keine Voll-
endung lieh, wie sie z. B. Verboeckhoeven bei seinen Schafen, die
einst so gefeiert wurden und jetzt so vergessen sind, pflegte.
Mauve hat von alledem nichts; seine Schafe und anderen Herden
sind weder dem Menschen sympathisch durch das „Verwandte"
ihres Ausdruck und Gehabens, noch erfreuen sie das Auge durch
weiche Vollendung, ja, man ist genötigt, sie unfertig zu nennen.
Er hat zeitlebens, wenn er auch korporativ mit den neuen Parisern
nicht zusammenhing, das impressionistische System in seinen Land-
schaften mit Tieren gepflegt; in seinen letzten Jahren legte er
etwas mehr Gewicht auch auf die Form, den plastischen Teil,
und im Jahre 1882 lohnte man offiziell sein Streben durch die
Verleihung der großen goldenen Medaille in Antwerpen. Er
hat nur ein Alter von fünfzig Jahren erreicht und starb seinen
Freunden betrübend früh, seinen Liebhabern unerwartet. Diese
hatten große Stücke auf ihn gesetzt und er war der einzige der
holländischen Maler, von welchem die amerikanischen Händler
nicht ein Bild zur Repräsentation, wie Einen Israels, Einen
Mesdag, Einen Maris, erwarben, sondern dessen Werke sie
sammelten, weil ihnen sicher schien, daß er im Preise noch be-
deutend steigen würde. Sein Weltruhm war, im Gegensatz zu
dem der genannten Holländer, noch nicht allgemein, aber er hatte
sichere Anwartschaft, es noch zu werden, und dann würden die
Preise, die man für seine Bilder erzielte, wohl denen näher
kommen, die die geschätztesten Holländer auf dem Weltmarkt er-
halten. So dachten die Händler, und sie habe» wohl nicht
falsch gedacht. In der That besitzen die Landschaften Man-
ves in aller ihrer Anspruchslosigkeit einen ungemeinen Reiz,
eine ganz ungewöhnlich feine Empfindung des Tons; es gibt
wenige Maler, die diesen Duft der Ferne, das Zittern der Sommer-
luft, die weißen Leiber der Schafe gegen diese Luft, so aus-
zudrücken verstehen; in Deutschland wäre vielleicht Kröner auf
seinem Gebiete des Hochwilds Mauve ebenbürtig zu nennen, aber
er gibt gegen Mauves Tonwahrheit einen etwas harten Eindruck,
wobei er freilich in der Vollendung weiterkommt. In Bezug auf
Tonwahrheit und Empfindung der Farbe in, Freien steht Mauve
fast einzig in seinem Gebiet da; man sieht in englischen Prival-
sammlungen seine Sachen unter den besten Werken; der Maler
Mesdag im Haag besitzt einen sehr schönen Mauve, einen Bauer
zu Pferde, von hinten gesehen, der in eine regnerische Landschaft
von unsäglich seiner Farbe hineinreitet, gelbe Lichter fallen fahl
Auch die spanische Historie hat zumeist nur junge
Maler ins Treffen geschickt. Mit kühner Unbekümmert-
heit kultivieren die Schüler der Künstler-Exzellenzen der
spanisch-römischen Akademie das ranmansgiebige Galerie-
bild, dessen spezifisch spanische Vorwürfe gar manchem
Besucher wahrhaftige cosas cke Kspunu, d. h. unverständ-
liche Dinge bleiben. Da hängen beispielsweise im inter-
nationalen Saale vier Riesenbilder jungspanischer Pro-
venienz, von denen eines eine wahre spanische Wand für
die Intentionen des betreffenden, im Übrigen hochbegabteste»
Künstlers bildet. Wer nämlich, wäre ihm nicht das Haar
über dem Studium allerspanischcster Geschichte gebleicht,
begriffe, was Tenor M oren 0 Carbonero mit seiner „Be-
kehrung des Herzogs von Gandia vor der Leiche der
Kaiserin" erzählen will? Es handelt sich da wohl um den-
selben Vorgang, über welchen der berühmte Katastrophen-
maler Laurens bereits mit dem Pinsel berichtet hat,
nämlich um Franz von Borgia, der durch den Anblick
der toten Jsabella von seiner Liebe für diese Fürstin ge-
heilt wird, um in der Folge dritter Jesnitengeneral zu
werden. Das war dann allerdings eine „Bekehrung".
Künstlerisch ist sonst das Bild von hohem Verdienst, niit
seltener Plastik gemalt und vortrefflich angcordnet. Ein
stürmisches, jugendfrisches Talent ist der in Paris heran-
gebildete Castillancr Checa, dessen „Einfall der Barbaren",
offenbar Vandalenhorden, in eine römische Stadt mit der
brutalen, breiten, dem wilden Vorgänge entsprechenden
Technik höchst überzeugend wirkt. Verdienstvolle, tüchtige
ihres Könnens bewußte Historienmalerei spricht auch ans
Viniegra's alle koloristischen Vorzüge der gaditanischen
Schule Villega's verratender „Einsegnung der Felder"
während der 1800er Dürre, während in Casanova's
„Der heilige Ferdinand, König von Spanien" zwar das
sjjprdienst trefflicher Durchbildung wie Charakterisierung der
Köpfe und aneinandergereihten „Füße" der Speisungszere-
monie besitzt, als Vorwurf indes einen vielleicht gottgefällig
demutsvollen, aber gewiß unschönen Eindruck macht. An
Kriegsbildern leisten die Spanier einen schneidigen Kürassier-
Angriff des Saragossaners llnceta y Lopez, ein ganz
prächtiges, „bosnisches" Marschbild von Araujo Ruano
und ein virtuos genialtes großes Bild von Mnnoz Lucena
„Die Leiche von Alvarez de Castro, Verteidigers von
Girona" (nicht der Gironde, wie es in dem an heitern
Jrrtiimern ziemlich reichen Kataloge heißt. Besagter
heldenmütiger Spanier hat nämlich, wie bei Thiers zu
lesen, 1809 besagte spanische Festung fast achthalb Mo-
nate gegen die französische Übermacht unter Gouvivn-
Saint-Cyr gehalten).
(Fortsetzung folgt)
Personal- und Mrlirr-Nachrichien
Pt Im Atelier Heinrich Längs, den unsere Leser von seinen
„Schlachtenbummeleien" noch in bester Erinnerung haben werden,
nähert sich das zweite der vom bayrischen Staate sür die neue
Pinakothek zu München bestellten Bilder seiner, Vollendung. Er-
kannte man schon bei dem ersten Bilde „Der Übergang über die
Seine bei Corbeil" in rühmenswertem Gegensätze zu der modernen
französischen Historienmalerei die absolut teudenzlose Darstellung
eines großen geschichtlichen Moments, so wird man den gleichen
Vorzug auch der neuen Schöpfung des geschätzten Schlachten-
malers zusprechen müssen. Dieselbe verbildlicht uns aus der
Schlacht bei Wörth bezw. Fröschweiler jenen Moment des 6.
August, wo bayerische Truppen vom 5. Regiment des 2. Armee-
korps die Dorfgasse forcieren, und ist ein neuer Beleg für die
eminente Gestaltungskraft des Künstlers, die die erregtesten Mo-
mente einer wildbewegten Schlacht in klarer Darstellung vorführt.
—t. Am 6. März starb in München der Architekturmaler
Ed. Gerhardt, geb. 1812 zu Erfurt, dessen Werke sowohl ob
ibres feinen Verständnisses der Bauformeii als ihrer malerischen
Ansfassung halber sehr geschätzt waren. Die Schack'sche Galerie
und die Nene Pinakothek enthalten mehrere derselben, die auch
heute noch durch ihre unendliche Gewissenhaftigkeit, feine künst-
lerische Empsindung und die gute Stimmung anzieheu. — Ger-
hardt hatte zuerst als Lithograph Aufmerksamkeit erregt, da ihm
die besten Blätter im Puttricln'chc» Werk über die mittelalterlichen
Bauten in Sachsen gehöre». Um 1837 kam er dann nach München
und machte sich da rasch durch die vortrefflichen Aquarelle be-
kannt, die er vom Innern des Dogenpalastes rn.d dann später
aus Granada, Toledo, Cordova für König Friedrich Wilhelm IV.
von Preußen malte. Auch die Königin Olga von Württemberg
besitzt eine Anzahl „seiner Hauptwerke in Aquarell. Allmählich
ging er aber zur Ölmalerei über, die er zwar nicht so reizvoll
als die Wasserfarbentechnik, aber doch immer sehr geschmackvoll
und zierlich handhabte. Als ein überaus ehrenhafter und braver
Charakter war er auch bei den Genossen um so eher beliebt und
geachtet als die Werke seine Persönlichkeit durchaus wieder-
spiegeln.
— Professor Amberg in Berlin hat den roten Adler-
orden und Kunsthändler Fivcati den Kronenorden erhalten.
— Die Münchener MalerHermannKaulbach, Wilhelm
Kray und Mathias Schmid wurden zu Professoren ernannt.
— Maler Adolf Treidler ist als Professor für Frei-
handzeichnen an das Polytechnikum nach Stuttgart berufe» worden.
— Von der Pariser Akademie der schönen Künste
wurde an Stelle GaillaitS der russische Bildhauer AntotMsky
in Petersburg zum auswärtigen Mitglieds ernannt.
ü-f-cb. Der am 4. Februar in Arnheim in Holland plötzlich
gestorbene Maler A. Mauve ist in Deutschland gar nicht, in
seinem Vaterlande etwas, in England aber und bei den ameri-
kanischen Liebhabern sehr bekannt geworden. Er hat stets nur
Landschaften mit Tieren gemalt, rind letztere in einer Weise, die
nicht i», Ausdruck das Tierische ins Menschliche übersetzte, wie
das Landseer vornehmlich that, wie das, wenn auch in mehr
Treue, auch einige deutsche Tiermaler noch thun, die Steffeck,
P. Meyerheim — und der malerischen Erscheinung keine Voll-
endung lieh, wie sie z. B. Verboeckhoeven bei seinen Schafen, die
einst so gefeiert wurden und jetzt so vergessen sind, pflegte.
Mauve hat von alledem nichts; seine Schafe und anderen Herden
sind weder dem Menschen sympathisch durch das „Verwandte"
ihres Ausdruck und Gehabens, noch erfreuen sie das Auge durch
weiche Vollendung, ja, man ist genötigt, sie unfertig zu nennen.
Er hat zeitlebens, wenn er auch korporativ mit den neuen Parisern
nicht zusammenhing, das impressionistische System in seinen Land-
schaften mit Tieren gepflegt; in seinen letzten Jahren legte er
etwas mehr Gewicht auch auf die Form, den plastischen Teil,
und im Jahre 1882 lohnte man offiziell sein Streben durch die
Verleihung der großen goldenen Medaille in Antwerpen. Er
hat nur ein Alter von fünfzig Jahren erreicht und starb seinen
Freunden betrübend früh, seinen Liebhabern unerwartet. Diese
hatten große Stücke auf ihn gesetzt und er war der einzige der
holländischen Maler, von welchem die amerikanischen Händler
nicht ein Bild zur Repräsentation, wie Einen Israels, Einen
Mesdag, Einen Maris, erwarben, sondern dessen Werke sie
sammelten, weil ihnen sicher schien, daß er im Preise noch be-
deutend steigen würde. Sein Weltruhm war, im Gegensatz zu
dem der genannten Holländer, noch nicht allgemein, aber er hatte
sichere Anwartschaft, es noch zu werden, und dann würden die
Preise, die man für seine Bilder erzielte, wohl denen näher
kommen, die die geschätztesten Holländer auf dem Weltmarkt er-
halten. So dachten die Händler, und sie habe» wohl nicht
falsch gedacht. In der That besitzen die Landschaften Man-
ves in aller ihrer Anspruchslosigkeit einen ungemeinen Reiz,
eine ganz ungewöhnlich feine Empfindung des Tons; es gibt
wenige Maler, die diesen Duft der Ferne, das Zittern der Sommer-
luft, die weißen Leiber der Schafe gegen diese Luft, so aus-
zudrücken verstehen; in Deutschland wäre vielleicht Kröner auf
seinem Gebiete des Hochwilds Mauve ebenbürtig zu nennen, aber
er gibt gegen Mauves Tonwahrheit einen etwas harten Eindruck,
wobei er freilich in der Vollendung weiterkommt. In Bezug auf
Tonwahrheit und Empfindung der Farbe in, Freien steht Mauve
fast einzig in seinem Gebiet da; man sieht in englischen Prival-
sammlungen seine Sachen unter den besten Werken; der Maler
Mesdag im Haag besitzt einen sehr schönen Mauve, einen Bauer
zu Pferde, von hinten gesehen, der in eine regnerische Landschaft
von unsäglich seiner Farbe hineinreitet, gelbe Lichter fallen fahl