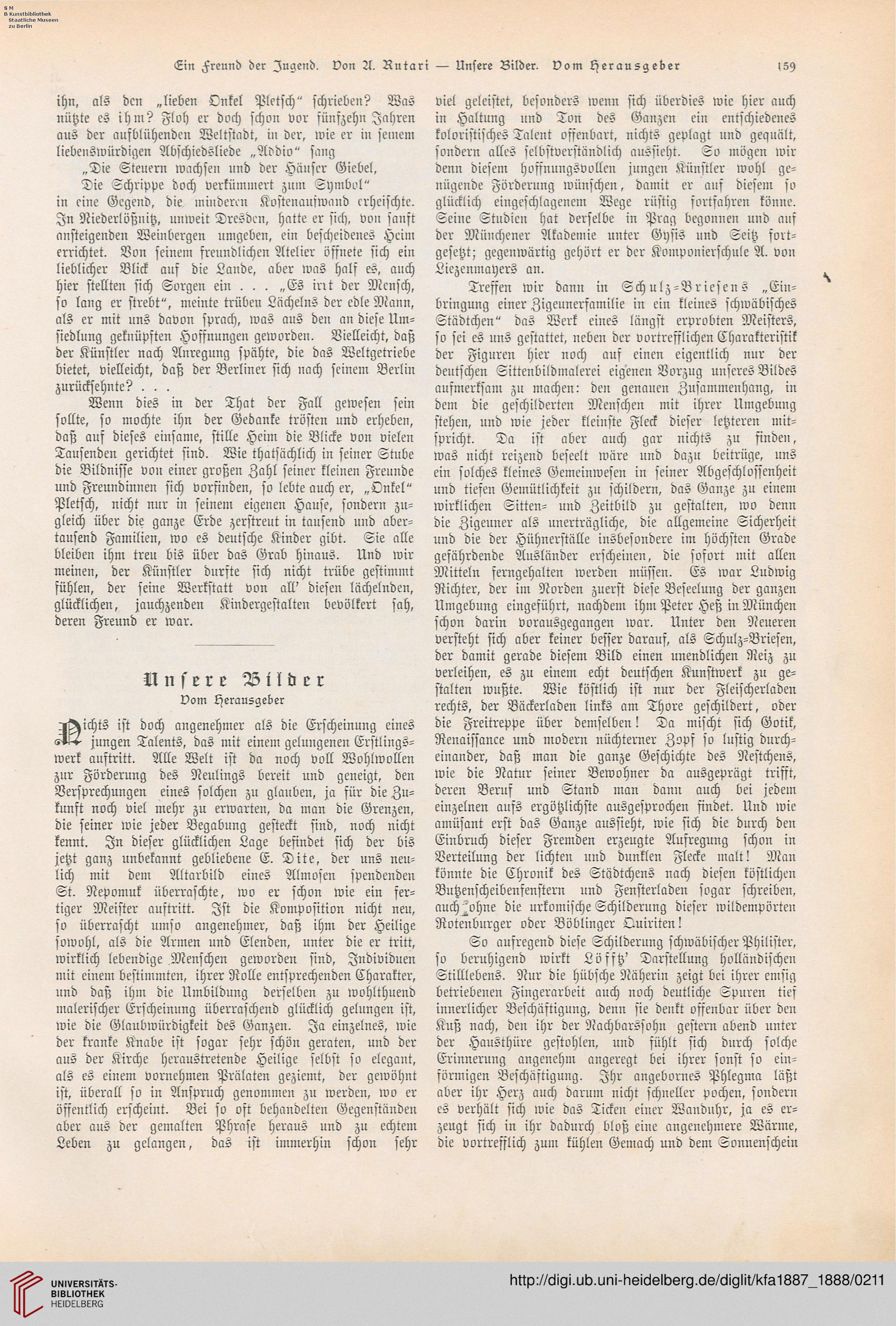Lin Freund der Jugend, von A. Rutari — Unsere Bilder, vom Herausgeber
>5?
ihn, als den „lieben Onkel Pletsch" schrieben? Was
nützte es ihm? Floh er doch schon vor fünfzehn Jahren
aus der aufblühenden Weltstadt, in der, wie er in seinem
liebenswürdigen Abschiedsliede „Addio" sang
„Die Steuern wachsen und der Häuser Giebel,
Die Schrippe doch verkümmert zum Symbol"
in eine Gegend, die minderen Kostenaufwand erheischte.
In Niederlößnitz, unweit Dresden, hatte er sich, von sanft
ansteigenden Weinbergen umgeben, ein bescheidenes Heim
errichtet. Von seinem freundlichen Atelier öffnete sich ein
lieblicher Blick auf die Lande, aber was half es, auch
hier stellten sich Sorgen ein . . . „Es irrt der Mensch,
so lang er strebt", meinte trüben Lächelns der edle Mann,
als er mit uns davon sprach, was aus deu an diese Um-
siedlung geknüpften Hoffnungen geworden. Vielleicht, daß
der Künstler nach Anregung spähte, die das Weltgetriebe
bietet, vielleicht, daß der Berliner sich nach seinem Berlin
zurücksehnte? . . .
Wenn dies in der That der Fall gewesen sein
sollte, so mochte ihn der Gedanke trösten und erheben,
daß auf dieses einsame, stille Heim die Blicke von vielen
Tausenden gerichtet sind. Wie thatsächlich in seiner Stube
die Bildnisse von einer großen Zahl seiner kleinen Freunde
und Freundinnen sich vorfinden, so lebte auch er, „Onkel"
Pletsch, nicht nur in seinem eigenen Hause, sondern zu-
gleich über die ganze Erde zerstreut in tausend und aber-
tausend Familien, wo es deutsche Kinder gibt. Sie alle
bleiben ihm treu bis über das Grab hinaus. Und wir
meinen, der Künstler durfte sich nicht trübe gestimmt
fühlen, der seine Werkstatt von all' diesen lächelnden,
glücklichen, jauchzenden Kindergestalten bevölkert sah,
deren Freund er war.
Unsere Bilder
Vom Herausgeber
.Lichts ist doch angenehmer als die Erscheinung eines
jungen Talents, das mit einem gelungenen Erstlings-
werk austritt. Alle Welt ist da noch voll Wohlwollen
zur Förderung des Neulings bereit und geneigt, den
Versprechungen eines solchen zu glauben, ja für die Zu-
kunft noch viel mehr zu erwarten, da man die Grenzen,
die seiner wie jeder Begabung gesteckt sind, noch nicht
kennt. In dieser glücklichen Lage befindet sich der bis
jetzt ganz unbekannt gebliebene E. Dite, der uns neu-
lich mit dem Altarbild eines Almosen spendenden
St. Nepomuk überraschte, wo er schon wie ein fer-
tiger Meister austritt. Ist die Komposition nicht neu,
so überrascht umso angenehmer, daß ihm der Heilige
sowohl, als die Armen und Elenden, unter die er tritt,
wirklich lebendige Menschen geworden sind, Individuen
mit einem bestimmten, ihrer Rolle entsprechenden Charakter,
und daß ihm die Umbildung derselben zu wohlthuend
malerischer Erscheinung überraschend glücklich gelungen ist,
Ivie die Glaubwürdigkeit des Ganzen. Ja einzelnes, wie
der kranke Knabe ist sogar sehr schön geraten, und der
aus der Kirche heraustretende Heilige selbst so elegant,
als es einem vornehmen Prälaten geziemt, der gewöhnt
ist, überall so in Anspruch genommen zu werden, wo er
öffentlich erscheint. Bei so oft behandelten Gegenständen
aber aus der gemalten Phrase heraus und zu echtem
Leben zu gelangen, das ist immerhin schon sehr
viel geleistet, besonders wenn sich überdies wie hier auch
in Haltung und Ton des Ganzen ein entschiedenes
koloristisches Talent offenbart, nichts geplagt und gequält,
sondern alles selbstverständlich aussieht. So mögen wir
denn diesem hoffnungsvollen jungen Künstler wohl ge-
nügende Förderung wünschen, damit er auf diesem so
glücklich eingeschlagenem Wege rüstig fortfahrcn könne.
Seine Studien hat derselbe in Prag begonnen und auf
der Münchener Akademie unter Gysis und Seitz fort-
gesetzt; gegenwärtig gehört er der Kompouierschule A. von
Liezenmayers an.
Treffen wir dann in Schulz-Briesens „Ein-
bringung einer Zigeunerfamilie in ein kleines schwäbisches
Städtchen" das Werk eines längst erprobten Meisters,
so sei es uns gestattet, neben der vortrefflichen Charakteristik
der Figuren hier noch auf einen eigentlich nur der
deutschen Sittenbildmalerei eigenen Vorzug unseres Bildes
aufmerksam zu machen: den genauen Zusammenhang, in
dem die geschilderten Menschen mit ihrer Umgebung
stehen, und wie jeder kleinste Fleck dieser letzteren mit-
spricht. Da ist aber auch gar nichts zu finden,
was nicht reizend beseelt wäre und dazu beitrüge, uns
ein solches kleines Gemeinwesen in seiner Abgeschlossenheit
und tiefen Gemütlichkeit zu schildern, das Ganze zu einem
wirklichen Sitten- und Zeitbild zu gestalten, wo denn
die Zigeuner als unerträgliche, die allgemeine Sicherheit
und die der Hühnerställe insbesondere im höchsten Grade
gefährdende Ausländer erscheinen, die sofort mit allen
Mitteln ferngehalten werden müssen. Es war Ludwig
Richter, der im Norden zuerst diese Beseelung der ganzen
Umgebung eingeführt, nachdem ihm Peter Heß in München
schon darin vorausgegangen war. Unter den Neueren
versteht sich aber keiner besser darauf, als Schulz-Briefen,
der damit gerade diesem Bild einen unendlichen Reiz zu
verleihen, es zu einem echt deutschen Kunstwerk zu ge-
stalten wußte. Wie köstlich ist nur der Fleischerladen
rechts, der Bäckerladen links am Thore geschildert, oder
die Freitreppe über demselben! Da mischt sich Gotik,
Renaissance und modern nüchterner Zopf so lustig durch-
einander, daß man die ganze Geschichte des Nestchens,
wie die Natur seiner Bewohner da ausgeprägt trifft,
deren Beruf und Stand man dann auch bei jedem
einzelnen aufs ergötzlichste ausgesprochen findet. Und wie
amüsant erst das Ganze aussieht, wie sich die durch den
Einbruch dieser Fremden erzeugte Aufregung schon in
Verteilung der lichten und dunklen Flecke malt! Mau
könnte die Chronik des Städtchens nach diesen köstlichen
Butzenscheibenfenstern und Fensterladen sogar schreiben,
auch lohne die urkomische Schilderung dieser wildempörten
Rotenburger oder Böblinger Quirlten!
So aufregend diese Schilderung schwäbischer Philister,
so beruhigend wirkt Löfftz' Darstellung holländischen
Stilllebens. Nur die hübsche Näherin zeigt bei ihrer emsig
betriebenen Fingerarbeit auch noch deutliche Spuren tief
innerlicher Beschäftigung, denn sie denkt offenbar über den
Kuß nach, den ihr der Nachbarssohn gestern abend unter
der Hausthüre gestohlen, und fühlt sich durch solche
Erinnerung angenehm angeregt bei ihrer sonst so ein-
förmigen Beschäftigung. Ihr angebornes Phlegma läßt
aber ihr Herz auch darum nicht schneller pochen, sondern
es verhält sich wie das Ticken einer Wanduhr, ja es er-
zeugt sich in ihr dadurch bloß eine angenehmere Wärme,
die vortrefflich zum kühlen Gemach und dem Sonnenschein
>5?
ihn, als den „lieben Onkel Pletsch" schrieben? Was
nützte es ihm? Floh er doch schon vor fünfzehn Jahren
aus der aufblühenden Weltstadt, in der, wie er in seinem
liebenswürdigen Abschiedsliede „Addio" sang
„Die Steuern wachsen und der Häuser Giebel,
Die Schrippe doch verkümmert zum Symbol"
in eine Gegend, die minderen Kostenaufwand erheischte.
In Niederlößnitz, unweit Dresden, hatte er sich, von sanft
ansteigenden Weinbergen umgeben, ein bescheidenes Heim
errichtet. Von seinem freundlichen Atelier öffnete sich ein
lieblicher Blick auf die Lande, aber was half es, auch
hier stellten sich Sorgen ein . . . „Es irrt der Mensch,
so lang er strebt", meinte trüben Lächelns der edle Mann,
als er mit uns davon sprach, was aus deu an diese Um-
siedlung geknüpften Hoffnungen geworden. Vielleicht, daß
der Künstler nach Anregung spähte, die das Weltgetriebe
bietet, vielleicht, daß der Berliner sich nach seinem Berlin
zurücksehnte? . . .
Wenn dies in der That der Fall gewesen sein
sollte, so mochte ihn der Gedanke trösten und erheben,
daß auf dieses einsame, stille Heim die Blicke von vielen
Tausenden gerichtet sind. Wie thatsächlich in seiner Stube
die Bildnisse von einer großen Zahl seiner kleinen Freunde
und Freundinnen sich vorfinden, so lebte auch er, „Onkel"
Pletsch, nicht nur in seinem eigenen Hause, sondern zu-
gleich über die ganze Erde zerstreut in tausend und aber-
tausend Familien, wo es deutsche Kinder gibt. Sie alle
bleiben ihm treu bis über das Grab hinaus. Und wir
meinen, der Künstler durfte sich nicht trübe gestimmt
fühlen, der seine Werkstatt von all' diesen lächelnden,
glücklichen, jauchzenden Kindergestalten bevölkert sah,
deren Freund er war.
Unsere Bilder
Vom Herausgeber
.Lichts ist doch angenehmer als die Erscheinung eines
jungen Talents, das mit einem gelungenen Erstlings-
werk austritt. Alle Welt ist da noch voll Wohlwollen
zur Förderung des Neulings bereit und geneigt, den
Versprechungen eines solchen zu glauben, ja für die Zu-
kunft noch viel mehr zu erwarten, da man die Grenzen,
die seiner wie jeder Begabung gesteckt sind, noch nicht
kennt. In dieser glücklichen Lage befindet sich der bis
jetzt ganz unbekannt gebliebene E. Dite, der uns neu-
lich mit dem Altarbild eines Almosen spendenden
St. Nepomuk überraschte, wo er schon wie ein fer-
tiger Meister austritt. Ist die Komposition nicht neu,
so überrascht umso angenehmer, daß ihm der Heilige
sowohl, als die Armen und Elenden, unter die er tritt,
wirklich lebendige Menschen geworden sind, Individuen
mit einem bestimmten, ihrer Rolle entsprechenden Charakter,
und daß ihm die Umbildung derselben zu wohlthuend
malerischer Erscheinung überraschend glücklich gelungen ist,
Ivie die Glaubwürdigkeit des Ganzen. Ja einzelnes, wie
der kranke Knabe ist sogar sehr schön geraten, und der
aus der Kirche heraustretende Heilige selbst so elegant,
als es einem vornehmen Prälaten geziemt, der gewöhnt
ist, überall so in Anspruch genommen zu werden, wo er
öffentlich erscheint. Bei so oft behandelten Gegenständen
aber aus der gemalten Phrase heraus und zu echtem
Leben zu gelangen, das ist immerhin schon sehr
viel geleistet, besonders wenn sich überdies wie hier auch
in Haltung und Ton des Ganzen ein entschiedenes
koloristisches Talent offenbart, nichts geplagt und gequält,
sondern alles selbstverständlich aussieht. So mögen wir
denn diesem hoffnungsvollen jungen Künstler wohl ge-
nügende Förderung wünschen, damit er auf diesem so
glücklich eingeschlagenem Wege rüstig fortfahrcn könne.
Seine Studien hat derselbe in Prag begonnen und auf
der Münchener Akademie unter Gysis und Seitz fort-
gesetzt; gegenwärtig gehört er der Kompouierschule A. von
Liezenmayers an.
Treffen wir dann in Schulz-Briesens „Ein-
bringung einer Zigeunerfamilie in ein kleines schwäbisches
Städtchen" das Werk eines längst erprobten Meisters,
so sei es uns gestattet, neben der vortrefflichen Charakteristik
der Figuren hier noch auf einen eigentlich nur der
deutschen Sittenbildmalerei eigenen Vorzug unseres Bildes
aufmerksam zu machen: den genauen Zusammenhang, in
dem die geschilderten Menschen mit ihrer Umgebung
stehen, und wie jeder kleinste Fleck dieser letzteren mit-
spricht. Da ist aber auch gar nichts zu finden,
was nicht reizend beseelt wäre und dazu beitrüge, uns
ein solches kleines Gemeinwesen in seiner Abgeschlossenheit
und tiefen Gemütlichkeit zu schildern, das Ganze zu einem
wirklichen Sitten- und Zeitbild zu gestalten, wo denn
die Zigeuner als unerträgliche, die allgemeine Sicherheit
und die der Hühnerställe insbesondere im höchsten Grade
gefährdende Ausländer erscheinen, die sofort mit allen
Mitteln ferngehalten werden müssen. Es war Ludwig
Richter, der im Norden zuerst diese Beseelung der ganzen
Umgebung eingeführt, nachdem ihm Peter Heß in München
schon darin vorausgegangen war. Unter den Neueren
versteht sich aber keiner besser darauf, als Schulz-Briefen,
der damit gerade diesem Bild einen unendlichen Reiz zu
verleihen, es zu einem echt deutschen Kunstwerk zu ge-
stalten wußte. Wie köstlich ist nur der Fleischerladen
rechts, der Bäckerladen links am Thore geschildert, oder
die Freitreppe über demselben! Da mischt sich Gotik,
Renaissance und modern nüchterner Zopf so lustig durch-
einander, daß man die ganze Geschichte des Nestchens,
wie die Natur seiner Bewohner da ausgeprägt trifft,
deren Beruf und Stand man dann auch bei jedem
einzelnen aufs ergötzlichste ausgesprochen findet. Und wie
amüsant erst das Ganze aussieht, wie sich die durch den
Einbruch dieser Fremden erzeugte Aufregung schon in
Verteilung der lichten und dunklen Flecke malt! Mau
könnte die Chronik des Städtchens nach diesen köstlichen
Butzenscheibenfenstern und Fensterladen sogar schreiben,
auch lohne die urkomische Schilderung dieser wildempörten
Rotenburger oder Böblinger Quirlten!
So aufregend diese Schilderung schwäbischer Philister,
so beruhigend wirkt Löfftz' Darstellung holländischen
Stilllebens. Nur die hübsche Näherin zeigt bei ihrer emsig
betriebenen Fingerarbeit auch noch deutliche Spuren tief
innerlicher Beschäftigung, denn sie denkt offenbar über den
Kuß nach, den ihr der Nachbarssohn gestern abend unter
der Hausthüre gestohlen, und fühlt sich durch solche
Erinnerung angenehm angeregt bei ihrer sonst so ein-
förmigen Beschäftigung. Ihr angebornes Phlegma läßt
aber ihr Herz auch darum nicht schneller pochen, sondern
es verhält sich wie das Ticken einer Wanduhr, ja es er-
zeugt sich in ihr dadurch bloß eine angenehmere Wärme,
die vortrefflich zum kühlen Gemach und dem Sonnenschein