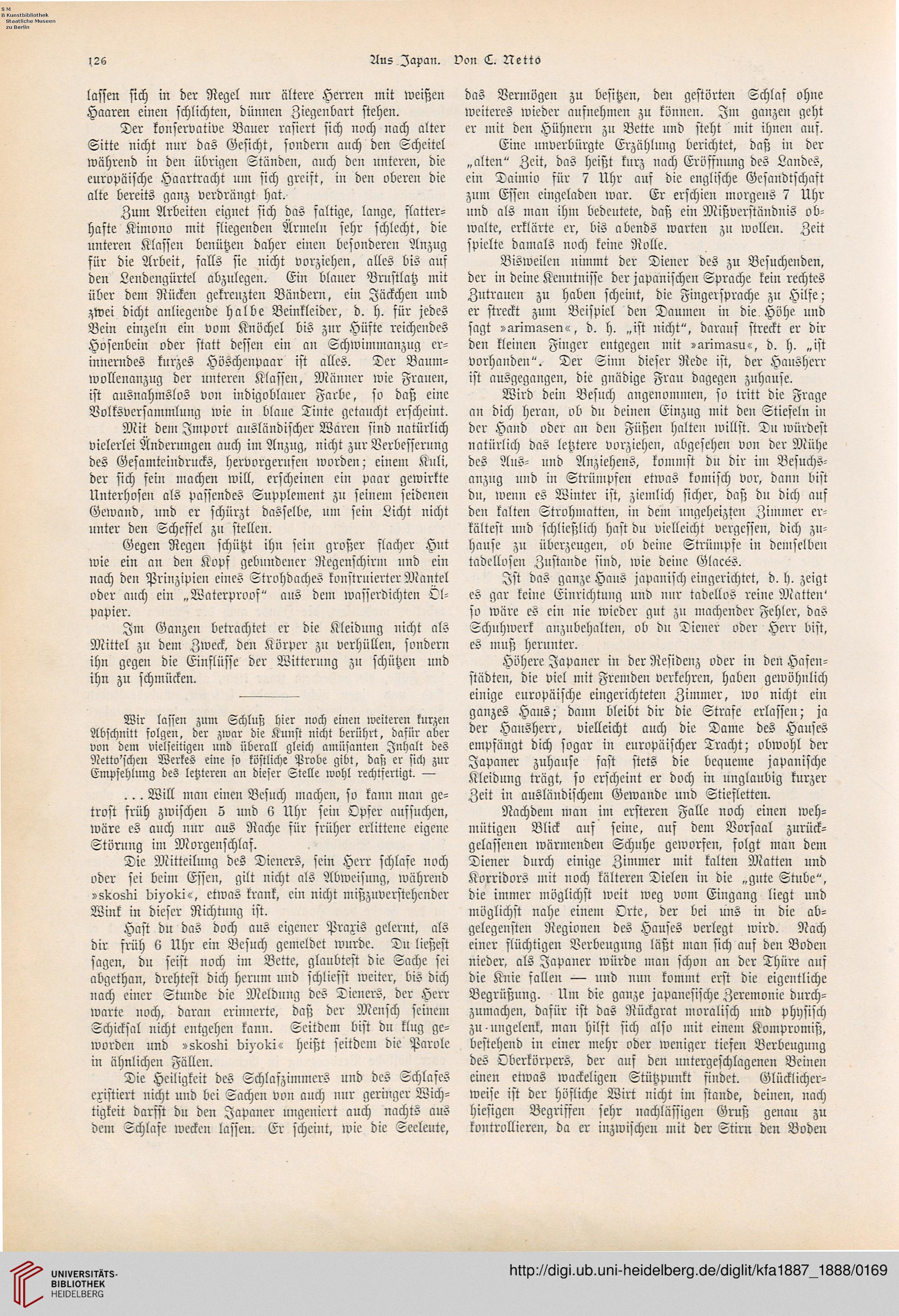,26
Aus Japan, von L. Netto
lassen sich in der Regel nur ältere Herren mit weißen
Haaren einen schlichten, dünnen Ziegenbart stehen.
Der konservative Bauer rasiert sich noch nach alter
Sitte nicht nur das Gesicht, sondern auch den Scheitel
während in den übrigen Ständen, auch den unteren, die
europäische Haartracht um sich greift, in den oberen die
alte bereits ganz verdrängt hat.
Zum Arbeiten eignet sich das faltige, lange, flatter-
hafte Kimono mit fliegenden Ärmeln sehr schlecht, die
unteren Klassen benützen daher einen besonderen Anzug
für die Arbeit, falls sie nicht vorziehen, alles bis auf
den Lendengürtel abznlegen. Ein blauer Brustlatz mit
über dem Rücken gekreuzten Bändern, ein Jäckchen und
zwei dicht anliegende halbe Beinkleider, d. h. für jedes
Bein einzeln ein vom Knöchel bis zur Hüfte reichendes
Hosenbein oder statt dessen ein au Schwimmanzug er-
innerndes kurzes Höschenpaar ist alles. Der Baum-
wollenanzug der unteren Klassen, Männer wie Frauen,
ist ausnahmslos von indigoblauer Farbe, so daß eine
Volksversammlung wie in blaue Tinte getaucht erscheint.
Mit dem Import ausländischer Waren sind natürlich
vielerlei Änderungen auch im Anzug, nicht zur Verbesserung
des Gesamteiudrucks, hervorgerufen worden; einem Kuli,
der sich fein machen will, erscheinen ei» paar gewirkte
Unterhosen als passendes Supplement zu seinem seidenen
Gewand, und er schürzt dasselbe, um sein Licht nicht
unter den Scheffel zu stellen.
Gegen Regen schützt ihn sein großer flacher Hut
wie ein an den Kopf gebundener Regenschirm und ein
nach den Prinzipien eines Strohdaches konstruierter Mantel
oder auch ein „Waterproof" aus dem wasserdichten Öl-
papier.
Im Ganzen betrachtet er die Kleidung nicht als
Mittel zu dem Zweck, den Körper zu verhüllen, sondern
ihn gegen die Einflüsse der Witterung zu schützen und
ihn zu schmücken.
Wir lassen zum Schluß hier noch einen weiteren kurzen
Abschnitt folgen, der zwar die Kunst nicht berührt, dafür aber
von dem vielseitigen und überall gleich amüsanten Inhalt des
Netto'schen Werkes eine so köstliche Probe gibt, daß er sich zur
Empfehlung des letzteren an dieser Stelle wohl rechtfertigt. —
_Will man einen Besuch machen, so kann man ge-
trost früh zwischen 5 und 6 Uhr sein Opfer aufsuchen,
wäre es auch nur aus Rache für früher erlittene eigene
Störung im Morgenschlaf.
Die Mitteilung des Dieners, sein Herr schlafe noch
oder sei beim Essen, gilt nicht als Abweisung, während
»sllosbi di)'0Üi«, etwas krank, ein nicht mißzuverstehender
Wink in dieser Richtung ist.
Hast du das doch aus eigener Praxis gelernt, als
dir früh 6 Uhr ein Besuch gemeldet wurde. Du ließest
sagen, du seist noch im Bette, glaubtest die Sache sei
abgethan, drehtest dich herum und schliefst weiter, bis dich
nach einer Stunde die Meldung des Dieners, der Herr
warte noch, daran erinnerte, daß der Mensch seinem
Schicksal nicht entgehen kann. Seitdem bist du klug ge-
worden und »sllosbi bixolli« heißt seitdem die Parole
in ähnlichen Fällen.
Die Heiligkeit des Schlafzimmers und des Schlafes
existiert nicht und bei Sachen von auch nur geringer Wich-
tigkeit darfst du den Japaner ungeniert auch nachts aus
dem Schlafe wecken lassen. Er scheint, wie die Seeleute,
das Vermögen zu besitzen, den gestörten Schlaf ohne
weiteres wieder aufnehmen zu können. Im ganzen geht
er mit den Hühnern zu Bette und steht mit ihnen auf.
Eine unverbürgte Erzählung berichtet, daß in der
„alten" Zeit, das heißt kurz nach Eröffnung des Landes,
ein Damno für 7 Uhr auf die englische Gesandtschaft
zum Essen eingeladen war. Er erschien morgens 7 Uhr
und als man ihm bedeutete, daß ein Mißverständnis ob-
walte, erklärte er, bis abends warten zu wollen. Zeit
spielte damals noch keine Rolle.
Bisweilen nimmt der Diener des zu Besuchenden,
der in deine Kenntnisse der japanischen Sprache kein rechtes
Zutrauen zu haben scheint, die Fingersprache zu Hilfe;
er streckt zum Beispiel den Daumen in die Höhe, und
sagt »arimnsen«, d. h. „ist nicht", darauf streckt er dir
den kleinen Finger entgegen mit »urimasu«, d. h. „ist
vorhanden". Der Sinn dieser Rede ist, der Hausherr
ist ausgegangen, die gnädige Frau dagegen zuhause.
Wird dein Besuch angenommen, so tritt die Frage
au dich heran, ob du deinen Einzug mit den Stiefeln in
der Hand oder an den Füßen halten willst. Du würdest
natürlich das letztere vorzichen, abgesehen von der Mühe
des Aus- und Anziehens, kommst du dir im Besuchs-
anzug und in Strümpfen etwas komisch vor, dann bist
du, wenn es Winter ist, ziemlich sicher, daß du dich ans
den kalten Strohmatten, in dem ungeheizten Zimmer er-
kältest und schließlich hast du vielleicht vergessen, dich zu-
hause zu überzeugen, ob deine Strümpfe in demselben
tadellosen Zustande sind, wie deine Glaces.
Ist das ganze Hans japanisch eingerichtet, d. h. zeigt
es gar keine Einrichtung und nur tadellos reine Matten'
so wäre es ein nie wieder gut zu machender Fehler, das
Schuhwerk anzubehaltcn, ob du Diener oder Herr bist,
es muß herunter.
Höhere Japaner in der Residenz oder in den Hafen-
städten, die viel mit Fremden Verkehren, haben gewöhnlich
einige europäische eingerichteten Zimmer, wo nicht ein
ganzes Haus; dann bleibt dir die Strafe erlassen; ja
der Hausherr, vielleicht auch die Dame des Hauses
empfängt dich sogar in europäischer Tracht; obwohl der
Japaner zuhause fast stets die bequeme japanische
Kleidung trägt, so erscheint er doch in ungläubig kurzer
Zeit in ausländischem Gewände und Stiefletten.
Nachdem man im ersteren Falle noch einen weh-
mütigen Blick auf seine, auf dem Vorsaal zurück-
gelassenen wärmenden Schuhe geworfen, folgt man dem
Diener durch einige Zimmer mit kalten Matten und
Korridors mit noch kälteren Dielen in die „gute Stube",
die immer möglichst weit weg vom Eingang liegt und
möglichst nahe einem Orte, der bei uns in die ab-
gelegensten Regionen des Hauses verlegt wird. Nach
einer flüchtigen Verbeugung läßt man sich auf den Boden
nieder, als Japaner würde man schon an der Thüre auf
die Knie fallen — und nun kommt erst die eigentliche
Begrüßung. Um die ganze japanesische Zeremonie durch-
zumachen, dafür ist das Rückgrat moralisch und physisch
zu-ungelenk, man hilft sich also mit einem Kompromiß,
bestehend in einer mehr oder weniger tiefen Verbeugung
des Oberkörpers, der auf den untergeschlagenen Beinen
einen etwas wackeligen Stützpunkt findet. Glücklicher-
weise ist der höfliche Wirt nicht im stände, deinen, nach
hiesigen Begriffen sehr nachlässigen Gruß genau zu
kontrollieren, da er inzwischen mit der Stirn den Boden
Aus Japan, von L. Netto
lassen sich in der Regel nur ältere Herren mit weißen
Haaren einen schlichten, dünnen Ziegenbart stehen.
Der konservative Bauer rasiert sich noch nach alter
Sitte nicht nur das Gesicht, sondern auch den Scheitel
während in den übrigen Ständen, auch den unteren, die
europäische Haartracht um sich greift, in den oberen die
alte bereits ganz verdrängt hat.
Zum Arbeiten eignet sich das faltige, lange, flatter-
hafte Kimono mit fliegenden Ärmeln sehr schlecht, die
unteren Klassen benützen daher einen besonderen Anzug
für die Arbeit, falls sie nicht vorziehen, alles bis auf
den Lendengürtel abznlegen. Ein blauer Brustlatz mit
über dem Rücken gekreuzten Bändern, ein Jäckchen und
zwei dicht anliegende halbe Beinkleider, d. h. für jedes
Bein einzeln ein vom Knöchel bis zur Hüfte reichendes
Hosenbein oder statt dessen ein au Schwimmanzug er-
innerndes kurzes Höschenpaar ist alles. Der Baum-
wollenanzug der unteren Klassen, Männer wie Frauen,
ist ausnahmslos von indigoblauer Farbe, so daß eine
Volksversammlung wie in blaue Tinte getaucht erscheint.
Mit dem Import ausländischer Waren sind natürlich
vielerlei Änderungen auch im Anzug, nicht zur Verbesserung
des Gesamteiudrucks, hervorgerufen worden; einem Kuli,
der sich fein machen will, erscheinen ei» paar gewirkte
Unterhosen als passendes Supplement zu seinem seidenen
Gewand, und er schürzt dasselbe, um sein Licht nicht
unter den Scheffel zu stellen.
Gegen Regen schützt ihn sein großer flacher Hut
wie ein an den Kopf gebundener Regenschirm und ein
nach den Prinzipien eines Strohdaches konstruierter Mantel
oder auch ein „Waterproof" aus dem wasserdichten Öl-
papier.
Im Ganzen betrachtet er die Kleidung nicht als
Mittel zu dem Zweck, den Körper zu verhüllen, sondern
ihn gegen die Einflüsse der Witterung zu schützen und
ihn zu schmücken.
Wir lassen zum Schluß hier noch einen weiteren kurzen
Abschnitt folgen, der zwar die Kunst nicht berührt, dafür aber
von dem vielseitigen und überall gleich amüsanten Inhalt des
Netto'schen Werkes eine so köstliche Probe gibt, daß er sich zur
Empfehlung des letzteren an dieser Stelle wohl rechtfertigt. —
_Will man einen Besuch machen, so kann man ge-
trost früh zwischen 5 und 6 Uhr sein Opfer aufsuchen,
wäre es auch nur aus Rache für früher erlittene eigene
Störung im Morgenschlaf.
Die Mitteilung des Dieners, sein Herr schlafe noch
oder sei beim Essen, gilt nicht als Abweisung, während
»sllosbi di)'0Üi«, etwas krank, ein nicht mißzuverstehender
Wink in dieser Richtung ist.
Hast du das doch aus eigener Praxis gelernt, als
dir früh 6 Uhr ein Besuch gemeldet wurde. Du ließest
sagen, du seist noch im Bette, glaubtest die Sache sei
abgethan, drehtest dich herum und schliefst weiter, bis dich
nach einer Stunde die Meldung des Dieners, der Herr
warte noch, daran erinnerte, daß der Mensch seinem
Schicksal nicht entgehen kann. Seitdem bist du klug ge-
worden und »sllosbi bixolli« heißt seitdem die Parole
in ähnlichen Fällen.
Die Heiligkeit des Schlafzimmers und des Schlafes
existiert nicht und bei Sachen von auch nur geringer Wich-
tigkeit darfst du den Japaner ungeniert auch nachts aus
dem Schlafe wecken lassen. Er scheint, wie die Seeleute,
das Vermögen zu besitzen, den gestörten Schlaf ohne
weiteres wieder aufnehmen zu können. Im ganzen geht
er mit den Hühnern zu Bette und steht mit ihnen auf.
Eine unverbürgte Erzählung berichtet, daß in der
„alten" Zeit, das heißt kurz nach Eröffnung des Landes,
ein Damno für 7 Uhr auf die englische Gesandtschaft
zum Essen eingeladen war. Er erschien morgens 7 Uhr
und als man ihm bedeutete, daß ein Mißverständnis ob-
walte, erklärte er, bis abends warten zu wollen. Zeit
spielte damals noch keine Rolle.
Bisweilen nimmt der Diener des zu Besuchenden,
der in deine Kenntnisse der japanischen Sprache kein rechtes
Zutrauen zu haben scheint, die Fingersprache zu Hilfe;
er streckt zum Beispiel den Daumen in die Höhe, und
sagt »arimnsen«, d. h. „ist nicht", darauf streckt er dir
den kleinen Finger entgegen mit »urimasu«, d. h. „ist
vorhanden". Der Sinn dieser Rede ist, der Hausherr
ist ausgegangen, die gnädige Frau dagegen zuhause.
Wird dein Besuch angenommen, so tritt die Frage
au dich heran, ob du deinen Einzug mit den Stiefeln in
der Hand oder an den Füßen halten willst. Du würdest
natürlich das letztere vorzichen, abgesehen von der Mühe
des Aus- und Anziehens, kommst du dir im Besuchs-
anzug und in Strümpfen etwas komisch vor, dann bist
du, wenn es Winter ist, ziemlich sicher, daß du dich ans
den kalten Strohmatten, in dem ungeheizten Zimmer er-
kältest und schließlich hast du vielleicht vergessen, dich zu-
hause zu überzeugen, ob deine Strümpfe in demselben
tadellosen Zustande sind, wie deine Glaces.
Ist das ganze Hans japanisch eingerichtet, d. h. zeigt
es gar keine Einrichtung und nur tadellos reine Matten'
so wäre es ein nie wieder gut zu machender Fehler, das
Schuhwerk anzubehaltcn, ob du Diener oder Herr bist,
es muß herunter.
Höhere Japaner in der Residenz oder in den Hafen-
städten, die viel mit Fremden Verkehren, haben gewöhnlich
einige europäische eingerichteten Zimmer, wo nicht ein
ganzes Haus; dann bleibt dir die Strafe erlassen; ja
der Hausherr, vielleicht auch die Dame des Hauses
empfängt dich sogar in europäischer Tracht; obwohl der
Japaner zuhause fast stets die bequeme japanische
Kleidung trägt, so erscheint er doch in ungläubig kurzer
Zeit in ausländischem Gewände und Stiefletten.
Nachdem man im ersteren Falle noch einen weh-
mütigen Blick auf seine, auf dem Vorsaal zurück-
gelassenen wärmenden Schuhe geworfen, folgt man dem
Diener durch einige Zimmer mit kalten Matten und
Korridors mit noch kälteren Dielen in die „gute Stube",
die immer möglichst weit weg vom Eingang liegt und
möglichst nahe einem Orte, der bei uns in die ab-
gelegensten Regionen des Hauses verlegt wird. Nach
einer flüchtigen Verbeugung läßt man sich auf den Boden
nieder, als Japaner würde man schon an der Thüre auf
die Knie fallen — und nun kommt erst die eigentliche
Begrüßung. Um die ganze japanesische Zeremonie durch-
zumachen, dafür ist das Rückgrat moralisch und physisch
zu-ungelenk, man hilft sich also mit einem Kompromiß,
bestehend in einer mehr oder weniger tiefen Verbeugung
des Oberkörpers, der auf den untergeschlagenen Beinen
einen etwas wackeligen Stützpunkt findet. Glücklicher-
weise ist der höfliche Wirt nicht im stände, deinen, nach
hiesigen Begriffen sehr nachlässigen Gruß genau zu
kontrollieren, da er inzwischen mit der Stirn den Boden