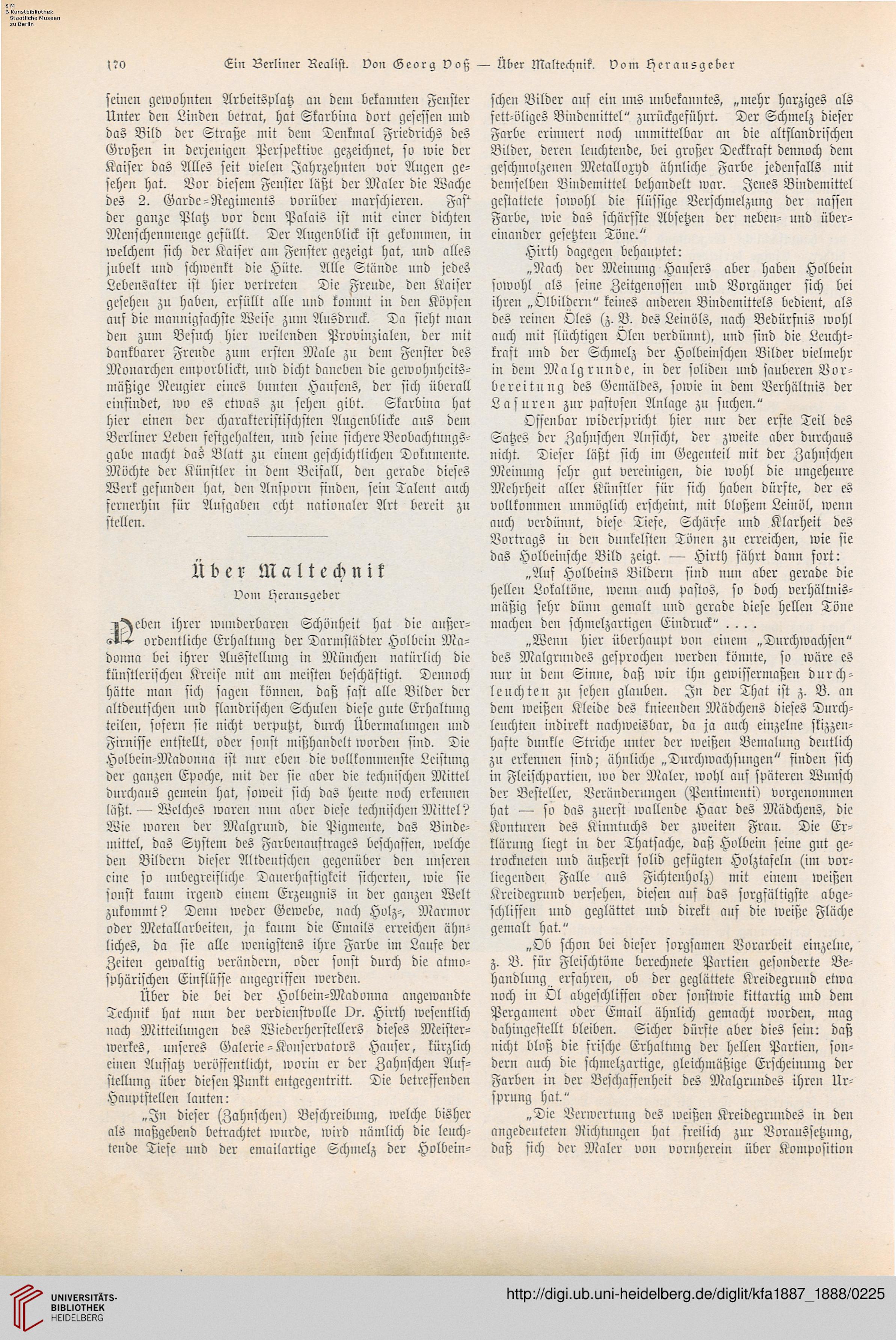1?o Lin Berliner Realist, von Georg voß
seinen gewohnten Arbeitsplatz an dein bekannten Fenster
Unter den Linden betrat, hat Skarbina dort gesessen und
das Bild der Straße mit dem Denkmal Friedrichs des
Großen in derjenigen Perspektive gezeichnet, so wie der
Kaiser das Alles seit vielen Jahrzehnten vor Augen ge-
sehen hat. Vor diesem Fenster läßt der Maler die Wache
des 2. Garde-Regiments vorüber marschieren. Faß
der ganze Platz vor dem Palais ist mit einer dichten
Menschenmenge gefüllt. Der Augenblick ist gekommen, in
welchem sich der Kaiser am Fenster gezeigt hat, und alles
jubelt und schwenkt die Hüte. Alle Stände und jedes
Lebensalter ist hier vertreten Die Freude, den Kaiser
gesehen zu haben, erfüllt alle und kommt in den Köpfen
auf die mannigfachste Weise zum Ausdruck. Da sieht man
den zum Besuch hier weilenden Provinzialen, der mit
dankbarer Freude zum ersten Male zu dem Fenster des
Monarchen emporblickt, und dicht daneben die gewohnheits-
mäßige Neugier eines bunten Haufens, der sich üherall
einfindet, wo es etwas zu sehen gibt. Skarbina hat
hier einen der charakteristischsten Augenblicke aus dem
Berliner Leben festgehalten, und seine sichere Beobachtungs-
gabe macht das Blatt zu einem geschichtlichen Dokumente.
Möchte der Künstler in dem Beifall, den gerade dieses
Werk gefunden hat, den Ansporn finden, sein Talent auch
fernerhin für Ausgaben echt nationaler Art bereit zu
stellen.
ü b e r malte ch n i k
vom Herausgeber
^>cben ihrer wunderbaren Schönheit hat die äußer-
st!^ ordentliche Erhaltung der Darmstädter Holbcin Ma-
donna bei ihrer Ausstellung in München natürlich die
künstlerischen Kreise mit am meisten beschäftigt. Dennoch
hätte man sich sagen können, daß fast alle Bilder der
altdeutschen und flandrischen Schulen diese gute Erhaltung
teilen, sofern sie nicht verputzt, durch Übermalungen und
Firnisse entstellt, oder sonst mißhandelt worden sind. Die
Holbein-Madonna ist nur eben die vollkommenste Leistung
der ganzen Epoche, mit der sie aber die technischen Mittel
durchaus gemein hat, soweit sich das heute noch erkennen
laßt. — Welches waren nun aber diese technischen Mittel?
Wie waren der Malgrnnd, die Pigmente, das Binde-
mittel, das System des Farbenanftrages beschaffen, welche
den Bildern dieser Altdeutschen gegenüber den unseren
eine so unbegreifliche Dauerhaftigkeit sicherten, wie sie
sonst kaum irgend einem Erzeugnis in der ganzen Welt
zukommt? Denn weder Gewebe, nach Holz-, Marmor
oder Metallarbeiten, ja kaum die Emails erreichen ähn-
liches, da sie alle wenigstens ihre Farbe im Laufe der
Zeiten gewaltig verändern, oder sonst durch die atmo-
sphärischen Einflüsse angegriffen werden.
Über die bei der Holbein-Madonna angewandte
Technik hat nun der verdienstvolle vr. Hirth wesentlich
nach Mitteilungen des Wiederherstellers dieses Meister-
werkes, unseres Galerie-Konservators Hauser, kürzlich
einen Aufsatz veröffentlicht, worin er der Zahnschen Auf-
stellung über diesen Punkt entgegentritt. Die betreffenden
Hanptstellcn lauten:
„In dieser (Zahnschen) Beschreibung, welche bisher
als maßgebend betrachtet wurde, wird nämlich die leuch-
tende Tiefe und der emailartige Schmelz der Holbein-
- Über Naltechnik. vom Herausgeber
sehen Bilder auf ein uns unbekanntes, „mehr harziges als
fett-öliges Bindemittel" zurückgeführt. Der Schmelz dieser
Farbe erinnert noch unmittelbar an die altflandrischen
Bilder, deren leuchtende, bei großer Deckkraft dennoch dem
geschmolzenen Metalloxyd ähnliche Farbe jedenfalls mit
demselben Bindemittel behandelt war. Jenes Bindemittel
gestattete sowohl die flüssige Verschmelzung der nassen
Farbe, wie das schärfste Absetzen der neben- und über-
einander gesetzten Töne."
Hirth dagegen behauptet:
„Nach der Meinung Hausers aber haben Holbein
sowohl als seine Zeitgenossen und Vorgänger sich bei
ihren „Ölbildern" keines anderen Bindemittels bedient, als
des reinen Öles (z. B. des Leinöls, nach Bedürfnis wohl
auch mit flüchtigen Ölen verdünnt), und sind die Leucht-
kraft und der Schmelz der Holbeinschen Bilder vielmehr
in dem Malgrunde, in der soliden und sauberen Vor-
bereitung des Gemäldes, sowie in dem Verhältnis der
Lasuren zur pastosen Anlage zu suchen."
Offenbar widerspricht hier nur der erste Teil des
Satzes der Zahnschen Ansicht, der zweite aber durchaus
nicht. Dieser läßt sich im Gegenteil mit der Zahnschen
Meinung sehr gut vereinigen, die wohl die ungeheure
Mehrheit aller Künstler für sich haben dürfte, der es
vollkommen unmöglich erscheint, mit bloßem Leinöl, wenn
auch verdünnt, diese Tiefe, Schärfe und Klarheit des
Vortrags in den dunkelsten Tönen zu erreichen, wie sie
das Holbeinsche Bild zeigt. — Hirth fährt dann fort:
„Auf Holbeins Bildern sind nun aber gerade die
Hellen Lokaltöne, wenn auch pastös, so doch verhältnis-
mäßig sehr dünn gemalt und gerade diese Hellen Töne
machen den schmelzartigen Eindruck" ....
„Wenn hier überhaupt von einem „Durchwachsen"
des Malgrundes gesprochen werden könnte, so wäre es
nur in dem Sinne, daß wir ihn gewissermaßen durch-
leuchten zu sehen glauben. In der That ist z. B. an
dem Weißen Kleide des knieenden Mädchens dieses Durch-
leuchten indirekt nachweisbar, da ja auch einzelne skizzen-
hafte dunkle Striche unter der weißen Bemalung deutlich
zu erkennen sind; ähnliche „Durchwachsungen" finden sich
in Fleischpartien, wo der Maler, wohl ans späteren Wunsch
der Besteller, Veränderungen (Pentimenti) vorgenommen
hat — so das zuerst wallende Haar des Mädchens, die
Konturen des Kinntuchs der zweiten Frau. Die Er-
klärung liegt in der Thatsache, daß Holbcin seine gut ge-
trockneten und äußerst solid gefügten Holztafeln (im vor-
liegenden Falle aus Fichtenholz) mit einem weißen
Krcidegrnnd versehen, diesen ans das sorgfältigste abge-
schliffen und geglättet und direkt ans die weiße Fläche
gemalt hat."
„Ob schon bei dieser sorgsamen Vorarbeit einzelne,
z. B. für Fleischtöne berechnete Partien gesonderte Be-
handlung erfahren, ob der geglättete Krcidegrnnd etwa
noch in Öl abgeschliffen oder sonstwie kittartig und dem
Pergament oder Email ähnlich gemacht worden, mag
dahingestellt bleiben. Sicher dürfte aber dies sein: daß
nicht bloß die frische Erhaltung der Hellen Partien, son-
dern auch die schmelzartige, gleichmäßige Erscheinung der
Farben in der Beschaffenheit des Malgrundes ihren Ur-
sprung hat."
„Die Verwertung des weißen Kreidegrnndes in den
angedentcten Richtungen hat freilich zur Voraussetzung,
daß sich der Maler von vornherein über Komposition
seinen gewohnten Arbeitsplatz an dein bekannten Fenster
Unter den Linden betrat, hat Skarbina dort gesessen und
das Bild der Straße mit dem Denkmal Friedrichs des
Großen in derjenigen Perspektive gezeichnet, so wie der
Kaiser das Alles seit vielen Jahrzehnten vor Augen ge-
sehen hat. Vor diesem Fenster läßt der Maler die Wache
des 2. Garde-Regiments vorüber marschieren. Faß
der ganze Platz vor dem Palais ist mit einer dichten
Menschenmenge gefüllt. Der Augenblick ist gekommen, in
welchem sich der Kaiser am Fenster gezeigt hat, und alles
jubelt und schwenkt die Hüte. Alle Stände und jedes
Lebensalter ist hier vertreten Die Freude, den Kaiser
gesehen zu haben, erfüllt alle und kommt in den Köpfen
auf die mannigfachste Weise zum Ausdruck. Da sieht man
den zum Besuch hier weilenden Provinzialen, der mit
dankbarer Freude zum ersten Male zu dem Fenster des
Monarchen emporblickt, und dicht daneben die gewohnheits-
mäßige Neugier eines bunten Haufens, der sich üherall
einfindet, wo es etwas zu sehen gibt. Skarbina hat
hier einen der charakteristischsten Augenblicke aus dem
Berliner Leben festgehalten, und seine sichere Beobachtungs-
gabe macht das Blatt zu einem geschichtlichen Dokumente.
Möchte der Künstler in dem Beifall, den gerade dieses
Werk gefunden hat, den Ansporn finden, sein Talent auch
fernerhin für Ausgaben echt nationaler Art bereit zu
stellen.
ü b e r malte ch n i k
vom Herausgeber
^>cben ihrer wunderbaren Schönheit hat die äußer-
st!^ ordentliche Erhaltung der Darmstädter Holbcin Ma-
donna bei ihrer Ausstellung in München natürlich die
künstlerischen Kreise mit am meisten beschäftigt. Dennoch
hätte man sich sagen können, daß fast alle Bilder der
altdeutschen und flandrischen Schulen diese gute Erhaltung
teilen, sofern sie nicht verputzt, durch Übermalungen und
Firnisse entstellt, oder sonst mißhandelt worden sind. Die
Holbein-Madonna ist nur eben die vollkommenste Leistung
der ganzen Epoche, mit der sie aber die technischen Mittel
durchaus gemein hat, soweit sich das heute noch erkennen
laßt. — Welches waren nun aber diese technischen Mittel?
Wie waren der Malgrnnd, die Pigmente, das Binde-
mittel, das System des Farbenanftrages beschaffen, welche
den Bildern dieser Altdeutschen gegenüber den unseren
eine so unbegreifliche Dauerhaftigkeit sicherten, wie sie
sonst kaum irgend einem Erzeugnis in der ganzen Welt
zukommt? Denn weder Gewebe, nach Holz-, Marmor
oder Metallarbeiten, ja kaum die Emails erreichen ähn-
liches, da sie alle wenigstens ihre Farbe im Laufe der
Zeiten gewaltig verändern, oder sonst durch die atmo-
sphärischen Einflüsse angegriffen werden.
Über die bei der Holbein-Madonna angewandte
Technik hat nun der verdienstvolle vr. Hirth wesentlich
nach Mitteilungen des Wiederherstellers dieses Meister-
werkes, unseres Galerie-Konservators Hauser, kürzlich
einen Aufsatz veröffentlicht, worin er der Zahnschen Auf-
stellung über diesen Punkt entgegentritt. Die betreffenden
Hanptstellcn lauten:
„In dieser (Zahnschen) Beschreibung, welche bisher
als maßgebend betrachtet wurde, wird nämlich die leuch-
tende Tiefe und der emailartige Schmelz der Holbein-
- Über Naltechnik. vom Herausgeber
sehen Bilder auf ein uns unbekanntes, „mehr harziges als
fett-öliges Bindemittel" zurückgeführt. Der Schmelz dieser
Farbe erinnert noch unmittelbar an die altflandrischen
Bilder, deren leuchtende, bei großer Deckkraft dennoch dem
geschmolzenen Metalloxyd ähnliche Farbe jedenfalls mit
demselben Bindemittel behandelt war. Jenes Bindemittel
gestattete sowohl die flüssige Verschmelzung der nassen
Farbe, wie das schärfste Absetzen der neben- und über-
einander gesetzten Töne."
Hirth dagegen behauptet:
„Nach der Meinung Hausers aber haben Holbein
sowohl als seine Zeitgenossen und Vorgänger sich bei
ihren „Ölbildern" keines anderen Bindemittels bedient, als
des reinen Öles (z. B. des Leinöls, nach Bedürfnis wohl
auch mit flüchtigen Ölen verdünnt), und sind die Leucht-
kraft und der Schmelz der Holbeinschen Bilder vielmehr
in dem Malgrunde, in der soliden und sauberen Vor-
bereitung des Gemäldes, sowie in dem Verhältnis der
Lasuren zur pastosen Anlage zu suchen."
Offenbar widerspricht hier nur der erste Teil des
Satzes der Zahnschen Ansicht, der zweite aber durchaus
nicht. Dieser läßt sich im Gegenteil mit der Zahnschen
Meinung sehr gut vereinigen, die wohl die ungeheure
Mehrheit aller Künstler für sich haben dürfte, der es
vollkommen unmöglich erscheint, mit bloßem Leinöl, wenn
auch verdünnt, diese Tiefe, Schärfe und Klarheit des
Vortrags in den dunkelsten Tönen zu erreichen, wie sie
das Holbeinsche Bild zeigt. — Hirth fährt dann fort:
„Auf Holbeins Bildern sind nun aber gerade die
Hellen Lokaltöne, wenn auch pastös, so doch verhältnis-
mäßig sehr dünn gemalt und gerade diese Hellen Töne
machen den schmelzartigen Eindruck" ....
„Wenn hier überhaupt von einem „Durchwachsen"
des Malgrundes gesprochen werden könnte, so wäre es
nur in dem Sinne, daß wir ihn gewissermaßen durch-
leuchten zu sehen glauben. In der That ist z. B. an
dem Weißen Kleide des knieenden Mädchens dieses Durch-
leuchten indirekt nachweisbar, da ja auch einzelne skizzen-
hafte dunkle Striche unter der weißen Bemalung deutlich
zu erkennen sind; ähnliche „Durchwachsungen" finden sich
in Fleischpartien, wo der Maler, wohl ans späteren Wunsch
der Besteller, Veränderungen (Pentimenti) vorgenommen
hat — so das zuerst wallende Haar des Mädchens, die
Konturen des Kinntuchs der zweiten Frau. Die Er-
klärung liegt in der Thatsache, daß Holbcin seine gut ge-
trockneten und äußerst solid gefügten Holztafeln (im vor-
liegenden Falle aus Fichtenholz) mit einem weißen
Krcidegrnnd versehen, diesen ans das sorgfältigste abge-
schliffen und geglättet und direkt ans die weiße Fläche
gemalt hat."
„Ob schon bei dieser sorgsamen Vorarbeit einzelne,
z. B. für Fleischtöne berechnete Partien gesonderte Be-
handlung erfahren, ob der geglättete Krcidegrnnd etwa
noch in Öl abgeschliffen oder sonstwie kittartig und dem
Pergament oder Email ähnlich gemacht worden, mag
dahingestellt bleiben. Sicher dürfte aber dies sein: daß
nicht bloß die frische Erhaltung der Hellen Partien, son-
dern auch die schmelzartige, gleichmäßige Erscheinung der
Farben in der Beschaffenheit des Malgrundes ihren Ur-
sprung hat."
„Die Verwertung des weißen Kreidegrnndes in den
angedentcten Richtungen hat freilich zur Voraussetzung,
daß sich der Maler von vornherein über Komposition