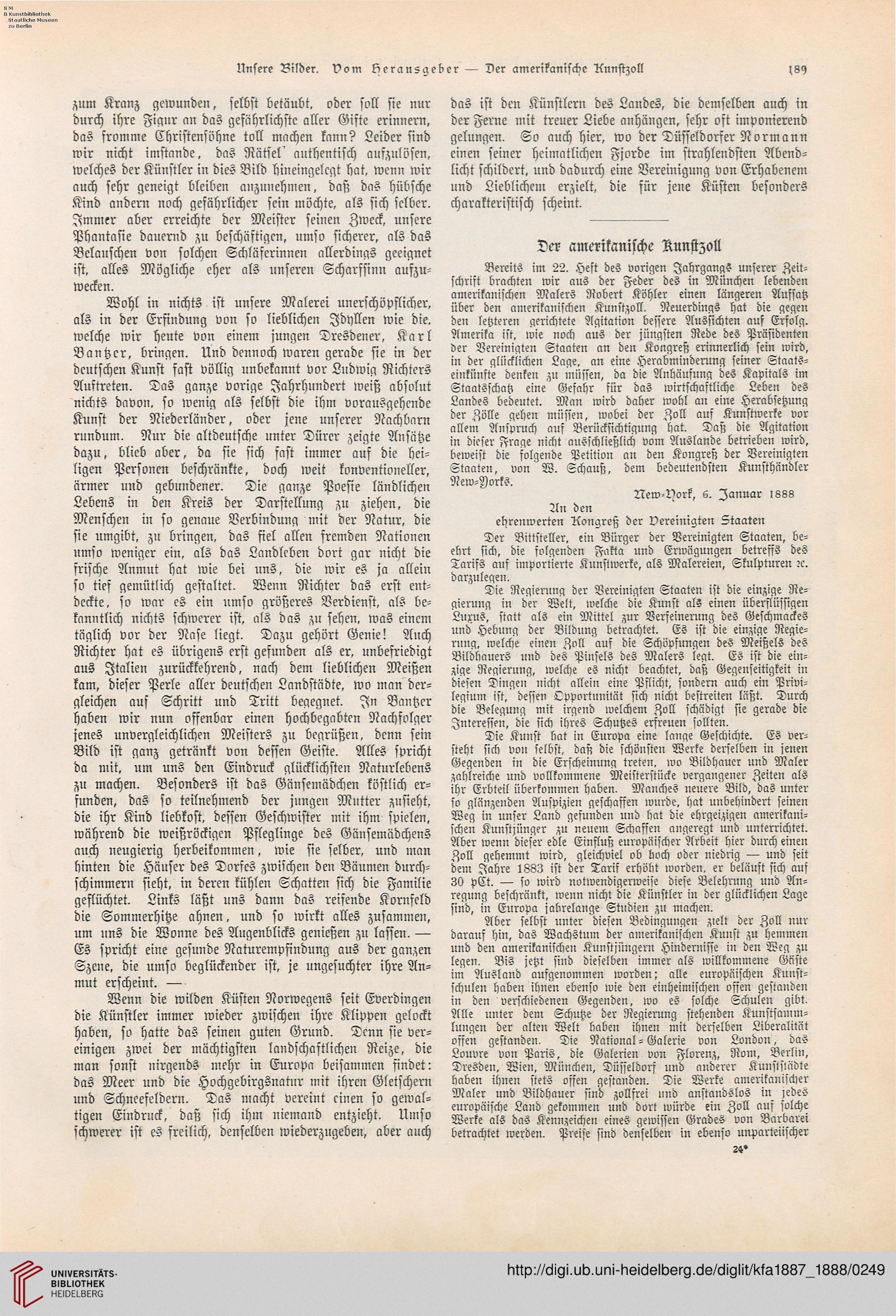Unsere Bilder, vom Herausgeber
zum Kranz gewunden, selbst betäubt, oder soll sie nur
durch ihre Figur an das gefährlichste aller Gifte erinnern,
das fromme Christensöhne toll machen kann? Leider sind
wir nicht imstande, das Rätsel authentisch aufzulösen,
welches der Künstler in dies Bild hineingelcgt hat, wenn wir
auch sehr geneigt bleiben anzunehmen, daß das hübsche
Kind andern noch gefährlicher sein möchte, als sich selber.
Immer aber erreichte der Meister seinen Zweck, unsere
Phantasie dauernd zu beschäftigen, umso sicherer, als das
Belauschen von solchen Schläferinnen allerdings geeignet
ist, alles Mögliche eher als unseren Scharfsinn aufzu-
wecken.
Wohl in nichts ist unsere Malerei unerschöpflicher,
als in der Erfindung von so lieblichen Idyllen wie die.
welche wir heute von einem jungen Dresdener, Karl
Bantzcr, bringen. Und dennoch waren gerade sie in der
deutschen Kunst fast völlig unbekannt vor Ludwig Richters
Auftreten. Das ganze vorige Jahrhundert weiß absolut
nichts davon, so wenig als selbst die ihm vorausgehende
Kunst der Niederländer, oder jene unserer Nachbarn
rundum. Nur die altdeutsche unter Dürer zeigte Ansätze
dazu, blieb aber, da sie sich fast immer auf die hei-
ligen Personen beschränkte, doch weit konventioneller,
ärmer und gebundener. Die ganze Poesie ländlichen
Lebens in den Kreis der Darstellung zu ziehen, die
Menschen in so genaue Verbindung mit der Natur, die
sie umgibt, zu bringen, das fiel allen fremden Nationen
umso weniger ein, als das Landleben dort gar nicht die
frische Anmut hat wie bei uns, die wir es ja allein
so tief gemütlich gestaltet. Wenn Richter das erst ent-
deckte, so war es ein umso größeres Verdienst, als be-
kanntlich nichts schwerer ist, als das zu sehen, was einem
täglich vor der Nase liegt. Dazu gehört Genie! Auch
Richter hat es übrigens erst gefunden als er, unbefriedigt
aus Italien zurückkehrend, nach dem lieblichen Meißen
kam, dieser Perle aller deutschen Landstädte, wo man der-
gleichen aus Schritt und Tritt begegnet. In Bantzcr
haben wir nnn offenbar einen hochbegabten Nachfolger
jenes unvergleichlichen Meisters zu begrüßen, denn sein
Bild ist ganz getränkt von dessen Geiste. Alles spricht
da mit, um uns den Eindruck glücklichsten Naturlebens
zu machen. Besonders ist das Gänsemädchen köstlich er-
funden, das so teilnehmend der jungen Mutter zusieht,
die ihr Kind liebkost, dessen Geschwister mit ihm spielen,
während die weißröckigen Pfleglinge des Gänsemädchens
auch neugierig herbeikommen, wie sie selber, und man
hinten die Häuser des Dorfes zwischen den Bäumen durch-
schimmern sieht, in deren kühlen Schatten sich die Familie
geflüchtet. Links läßt uns dann das reifende Kornfeld
die Sommerhitze ahnen, und so wirkt alles zusammen,
um uns die Wonne des Augenblicks genießen zu lassen. —
Es spricht eine gesunde Naturempfindung aus der ganzen
Szene, die umso beglückender ist, je ungesuchter ihre An-
mut erscheint. —
Wenn die wilden Küsten Norwegens seit Everdingen
die Künstler immer wieder zwischen ihre Klippen gelockt
haben, so hatte das seinen guten Grund. Denn sie ver-
einigen zwei der mächtigsten landschaftlichen Reize, die
man sonst nirgends mehr in Europa beisammen findet:
das Meer und die Hochgebirgsnatur mit ihren Gletschern
und Schncefeldern. Das macht vereint einen so gewal-
tigen Eindruck, daß sich ihm niemand entzieht. Umso
schwerer ist es freilich, denselben wiederzugeben, aber auch
Der amerikanische Kunstzoll My
das ist den Künstlern des Landes, die demselben auch in
der Ferne mit treuer Liebe anhängen, sehr oft imponierend
gelungen. So auch hier, wo der Düsseldorfer Normann
einen seiner heimatlichen Fjorde im strahlendsten Abend-
licht schildert, und dadurch eine Vereinigung von Erhabenem
und Lieblichem erzielt, die für jene Küsten besonders
charakteristisch scheint.
Der amerikanische Runstzoll
Bereits im 22. Heft des vorigen Jahrgang? unserer Zeit-
schrift brachten wir aus der Feder des in München lebenden
amerikanischen Malers Robert Köhler einen längeren Aufsatz
über den amerikanischen Kunstzoll. Neuerdings hat die gegen
den letzteren gerichtete Agitation bessere Aussichten auf Erfolg.
Amerika ist, wie noch aus der jüngsten Rede des Präsidenten
der Vereinigten Staaten an den Kongreß erinnerlich sein wird,
in der glücklichen Lage, an eine Herabminderung seiner Staats-
einkünfte denken zu müssen, da die Anhäufung des Kapitals im
Staatsschatz eine Gefahr für das wirtschaftliche Leben des
Landes bedeutet. Man wird daher wohl an eine Herabsetzung
der Zölle gehen müssen, wobei der Zoll auf Kunstwerke vor
allem Anspruch auf Berücksichtigung hat. Daß die Agitation
in dieser Frage nicht ausschließlich vom Auslande betrieben wird,
beweist die folgende Petition an den Kongreß der Vereinigten
Staaten, von W. Schauß, dem bedeutendsten Kunsthändler
New-Uorks.
New-Hork, 6. Januar 1888
An den
ehrenwerten Kongreß der vereinigten Staaten
Der Bittsteller, ein Bürger der Vereinigten Staaten, be-
ehrt sich, die folgenden Fakta und Erwägungen betreffs des
Tarifs auf importierte Kunstwerke, als Malereien, Skulpturen:c.
darzulegen.
Die Regierung der Bereinigten Staaten ist die einzige Re-
gierung in der Welt, welche die Kunst als einen überflüssigen
Luxus, statt als ein Mittel zur Verfeinerung des Geschmackes
und Hebung der Bildung betrachtet. Es ist die einzige Regie-
rung, welche einen Zoll auf die Schöpfungen des Meißels des
Bildhauers und des Pinsels des Malers legt. Es ist die ein-
zige Regierung, welche es nicht beachtet, daß Gegenseitigkeit in
diesen Dingen nicht allein eine Pflicht, sondern auch ein Privi-
legium ist, dessen Lpportunität sich nicht bestreiten läßt. Durch
die Belegung mit irgend welchem Zoll schädigt sie gerade die
Interessen, die sich ihres Schutzes erfreuen sollten.
Die Kunst Kat in Europa eine lange Geschichte. Es ver-
steht sich von selbst, daß die schönsten Werke derselben in jenen
Gegenden in die Erscheinung treten, wo Bildhauer und Maler
zahlreiche und vollkommene Meisterstücke vergangener Zeiten als
ihr Erbteil überkommen haben. Manches neuere Bild, das unter
so glänzenden Auspizien geschaffen wurde, hat unbehindert seinen
Weg in unser Land gefunden und hat die ehrgeizigen amerikani-
schen Kunstjünger zu neuem Schaffen angeregt und unterrichtet.
Aber wenn dieser edle Einfluß europäischer Arbeit hier durch einen
Zoll gehemmt wird, gleichviel ob hoch oder niedrig — und seit
dem Jahre 1883 ist der Tarif erhöht worden, er beläuft sich auf
30 pCt. — so wird notwendigerweise diese Belehrung und An-
regung beschränkt, wenn nicht die Künstler in der glücklichen Lage
sind, in Europa jahrelange Studien zu machen.
Aber selbst unter diesen Bedingungen zielt der Zoll nur
darauf hin, das Wachstum der amerikanischen Kunst zu hemme»
und den amerikanischen Kunstjüngern Hindernisse in den Weg zu
legen. Bis jetzt sind dieselben immer als willkommene Gäste
im Ausland ausgenommen worden; alle europäischen Kunst-
schulen haben ihnen ebenso wie den einheimischen offen gestanden
in den verschiedenen Gegenden, wo es solche Schulen gibt.
Alle unter dem Schutze der Regierung stehenden Kunstsamm-
lungen der alten Welt haben ihnen mit derselben Liberalität
offen gestanden. Die National - Galerie von London, das
Louvre von Paris, die Galerien von Florenz, Rom, Berlin,
Dresden, Wien, München, Düsseldorf und anderer Kunststädte
haben ihnen stets offen gestanden. Die Werke amerikanischer
Maler und Bildhauer sind zollfrei und anstandslos in jedes
europäische Land gekommen und dort würde ein Zoll auf solche
Werke als das Kennzeichen eines gewissen Grades von Barbarei
betrachtet werden. Preise sind denselben in ebenso unparteiischer
r»'