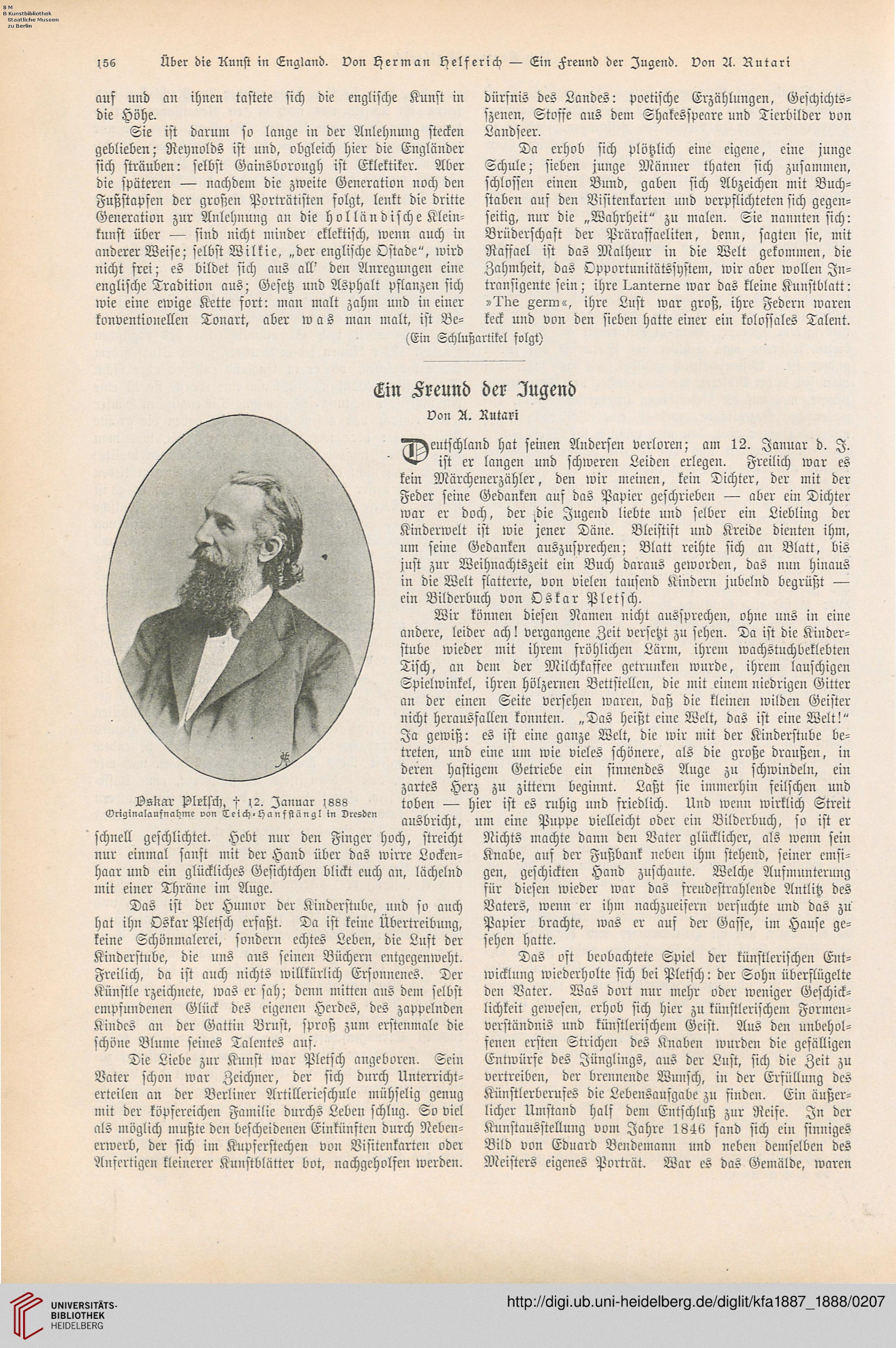t5S
Über die Kunst in England, von Herrnan kielferich — Ein Freund der Jugend, von A. Rutari
auf und au ihnen tastete sich die englische Kunst in
die Höhe.
Sie ist darum so lange in der Anlehnung stecken
geblieben; Reynolds ist und, obgleich hier die Engländer
sich sträuben: selbst Gainsborough ist Eklektiker. Aber
die späteren — nachdem die zweite Generation noch den
Fußstapfen der großen Porträtisten folgt, lenkt die dritte
Generation zur Anlehnung an die holländische Klein-
kunst über — sind nicht minder eklektisch, wenn auch in
anderer Weise; selbst Wilkie, „der englische Ostade", wird
nicht frei; es bildet sich ans all' den Anregungen eine
englische Tradition aus; Gesetz und Asphalt pflanzen sich
wie eine ewige Kette fort: man malt zahm und in einer
konventionellen Tonart, aber was man malt, ist Be-
dürfnis des Landes: poetische Erzählungen, Geschichts-
szenen, Stoffe aus dem Shakesspeare und Tierbilder von
Landseer.
Da erhob sich plötzlich eine eigene, eine junge
Schule; sieben junge Männer thaten sich zusammen,
schlossen einen Bund, gaben sich Abzeichen mit Buch-
staben auf den Visitenkarten und verpflichteten sich gegen-
seitig, nur die „Wahrheit" zu malen. Sie nannten sich:
Brüderschaft der Präraffaeliten, denn, sagten sie, mit
Raffael ist das Malheur in die Welt gekommen, die
Zahmheit, das Opportunitätssystem, wir aber wollen In-
transigente sein; ihre Oanterue war das kleine Kunstblatt:
»Tke gerin«, ihre Lust war groß, ihre Federn waren
keck und von den sieben hatte einer ein kolossales Talent.
(Ein Schlußartikel folgt)
Lin Freund der Jugend
von A. Rutari
eutschland hat seinen Andersen verloren; am 12. Januar d. I.
ist er langen und schweren Leiden erlegen. Freilich war es
kein Märchenerzähler, den wir meinen, kein Dichter, der mit der
Feder seine Gedanken auf das Papier geschrieben — aber ein Dichter
war er doch, der chie Jugend liebte und selber ein Liebling der
Kinderwelt ist wie jener Däne. Bleistift und Kreide dienten ihm,
um seine Gedanken auszusprechen; Blatt reihte sich an Blatt, bis
just zur Weihnachtszeit ein Buch daraus geworden, das nun hinaus
in die Welt flatterte, von vielen tausend Kindern jubelnd begrüßt —
ein Bilderbuch von Oskar Pletsch.
Wir können diesen Namen nicht aussprechen, ohne uns in eine
andere, leider ach! vergangene Zeit versetzt zu sehen. Da ist die Kinder-
stube wieder mit ihrem fröhlichen Lärm, ihrem wachstuchbeklebten
Tisch, an dem der Milchkaffee getrunken wurde, ihrem lauschigen
Spielwinkel, ihren hölzernen Bettstellen, die mit einem niedrigen Gitter
an der einen Seite versehen waren, daß die kleinen wilden Geister
nicht herausfallen konnten. „Das heißt eine Welt, das ist eine Welt!"
Ja gewiß: es ist eine ganze Welt, die wir mit der Kinderstube be-
treten, und eine um wie vieles schönere, als die große draußen, in
deren hastigem Getriebe ein sinnendes Auge zu schwindeln, ein
zartes Herz zu zittern beginnt. Laßt sie immerhin feilschen und
toben — hier ist es ruhig und friedlich. Und wenn wirklich Streit
ausbricht, um eine Puppe vielleicht oder ein Bilderbuch, so ist er
Hebt nur den Finger hoch, streicht Nichts machte dann den Vater glücklicher, als wenn sein
Knabe, auf der Fußbank neben ihm stehend, seiner emsi-
gen, geschickten Hand zuschante. Welche Aufmunterung
für diesen wieder war das freudestrahlende Antlitz des
Vaters, wenn er ihm nachzueifern versuchte und das zu
Papier brachte, was er auf der Gasse, im Hause ge-
sehen hatte.
Das oft beobachtete Spiel der künstlerischen Ent-
wicklung wiederholte sich bei Pletsch: der Sohn überflügelte
den Vater. Was dort nur mehr oder weniger Geschick-
lichkeit gewesen, erhob sich hier zu künstlerischem Formcu-
verständnis und künstlerischem Geist. Aus den unbehol-
fenen ersten Strichen des Knaben wurden die gefälligen
Entwürfe des Jünglings, aus der Lust, sich die Zeit zu
vertreiben, der brennende Wunsch, in der Erfüllung des
Künstlerberufes die Lebensaufgabe zu finden. Ein äußer-
licher Umstand half dem Entschluß zur Reife. In der
Kunstausstellung vom Jahre 1846 fand sich ein sinniges
Bild von Eduard Bendemann und neben demselben des
Meisters eigenes Porträt. War es das Gemälde, waren
Vskar plrksch, f 12.^ Januar ;888
schnell geschlichtet,
nur einmal sanft mit der Hand über das wirre Locken-
haar und ein glückliches Gesichtchen blickt euch an, lächelnd
mit einer Thräne im Auge.
Das ist der Humor der Kinderstube, und so auch
hat ihn Oskar Pletsch erfaßt. Da ist keine Übertreibung,
keine Schönmalerei, sondern echtes Leben, die Luft der
Kinderstube, die uns aus seinen Büchern entgegenweht.
Freilich, da ist auch nichts willkürlich Ersonnenes. Der
Künstle rzeichnete, was er sah; denn mitten aus dem selbst
empfundenen Glück des eigenen Herdes, des zappelnden
Kindes an der Gattin Brust, sproß zum erstenmale die
schöne Blume seines Talentes aus.
Die Liebe zur Kunst war Pletsch angeboren. Sein
Vater schon war Zeichner, der sich durch Unterricht-
erteilen an der Berliner Artillerieschule mühselig genug
mit der köpfereichen Familie durchs Leben schlug. So viel
als möglich mußte den bescheidenen Einkünften durch Neben-
erwerb, der sich im Kupferstechen von Visitenkarten oder
Anfertigen kleinerer Kunstblätter bot, nachgeholfen werden.
Über die Kunst in England, von Herrnan kielferich — Ein Freund der Jugend, von A. Rutari
auf und au ihnen tastete sich die englische Kunst in
die Höhe.
Sie ist darum so lange in der Anlehnung stecken
geblieben; Reynolds ist und, obgleich hier die Engländer
sich sträuben: selbst Gainsborough ist Eklektiker. Aber
die späteren — nachdem die zweite Generation noch den
Fußstapfen der großen Porträtisten folgt, lenkt die dritte
Generation zur Anlehnung an die holländische Klein-
kunst über — sind nicht minder eklektisch, wenn auch in
anderer Weise; selbst Wilkie, „der englische Ostade", wird
nicht frei; es bildet sich ans all' den Anregungen eine
englische Tradition aus; Gesetz und Asphalt pflanzen sich
wie eine ewige Kette fort: man malt zahm und in einer
konventionellen Tonart, aber was man malt, ist Be-
dürfnis des Landes: poetische Erzählungen, Geschichts-
szenen, Stoffe aus dem Shakesspeare und Tierbilder von
Landseer.
Da erhob sich plötzlich eine eigene, eine junge
Schule; sieben junge Männer thaten sich zusammen,
schlossen einen Bund, gaben sich Abzeichen mit Buch-
staben auf den Visitenkarten und verpflichteten sich gegen-
seitig, nur die „Wahrheit" zu malen. Sie nannten sich:
Brüderschaft der Präraffaeliten, denn, sagten sie, mit
Raffael ist das Malheur in die Welt gekommen, die
Zahmheit, das Opportunitätssystem, wir aber wollen In-
transigente sein; ihre Oanterue war das kleine Kunstblatt:
»Tke gerin«, ihre Lust war groß, ihre Federn waren
keck und von den sieben hatte einer ein kolossales Talent.
(Ein Schlußartikel folgt)
Lin Freund der Jugend
von A. Rutari
eutschland hat seinen Andersen verloren; am 12. Januar d. I.
ist er langen und schweren Leiden erlegen. Freilich war es
kein Märchenerzähler, den wir meinen, kein Dichter, der mit der
Feder seine Gedanken auf das Papier geschrieben — aber ein Dichter
war er doch, der chie Jugend liebte und selber ein Liebling der
Kinderwelt ist wie jener Däne. Bleistift und Kreide dienten ihm,
um seine Gedanken auszusprechen; Blatt reihte sich an Blatt, bis
just zur Weihnachtszeit ein Buch daraus geworden, das nun hinaus
in die Welt flatterte, von vielen tausend Kindern jubelnd begrüßt —
ein Bilderbuch von Oskar Pletsch.
Wir können diesen Namen nicht aussprechen, ohne uns in eine
andere, leider ach! vergangene Zeit versetzt zu sehen. Da ist die Kinder-
stube wieder mit ihrem fröhlichen Lärm, ihrem wachstuchbeklebten
Tisch, an dem der Milchkaffee getrunken wurde, ihrem lauschigen
Spielwinkel, ihren hölzernen Bettstellen, die mit einem niedrigen Gitter
an der einen Seite versehen waren, daß die kleinen wilden Geister
nicht herausfallen konnten. „Das heißt eine Welt, das ist eine Welt!"
Ja gewiß: es ist eine ganze Welt, die wir mit der Kinderstube be-
treten, und eine um wie vieles schönere, als die große draußen, in
deren hastigem Getriebe ein sinnendes Auge zu schwindeln, ein
zartes Herz zu zittern beginnt. Laßt sie immerhin feilschen und
toben — hier ist es ruhig und friedlich. Und wenn wirklich Streit
ausbricht, um eine Puppe vielleicht oder ein Bilderbuch, so ist er
Hebt nur den Finger hoch, streicht Nichts machte dann den Vater glücklicher, als wenn sein
Knabe, auf der Fußbank neben ihm stehend, seiner emsi-
gen, geschickten Hand zuschante. Welche Aufmunterung
für diesen wieder war das freudestrahlende Antlitz des
Vaters, wenn er ihm nachzueifern versuchte und das zu
Papier brachte, was er auf der Gasse, im Hause ge-
sehen hatte.
Das oft beobachtete Spiel der künstlerischen Ent-
wicklung wiederholte sich bei Pletsch: der Sohn überflügelte
den Vater. Was dort nur mehr oder weniger Geschick-
lichkeit gewesen, erhob sich hier zu künstlerischem Formcu-
verständnis und künstlerischem Geist. Aus den unbehol-
fenen ersten Strichen des Knaben wurden die gefälligen
Entwürfe des Jünglings, aus der Lust, sich die Zeit zu
vertreiben, der brennende Wunsch, in der Erfüllung des
Künstlerberufes die Lebensaufgabe zu finden. Ein äußer-
licher Umstand half dem Entschluß zur Reife. In der
Kunstausstellung vom Jahre 1846 fand sich ein sinniges
Bild von Eduard Bendemann und neben demselben des
Meisters eigenes Porträt. War es das Gemälde, waren
Vskar plrksch, f 12.^ Januar ;888
schnell geschlichtet,
nur einmal sanft mit der Hand über das wirre Locken-
haar und ein glückliches Gesichtchen blickt euch an, lächelnd
mit einer Thräne im Auge.
Das ist der Humor der Kinderstube, und so auch
hat ihn Oskar Pletsch erfaßt. Da ist keine Übertreibung,
keine Schönmalerei, sondern echtes Leben, die Luft der
Kinderstube, die uns aus seinen Büchern entgegenweht.
Freilich, da ist auch nichts willkürlich Ersonnenes. Der
Künstle rzeichnete, was er sah; denn mitten aus dem selbst
empfundenen Glück des eigenen Herdes, des zappelnden
Kindes an der Gattin Brust, sproß zum erstenmale die
schöne Blume seines Talentes aus.
Die Liebe zur Kunst war Pletsch angeboren. Sein
Vater schon war Zeichner, der sich durch Unterricht-
erteilen an der Berliner Artillerieschule mühselig genug
mit der köpfereichen Familie durchs Leben schlug. So viel
als möglich mußte den bescheidenen Einkünften durch Neben-
erwerb, der sich im Kupferstechen von Visitenkarten oder
Anfertigen kleinerer Kunstblätter bot, nachgeholfen werden.