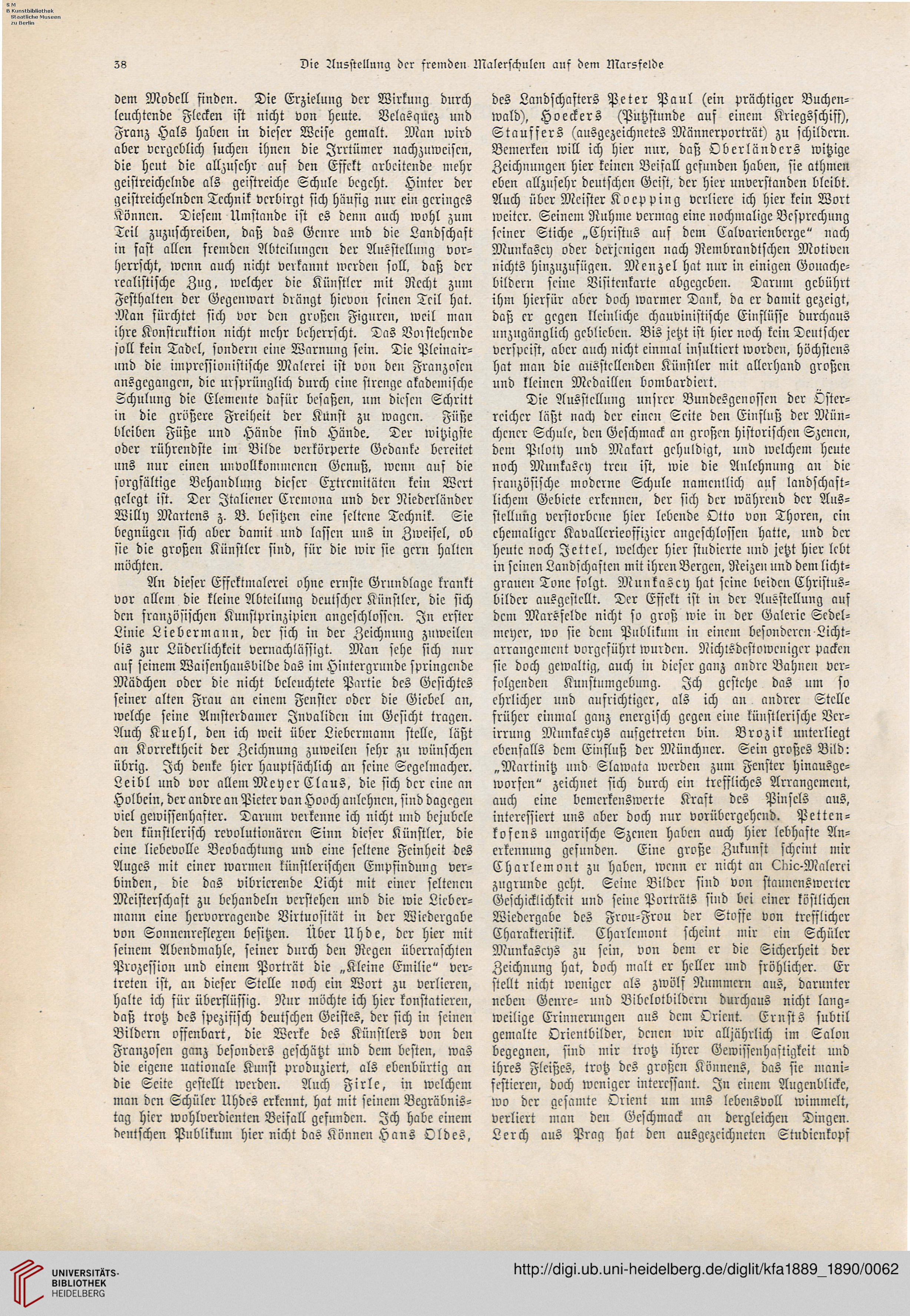38
Die Ausstellung der fremden Acalerschulen auf dem Marsfelde
dem Modell finden. Die Erzielung der Wirkung durch
leuchtende Flecken ist nicht von heute. Velasquez und
Franz Hals haben in dieser Weise gemalt. Man wird
aber vergeblich suchen ihnen die Jrrtümcr nachzuwcisen,
die heut die allznschr auf den Effekt arbeitende mehr
geistreichclnde als geistreiche Schule begeht. Hinter der
geistreichelnden Technik verbirgt sich häufig nur ein geringes
Können. Diesem Umstande ist es denn auch wohl zum
Teil znznschreibcn, daß das Genre und die Landschaft
in fast allen fremden Abteilungen der Ausstellung vor-
herrscht, wenn auch nicht verkannt werden soll, daß der
realistische Zug, welcher die Künstler mit Recht znm
Festhalten der Gegenwart drängt hievon seinen Teil hat.
Man fürchtet sich vor den großen Figuren, weil man
ihre Konstruktion nicht mehr beherrscht. Das Vmstchende
soll kein Tadel, sondern eine Warnung sein. Die Pleinair-
und die impressionistische Malerei ist von den Franzosen
ansgegangen, die ursprünglich durch eine strenge akademische
Schulung die Elemente dafür besaßen, um diesen Schrilt
in die größere Freiheit der Kunst zu wagen. Füße
bleiben Füße und Hände sind Hände. Der witzigste
oder rührendste im Bilde verkörperte Gedanke bereitet
uns nur einen unvollkommenen Genuß, wenn auf die
sorgfältige Behandlung dieser Extremitäten kein Wert
gelegt ist. Der Italiener Crcmona und der Niederländer
Willy Martens z. B. besitzen eine seltene Technik. Sie
begnügen sich aber damit und lassen uns in Zweifel, ob
sie die großen Künstler sind, für die wir sie gern halten
möchten.
An dieser Effcktmalerci ohne ernste Grundlage krankt
vor allem die kleine Abteilung deutscher Künstler, die sich
den französischen Kunstprinzipien angeschlosscn. In erster
Linie Liebermann, der sich in der Zeichnung zuweilen
bis zur Lüdcrlichkcit vernachlässigt. Man sehe sich nur
aus seinem Waiscnhausbilde das im Hintergründe springende
Mädchen oder die nicht beleuchtete Partie des Gesichtes
seiner alten Frau an einem Fenster oder die Giebel an,
welche seine Amsterdamer Invaliden im Gesicht tragen.
Auch Kuehl, den ich weit über Liebcrmann stelle, läßt
an Korrektheit der Zeichnung zuweilen sehr zu wünschen
übrig. Ich denke hier hauptsächlich an seine Segelmacher.
Leihl und vor allem Meyer Claus, die sich der eine an
Holbein, der andre an Pieter van Hooch anlchnen, sind dagegen
viel gewissenhafter. Darum verkenne ich nicht und bejubele
den künstlerisch revolutionären Sinn dieser Künstler, die
eine liebevolle Beobachtung und eine seltene Feinheit des
Auges mit einer warmen künstlerischen Empfindung ver-
binden, die das vibrierende Licht mit einer seltenen
Meisterschaft zu behandeln verstehen und die wie Licber-
mann eine hervorragende Virtuosität in der Wiedergabe
von Sonncnrcflexen besitzen. Über Uhde, der hier mit
seinem Abendmahle, seiner durch den Regen überraschten
Prozession und einem Porträt die „Kleine Emilie" ver-
treten ist, an dieser Stelle noch ein Wort zu verlieren,
halte ich für überflüssig. Nur möchte ich hier konstatieren,
daß trotz des spezifisch deutschen Geistes, der sich in seinen
Bildern offenbart, die Werke des Künstlers von den
Franzosen ganz besonders geschätzt und dem besten, was
die eigene nationale Kunst produziert, als ebenbürtig an
die Seite gestellt werden. Auch Firle, in welchem
man den Schüler Uhdcs erkennt, hat mit seinem Begräbnis-
tag hier wohlverdienten Beifall gefunden. Ich habe einem
deutschen Publikum hier nicht das Können Hans Oldes,
des Landschafters Peter Paul (ein prächtiger Buchen-
wald), Hoeckers (Putzstunde auf einem Kriegsschiff),
Stauffers (ausgezeichnetes Männerporträt) zu schildern.
Bemerken will ich hier nur, daß Oberländcrs witzige
Zeichnungen hier keinen Beifall gefunden haben, sie athmen
eben allzusehr deutschen Geist, der hier unverstanden bleibt.
Auch über Meister Ko cp p in g verliere ich hier kein Wort
weiter. Seinem Ruhme vermag eine nochmalige Besprechung
seiner Stiche „Christus auf dem Calvarienbcrge" nach
Munkascy oder derjenigen nach Rembrandtschen Motiven
nichts hinzuzufügen. Menzel hat nur in einigen Gonache-
bildern seine Visitenkarte abgegeben. Darum gebührt
ihm hierfür aber doch warmer Dank, da er damit gezeigt,
daß er gegen kleinliche chauvinistische Einflüsse durchaus
unzugänglich geblieben. Bis jetzt ist hier noch kein Deutscher
verspeist, aber auch nicht einmal insultiert worden, höchstens
hat man die ausstellenden Künstler mit allerhand großen
und kleinen Medaillen bombardiert.
Die Ausstellung unsrer Bundesgenossen der Öster-
reicher läßt nach der einen Seite den Einfluß der Mün-
chener Schule, den Geschmack an großen historischen Szenen,
dem Piloiy und Makart gehuldigt, und welchem heute
noch Munkasey treu ist, wie die Anlehnung an die
französische moderne Schule namentlich auf landschaft-
lichem Gebiete erkennen, der sich der während der Aus-
stellung verstorbene hier lebende Otto von Thoren, ein
ehemaliger Kavallcrieoffizicr angeschlosscn hatte, und der
heute noch Zettel, welcher hier studierte und jetzt hier lebt
in seinen Landschaften mit ihren Bergen, Reizen und dem licht-
grauen Tone folgt. Munkascy hat seine beiden Christus-
bildcr ausgestellt. Der Effekt ist in der Ausstellung auf
dem Marsfelde nicht so groß wie in der Galerie Scdel-
mcyer, wo sie dem Publikum in einem besonderen Licht-
arrangemcnt vorgefllhrt wurden. Nichtsdestoweniger packen
sie doch gewaltig, auch in dieser ganz andre Bahnen ver-
folgenden Kunstumgcbung. Ich gestehe das um so
ehrlicher und aufrichtiger, als ich an andrer Stelle
früher einmal ganz energisch gegen eine künstlerische Ver-
irrung Munkascys aufgetreten bin. Brozik unterliegt
ebenfalls dem Einfluß der Münchner. Sein großes Bild:
„Martinitz und Slawata werden zum Fenster hinausge-
worfcn" zeichnet sich durch ein treffliches Arrangement,
auch eine bemerkenswerte Kraft des Pinsels aus,
interessiert uns aber doch nur vorübergehend. Pettcn-
kofens ungarische Szenen haben auch hier lebhafte An-
erkennung gesunden. Eine große Zukunft scheint mir
CHarlemont zu haben, wenn er nicht an Lbic-Malcrei
zugrunde geht. Seine Bilder sind von staunenswerter
Geschicklichkeit und seine Porträts sind bei einer köstlichen
Wiedergabe des Frou-Frou der Stoffe von trefflicher
Charakteristik. Charlemont scheint mir ein Schüler
Munkascys zu sein, von dem er die Sicherheit der
Zeichnung hat, doch malt er Heller und fröhlicher. Er
stellt nicht weniger als zwölf Nummern aus, darunter
neben Genre- und Bibclotbildcrn durchaus nicht lang-
weilige Erinnerungen aus dem Orient. Ernsts subtil
gemalte Orientbilder, denen wir alljährlich im Salon
begegnen, sind mir trotz ihrer Gewissenhaftigkeit und
ihres Fleißes, trotz des großen Könnens, das sie mani-
festieren, doch weniger interessant. In einem Augenblicke,
wo der gesamte Orient um uns lebensvoll wimmelt,
verliert man den Geschmack an dergleichen Dingen.
Lerch aus Prag hat den ausgezeichneten Studicnkopf
Die Ausstellung der fremden Acalerschulen auf dem Marsfelde
dem Modell finden. Die Erzielung der Wirkung durch
leuchtende Flecken ist nicht von heute. Velasquez und
Franz Hals haben in dieser Weise gemalt. Man wird
aber vergeblich suchen ihnen die Jrrtümcr nachzuwcisen,
die heut die allznschr auf den Effekt arbeitende mehr
geistreichclnde als geistreiche Schule begeht. Hinter der
geistreichelnden Technik verbirgt sich häufig nur ein geringes
Können. Diesem Umstande ist es denn auch wohl zum
Teil znznschreibcn, daß das Genre und die Landschaft
in fast allen fremden Abteilungen der Ausstellung vor-
herrscht, wenn auch nicht verkannt werden soll, daß der
realistische Zug, welcher die Künstler mit Recht znm
Festhalten der Gegenwart drängt hievon seinen Teil hat.
Man fürchtet sich vor den großen Figuren, weil man
ihre Konstruktion nicht mehr beherrscht. Das Vmstchende
soll kein Tadel, sondern eine Warnung sein. Die Pleinair-
und die impressionistische Malerei ist von den Franzosen
ansgegangen, die ursprünglich durch eine strenge akademische
Schulung die Elemente dafür besaßen, um diesen Schrilt
in die größere Freiheit der Kunst zu wagen. Füße
bleiben Füße und Hände sind Hände. Der witzigste
oder rührendste im Bilde verkörperte Gedanke bereitet
uns nur einen unvollkommenen Genuß, wenn auf die
sorgfältige Behandlung dieser Extremitäten kein Wert
gelegt ist. Der Italiener Crcmona und der Niederländer
Willy Martens z. B. besitzen eine seltene Technik. Sie
begnügen sich aber damit und lassen uns in Zweifel, ob
sie die großen Künstler sind, für die wir sie gern halten
möchten.
An dieser Effcktmalerci ohne ernste Grundlage krankt
vor allem die kleine Abteilung deutscher Künstler, die sich
den französischen Kunstprinzipien angeschlosscn. In erster
Linie Liebermann, der sich in der Zeichnung zuweilen
bis zur Lüdcrlichkcit vernachlässigt. Man sehe sich nur
aus seinem Waiscnhausbilde das im Hintergründe springende
Mädchen oder die nicht beleuchtete Partie des Gesichtes
seiner alten Frau an einem Fenster oder die Giebel an,
welche seine Amsterdamer Invaliden im Gesicht tragen.
Auch Kuehl, den ich weit über Liebcrmann stelle, läßt
an Korrektheit der Zeichnung zuweilen sehr zu wünschen
übrig. Ich denke hier hauptsächlich an seine Segelmacher.
Leihl und vor allem Meyer Claus, die sich der eine an
Holbein, der andre an Pieter van Hooch anlchnen, sind dagegen
viel gewissenhafter. Darum verkenne ich nicht und bejubele
den künstlerisch revolutionären Sinn dieser Künstler, die
eine liebevolle Beobachtung und eine seltene Feinheit des
Auges mit einer warmen künstlerischen Empfindung ver-
binden, die das vibrierende Licht mit einer seltenen
Meisterschaft zu behandeln verstehen und die wie Licber-
mann eine hervorragende Virtuosität in der Wiedergabe
von Sonncnrcflexen besitzen. Über Uhde, der hier mit
seinem Abendmahle, seiner durch den Regen überraschten
Prozession und einem Porträt die „Kleine Emilie" ver-
treten ist, an dieser Stelle noch ein Wort zu verlieren,
halte ich für überflüssig. Nur möchte ich hier konstatieren,
daß trotz des spezifisch deutschen Geistes, der sich in seinen
Bildern offenbart, die Werke des Künstlers von den
Franzosen ganz besonders geschätzt und dem besten, was
die eigene nationale Kunst produziert, als ebenbürtig an
die Seite gestellt werden. Auch Firle, in welchem
man den Schüler Uhdcs erkennt, hat mit seinem Begräbnis-
tag hier wohlverdienten Beifall gefunden. Ich habe einem
deutschen Publikum hier nicht das Können Hans Oldes,
des Landschafters Peter Paul (ein prächtiger Buchen-
wald), Hoeckers (Putzstunde auf einem Kriegsschiff),
Stauffers (ausgezeichnetes Männerporträt) zu schildern.
Bemerken will ich hier nur, daß Oberländcrs witzige
Zeichnungen hier keinen Beifall gefunden haben, sie athmen
eben allzusehr deutschen Geist, der hier unverstanden bleibt.
Auch über Meister Ko cp p in g verliere ich hier kein Wort
weiter. Seinem Ruhme vermag eine nochmalige Besprechung
seiner Stiche „Christus auf dem Calvarienbcrge" nach
Munkascy oder derjenigen nach Rembrandtschen Motiven
nichts hinzuzufügen. Menzel hat nur in einigen Gonache-
bildern seine Visitenkarte abgegeben. Darum gebührt
ihm hierfür aber doch warmer Dank, da er damit gezeigt,
daß er gegen kleinliche chauvinistische Einflüsse durchaus
unzugänglich geblieben. Bis jetzt ist hier noch kein Deutscher
verspeist, aber auch nicht einmal insultiert worden, höchstens
hat man die ausstellenden Künstler mit allerhand großen
und kleinen Medaillen bombardiert.
Die Ausstellung unsrer Bundesgenossen der Öster-
reicher läßt nach der einen Seite den Einfluß der Mün-
chener Schule, den Geschmack an großen historischen Szenen,
dem Piloiy und Makart gehuldigt, und welchem heute
noch Munkasey treu ist, wie die Anlehnung an die
französische moderne Schule namentlich auf landschaft-
lichem Gebiete erkennen, der sich der während der Aus-
stellung verstorbene hier lebende Otto von Thoren, ein
ehemaliger Kavallcrieoffizicr angeschlosscn hatte, und der
heute noch Zettel, welcher hier studierte und jetzt hier lebt
in seinen Landschaften mit ihren Bergen, Reizen und dem licht-
grauen Tone folgt. Munkascy hat seine beiden Christus-
bildcr ausgestellt. Der Effekt ist in der Ausstellung auf
dem Marsfelde nicht so groß wie in der Galerie Scdel-
mcyer, wo sie dem Publikum in einem besonderen Licht-
arrangemcnt vorgefllhrt wurden. Nichtsdestoweniger packen
sie doch gewaltig, auch in dieser ganz andre Bahnen ver-
folgenden Kunstumgcbung. Ich gestehe das um so
ehrlicher und aufrichtiger, als ich an andrer Stelle
früher einmal ganz energisch gegen eine künstlerische Ver-
irrung Munkascys aufgetreten bin. Brozik unterliegt
ebenfalls dem Einfluß der Münchner. Sein großes Bild:
„Martinitz und Slawata werden zum Fenster hinausge-
worfcn" zeichnet sich durch ein treffliches Arrangement,
auch eine bemerkenswerte Kraft des Pinsels aus,
interessiert uns aber doch nur vorübergehend. Pettcn-
kofens ungarische Szenen haben auch hier lebhafte An-
erkennung gesunden. Eine große Zukunft scheint mir
CHarlemont zu haben, wenn er nicht an Lbic-Malcrei
zugrunde geht. Seine Bilder sind von staunenswerter
Geschicklichkeit und seine Porträts sind bei einer köstlichen
Wiedergabe des Frou-Frou der Stoffe von trefflicher
Charakteristik. Charlemont scheint mir ein Schüler
Munkascys zu sein, von dem er die Sicherheit der
Zeichnung hat, doch malt er Heller und fröhlicher. Er
stellt nicht weniger als zwölf Nummern aus, darunter
neben Genre- und Bibclotbildcrn durchaus nicht lang-
weilige Erinnerungen aus dem Orient. Ernsts subtil
gemalte Orientbilder, denen wir alljährlich im Salon
begegnen, sind mir trotz ihrer Gewissenhaftigkeit und
ihres Fleißes, trotz des großen Könnens, das sie mani-
festieren, doch weniger interessant. In einem Augenblicke,
wo der gesamte Orient um uns lebensvoll wimmelt,
verliert man den Geschmack an dergleichen Dingen.
Lerch aus Prag hat den ausgezeichneten Studicnkopf