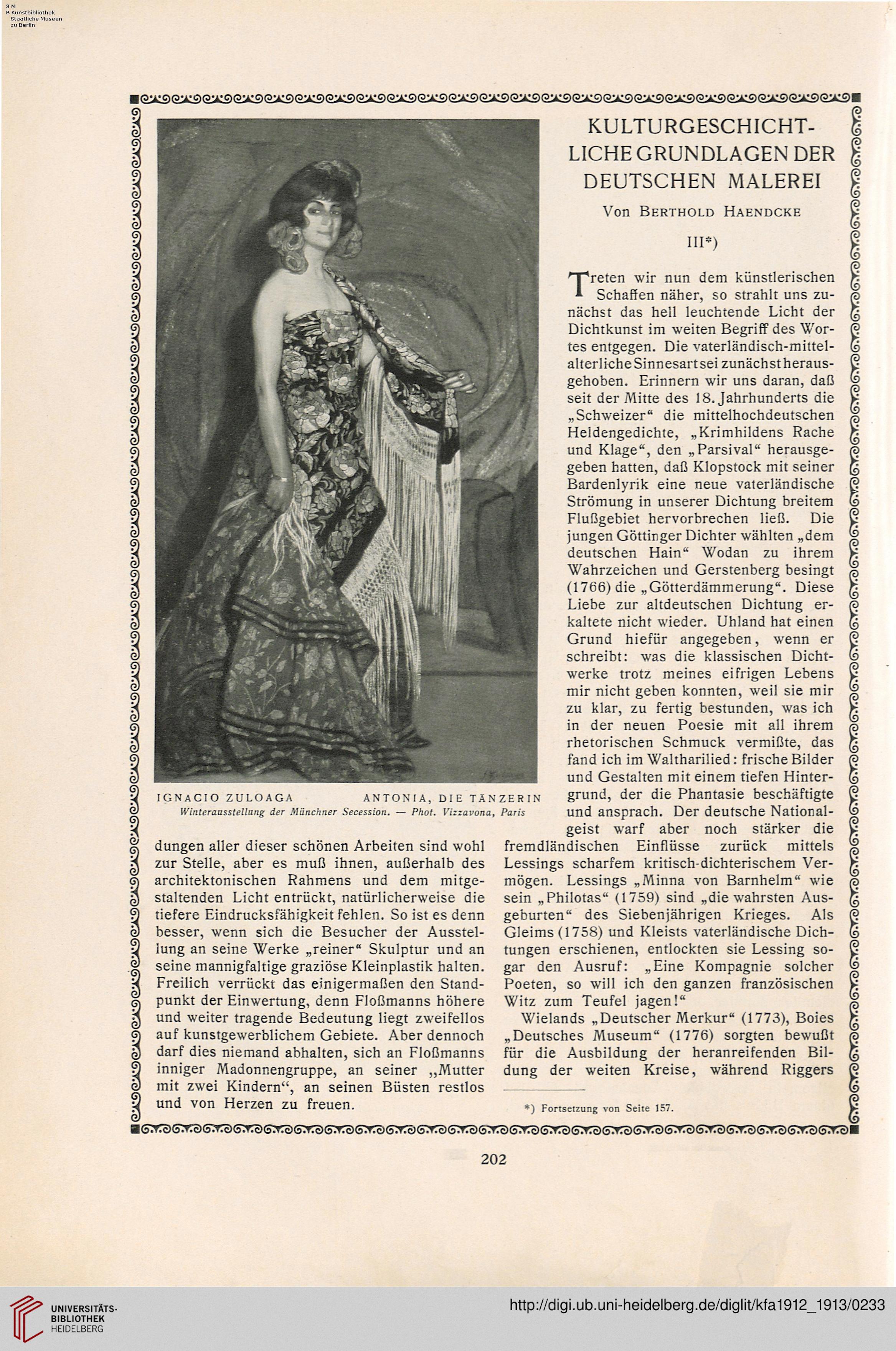KULTURGESCHICHT- !
LICHE GRUNDLAGEN DER ]
DEUTSCHEN MALEREI |
Von Berthold Haendcke ]
III*) |
Treten wir nun dem künstlerischen
Schaffen näher, so strahlt uns zu- i
nächst das hell leuchtende Licht der J
Dichtkunst im weiten Begriff des Wor- (
tes entgegen. Die vaterländisch-mittel- (
alterlicheSinnesartsei zunächst heraus- j
gehoben. Erinnern wir uns daran, daß
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die 1
„Schweizer" die mittelhochdeutschen ,
Heldengedichte, „Krimhildens Rache )
und Klage", den „Parsival" herausge- <
geben hatten, daß Klopstock mit seiner (
Bardenlyrik eine neue vaterländische j
Strömung in unserer Dichtung breitem (
Flußgebiet hervorbrechen ließ. Die )
jungen Göttinger Dichter wählten „dem )
deutschen Hain" Wodan zu ihrem )
Wahrzeichen und Gerstenberg besingt r
(1766) die „Götterdämmerung". Diese )
Liebe zur altdeutschen Dichtung er- r
kältete nicht wieder. Uhland hat einen (
Grund hiefür angegeben, wenn er (
schreibt: was die klassischen Dicht- (
werke trotz meines eifrigen Lebens )
mir nicht geben konnten, weil sie mir \
zu klar, zu fertig bestunden, was ich )
in der neuen Poesie mit all ihrem e
rhetorischen Schmuck vermißte, das /
fand ich im Waltharilied: frische Bilder l
und Gestalten mit einem tiefen Hinter- (
ignacio zuloaga Antonia, die tänzerin grund, der die Phantasie beschäftigte (
Winterausstellnng der Münchner Secession. — Phot. Vizzavona, Paris und ansprach. Der deutsche National- (
t{ geist warf aber noch stärker die )
U düngen aller dieser schönen Arbeiten sind wohl fremdländischen Einflüsse zurück mittels J
zur Stelle, aber es muß ihnen, außerhalb des Lessings scharfem kritisch-dichterischem Ver- )
architektonischen Rahmens und dem mitge- mögen. Lessings „Minna von Barnhelm" wie (
staltenden Licht entrückt, natürlicherweise die sein „Philotas" (1759) sind „die wahrsten Aus- (
tiefere Eindrucksfähigkeit fehlen. So ist es denn geburten" des Siebenjährigen Krieges. Als (
i besser, wenn sich die Besucher der Ausstel- Gleims (1758) und Kleists vaterländische Dich- (
1 lung an seine Werke „reiner" Skulptur und an tungen erschienen, entlockten sie Lessing so- (
seine mannigfaltige graziöse Kleinplastik halten, gar den Ausruf: „Eine Kompagnie solcher J
Freilich verrückt das einigermaßen den Stand- Poeten, so will ich den ganzen französischen \
I punkt der Einwertung, denn Floßmanns höhere Witz zum Teufel jagen!" 5
| und weiter tragende Bedeutung liegt zweifellos Wielands „Deutscher Merkur" (1773), Boies )
| auf kunstgewerblichem Gebiete. Aber dennoch „Deutsches Museum" (1776) sorgten bewußt r
\ darf dies niemand abhalten, sich an Floßmanns für die Ausbildung der heranreifenden Bil- (
I inniger Madonnengruppe, an seiner „Mutter dung der weiten Kreise, während Riggers (
I mit zwei Kindern", an seinen Büsten restlos - (
[ und von Herzen zu freuen. *} Fortsetzung von Seite is7. J
202
LICHE GRUNDLAGEN DER ]
DEUTSCHEN MALEREI |
Von Berthold Haendcke ]
III*) |
Treten wir nun dem künstlerischen
Schaffen näher, so strahlt uns zu- i
nächst das hell leuchtende Licht der J
Dichtkunst im weiten Begriff des Wor- (
tes entgegen. Die vaterländisch-mittel- (
alterlicheSinnesartsei zunächst heraus- j
gehoben. Erinnern wir uns daran, daß
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die 1
„Schweizer" die mittelhochdeutschen ,
Heldengedichte, „Krimhildens Rache )
und Klage", den „Parsival" herausge- <
geben hatten, daß Klopstock mit seiner (
Bardenlyrik eine neue vaterländische j
Strömung in unserer Dichtung breitem (
Flußgebiet hervorbrechen ließ. Die )
jungen Göttinger Dichter wählten „dem )
deutschen Hain" Wodan zu ihrem )
Wahrzeichen und Gerstenberg besingt r
(1766) die „Götterdämmerung". Diese )
Liebe zur altdeutschen Dichtung er- r
kältete nicht wieder. Uhland hat einen (
Grund hiefür angegeben, wenn er (
schreibt: was die klassischen Dicht- (
werke trotz meines eifrigen Lebens )
mir nicht geben konnten, weil sie mir \
zu klar, zu fertig bestunden, was ich )
in der neuen Poesie mit all ihrem e
rhetorischen Schmuck vermißte, das /
fand ich im Waltharilied: frische Bilder l
und Gestalten mit einem tiefen Hinter- (
ignacio zuloaga Antonia, die tänzerin grund, der die Phantasie beschäftigte (
Winterausstellnng der Münchner Secession. — Phot. Vizzavona, Paris und ansprach. Der deutsche National- (
t{ geist warf aber noch stärker die )
U düngen aller dieser schönen Arbeiten sind wohl fremdländischen Einflüsse zurück mittels J
zur Stelle, aber es muß ihnen, außerhalb des Lessings scharfem kritisch-dichterischem Ver- )
architektonischen Rahmens und dem mitge- mögen. Lessings „Minna von Barnhelm" wie (
staltenden Licht entrückt, natürlicherweise die sein „Philotas" (1759) sind „die wahrsten Aus- (
tiefere Eindrucksfähigkeit fehlen. So ist es denn geburten" des Siebenjährigen Krieges. Als (
i besser, wenn sich die Besucher der Ausstel- Gleims (1758) und Kleists vaterländische Dich- (
1 lung an seine Werke „reiner" Skulptur und an tungen erschienen, entlockten sie Lessing so- (
seine mannigfaltige graziöse Kleinplastik halten, gar den Ausruf: „Eine Kompagnie solcher J
Freilich verrückt das einigermaßen den Stand- Poeten, so will ich den ganzen französischen \
I punkt der Einwertung, denn Floßmanns höhere Witz zum Teufel jagen!" 5
| und weiter tragende Bedeutung liegt zweifellos Wielands „Deutscher Merkur" (1773), Boies )
| auf kunstgewerblichem Gebiete. Aber dennoch „Deutsches Museum" (1776) sorgten bewußt r
\ darf dies niemand abhalten, sich an Floßmanns für die Ausbildung der heranreifenden Bil- (
I inniger Madonnengruppe, an seiner „Mutter dung der weiten Kreise, während Riggers (
I mit zwei Kindern", an seinen Büsten restlos - (
[ und von Herzen zu freuen. *} Fortsetzung von Seite is7. J
202