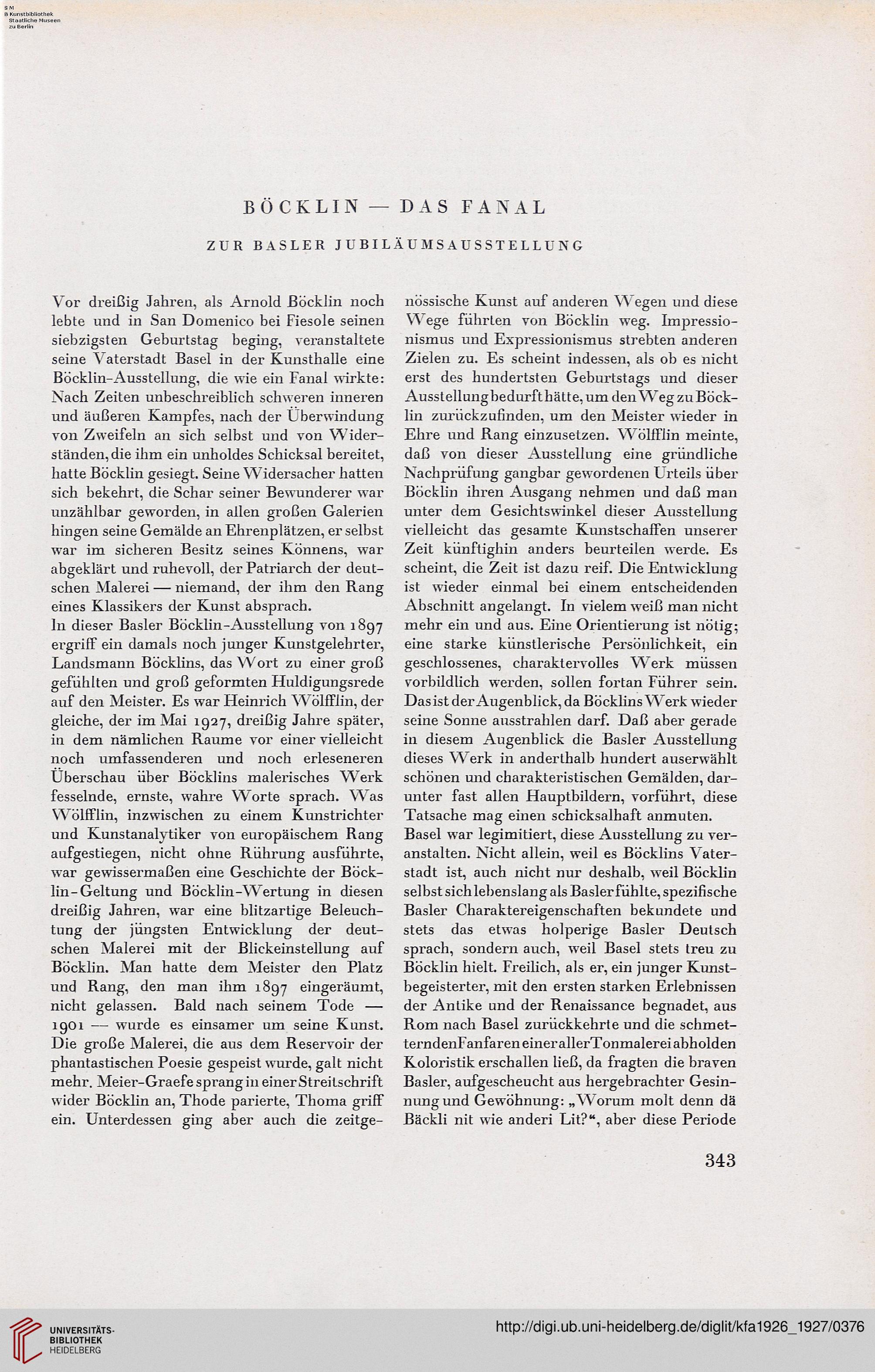BÖCKLIN — DAS FANAL
ZUR BASLER JUBILÄUMSAUSSTELLUNG
Vor dreißig Jahren, als Arnold Böcklin noch
lebte und in San Domenico bei Fiesole seinen
siebzigsten Geburtstag beging, veranstaltete
seine Vaterstadt Basel in der Kunsthalle eine
Böcklin-Ausstellung, die wie ein Fanal wirkte:
Nach Zeiten unbeschreiblich schweren inneren
und äußeren Kampfes, nach der Uberwindung
von Zweifeln an sich selbst und von Wider-
ständen, die ihm ein unholdes Schicksal bereitet,
hatte Böcklin gesiegt. Seine Widersacher hatten
sich bekehrt, die Schar seiner Bewunderer war
unzählbar geworden, in allen großen Galerien
hingen seine Gemälde an Ehrenplätzen, er selbst
war im sicheren Besitz seines Könnens, war
abgeklärt und ruhevoll, der Patriarch der deut-
schen Malerei — niemand, der ihm den Rang
eines Klassikers der Kunst absprach.
In dieser Basler Böcklin-Ausstellung von 1897
ergriff ein damals noch junger Kunstgelehrter,
Landsmann Böcklins, das Wort zu einer groß
gefühlten und groß geformten Huldigungsrede
auf den Meister. Es war Heinrich Wölfflin, der
gleiche, der im Mai 1927, dreißig Jahre später,
in dem nämlichen Räume vor einer vielleicht
noch umfassenderen und noch erleseneren
Uberschau über Böcklins malerisches Werk
fesselnde, ernste, wahre Worte sprach. Was
Wölfflin, inzwischen zu einem Kunstrichter
und Kunstanalytiker von europäischem Rang
aufgestiegen, nicht ohne Rührung ausführte,
war gewissermaßen eine Geschichte der Böck-
lin-Geltung und Böcklin-Wertung in diesen
dreißig Jahren, war eine blitzartige Beleuch-
tung der jüngsten Entwicklung der deut-
schen Malerei mit der Blickeinstellung auf
Böcklin. Man hatte dem Meister den Platz
und Rang, den man ihm 1897 eingeräumt,
nicht gelassen. Bald nach seinem Tode —
1901 — wurde es einsamer um seine Kunst.
Die große Malerei, die aus dem Reservoir der
phantastischen Poesie gespeist wurde, galt nicht
mehr. Meier-Graefe sprang in einerStreitschrift
wider Böcklin an, Thode parierte, Thoma griff
ein. Unterdessen ging aber auch die zeitge-
nössische Kunst auf anderen Wegen und diese
Wege führten von Böcklin weg. Impressio-
nismus und Expressionismus strebten anderen
Zielen zu. Es scheint indessen, als ob es nicht
erst des hundertsten Geburtstags und dieser
Ausstellunghedurft hätte, um den Weg zu Böck-
lin zurückzufinden, um den Meister wieder in
Ehre und Rang einzusetzen. Wölfflin meinte,
daß von dieser Ausstellung eine gründliche
Nachprüfung gangbar gewordenen Urteils über
Böcklin ihren Ausgang nehmen und daß man
unter dem Gesichtswinkel dieser Ausstellung
vielleicht das gesamte Kimstschaffen unserer
Zeit künftighin anders beurteilen werde. Es
scheint, die Zeit ist dazu reif. Die Entwicklung
ist wieder einmal bei einem entscheidenden
Abschnitt angelangt. In vielem weiß man nicht
mehr ein und aus. Eine Orientierung ist nötig;
eine starke künstlerische Persönlichkeit, ein
geschlossenes, charaktervolles Werk müssen
vorbildlich werden, sollen fortan Führer sein.
Das ist der Augenblick, da Böcklins Werk wieder
seine Sonne ausstrahlen darf. Daß aber gerade
in diesem Augenblick die Basler Ausstellung
dieses Werk in anderthalb hundert auserwählt
schönen und charakteristischen Gemälden, dar-
unter fast allen Hauptbildern, vorführt, diese
Tatsache mag einen schicksalhaft anmuten.
Basel war legimitiert, diese Ausstellung zu ver-
anstalten. Nicht allein, weil es Böcklins Vater-
stadt ist, auch nicht nur deshalb, weil Böcklin
selbst sich lebenslang als Basler fühlte, spezifische
Basler Charaktereigenschaften bekundete und
stets das etwas holperige Basler Deutsch
sprach, sondern auch, weil Basel stets treu zu
Böcklin hielt. Freilich, als er, ein junger Kunst-
begeisterter, mit den ersten starken Erlebnissen
der Antike und der Benaissance begnadet, aus
Rom nach Basel zurückkehrte und die schmet-
terndenFanfaren einer allerTonmalerei abholden
Koloristik erschallen ließ, da fragten die braven
Basler, aufgescheucht aus hergebrachter Gesin-
nung und Gewöhnung: „Worum molt denn dä
Bäckli nit wie anderi Lit?", aber diese Periode
343
ZUR BASLER JUBILÄUMSAUSSTELLUNG
Vor dreißig Jahren, als Arnold Böcklin noch
lebte und in San Domenico bei Fiesole seinen
siebzigsten Geburtstag beging, veranstaltete
seine Vaterstadt Basel in der Kunsthalle eine
Böcklin-Ausstellung, die wie ein Fanal wirkte:
Nach Zeiten unbeschreiblich schweren inneren
und äußeren Kampfes, nach der Uberwindung
von Zweifeln an sich selbst und von Wider-
ständen, die ihm ein unholdes Schicksal bereitet,
hatte Böcklin gesiegt. Seine Widersacher hatten
sich bekehrt, die Schar seiner Bewunderer war
unzählbar geworden, in allen großen Galerien
hingen seine Gemälde an Ehrenplätzen, er selbst
war im sicheren Besitz seines Könnens, war
abgeklärt und ruhevoll, der Patriarch der deut-
schen Malerei — niemand, der ihm den Rang
eines Klassikers der Kunst absprach.
In dieser Basler Böcklin-Ausstellung von 1897
ergriff ein damals noch junger Kunstgelehrter,
Landsmann Böcklins, das Wort zu einer groß
gefühlten und groß geformten Huldigungsrede
auf den Meister. Es war Heinrich Wölfflin, der
gleiche, der im Mai 1927, dreißig Jahre später,
in dem nämlichen Räume vor einer vielleicht
noch umfassenderen und noch erleseneren
Uberschau über Böcklins malerisches Werk
fesselnde, ernste, wahre Worte sprach. Was
Wölfflin, inzwischen zu einem Kunstrichter
und Kunstanalytiker von europäischem Rang
aufgestiegen, nicht ohne Rührung ausführte,
war gewissermaßen eine Geschichte der Böck-
lin-Geltung und Böcklin-Wertung in diesen
dreißig Jahren, war eine blitzartige Beleuch-
tung der jüngsten Entwicklung der deut-
schen Malerei mit der Blickeinstellung auf
Böcklin. Man hatte dem Meister den Platz
und Rang, den man ihm 1897 eingeräumt,
nicht gelassen. Bald nach seinem Tode —
1901 — wurde es einsamer um seine Kunst.
Die große Malerei, die aus dem Reservoir der
phantastischen Poesie gespeist wurde, galt nicht
mehr. Meier-Graefe sprang in einerStreitschrift
wider Böcklin an, Thode parierte, Thoma griff
ein. Unterdessen ging aber auch die zeitge-
nössische Kunst auf anderen Wegen und diese
Wege führten von Böcklin weg. Impressio-
nismus und Expressionismus strebten anderen
Zielen zu. Es scheint indessen, als ob es nicht
erst des hundertsten Geburtstags und dieser
Ausstellunghedurft hätte, um den Weg zu Böck-
lin zurückzufinden, um den Meister wieder in
Ehre und Rang einzusetzen. Wölfflin meinte,
daß von dieser Ausstellung eine gründliche
Nachprüfung gangbar gewordenen Urteils über
Böcklin ihren Ausgang nehmen und daß man
unter dem Gesichtswinkel dieser Ausstellung
vielleicht das gesamte Kimstschaffen unserer
Zeit künftighin anders beurteilen werde. Es
scheint, die Zeit ist dazu reif. Die Entwicklung
ist wieder einmal bei einem entscheidenden
Abschnitt angelangt. In vielem weiß man nicht
mehr ein und aus. Eine Orientierung ist nötig;
eine starke künstlerische Persönlichkeit, ein
geschlossenes, charaktervolles Werk müssen
vorbildlich werden, sollen fortan Führer sein.
Das ist der Augenblick, da Böcklins Werk wieder
seine Sonne ausstrahlen darf. Daß aber gerade
in diesem Augenblick die Basler Ausstellung
dieses Werk in anderthalb hundert auserwählt
schönen und charakteristischen Gemälden, dar-
unter fast allen Hauptbildern, vorführt, diese
Tatsache mag einen schicksalhaft anmuten.
Basel war legimitiert, diese Ausstellung zu ver-
anstalten. Nicht allein, weil es Böcklins Vater-
stadt ist, auch nicht nur deshalb, weil Böcklin
selbst sich lebenslang als Basler fühlte, spezifische
Basler Charaktereigenschaften bekundete und
stets das etwas holperige Basler Deutsch
sprach, sondern auch, weil Basel stets treu zu
Böcklin hielt. Freilich, als er, ein junger Kunst-
begeisterter, mit den ersten starken Erlebnissen
der Antike und der Benaissance begnadet, aus
Rom nach Basel zurückkehrte und die schmet-
terndenFanfaren einer allerTonmalerei abholden
Koloristik erschallen ließ, da fragten die braven
Basler, aufgescheucht aus hergebrachter Gesin-
nung und Gewöhnung: „Worum molt denn dä
Bäckli nit wie anderi Lit?", aber diese Periode
343