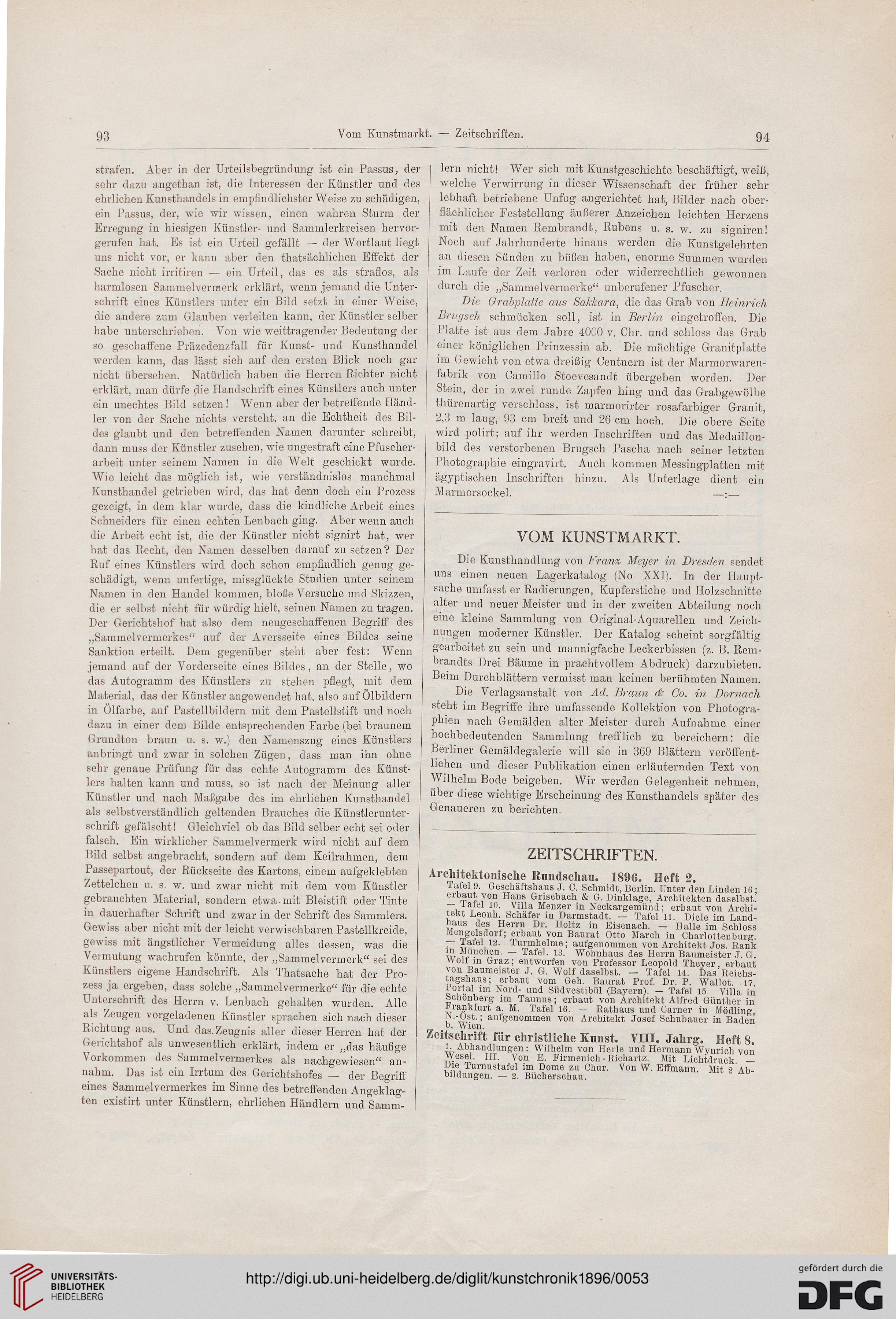93
Vom Kunstmarkt. — Zeitschriften.
94
strafen. Aber in der Urteilsbegründung ist ein Passus, der
sehr dazu angetban ist, die Interessen der Künstler und des
ehrlichen Kunsthandels in empfindlichster Weise zu schädigen,
ein Passus, der, wie wir wissen, einen wahren Sturm der
Erregung in hiesigen Künstler- und Sammlerkreisen hervor-
gerufen hat. Es ist ein Urteil gefällt — der Wortlaut liegt
uns nicht vor, er kann aber den thatsächlichen Effekt der
Sache nicht irritiren — ein Urteil, das es als straflos, als
harmlosen Sammelvermerk erklärt, wenn jemand die Unter-
schrift eines Künstlers unter ein Bild setzt in einer Weise,
die andere zum Glauben verleiten kann, der Künstler selber
habe unterschrieben. Von wie weittragender Bedeutung der
so geschaffene Präzedenzfall für Kunst- und Kunsthandel
werden kann, das lässt sich auf den ersten Blick noch gar
nicht übersehen. Natürlich haben die Herren Richter nicht
erklärt, man dürfe die Handschrift eines Künstlers auch unter
ein unechtes Bild setzen ! Wenn aber der betreffende Händ-
ler von der Sache nichts versteht, an die Echtheit des Bil-
des glaubt und den betreffenden Namen darunter schreibt,
dann muss der Künstler zusehen, wie ungestraft eine Pfuscher-
arbeit unter seinem Namen in die Welt geschickt wurde.
Wie leicht das möglich ist, wie verständnislos manchmal
Kunsthandel getrieben wird, das hat denn doch ein Prozess
gezeigt, in dem klar wurde, dass die kindliche Arbeit eines
Schneiders für einen echten Lenbach ging. Aber wenn auch
die Arbeit echt ist, die der Künstler nicht signirt hat, wer
hat das Recht, den Namen desselben darauf zu setzen? Der
Ruf eines Künstlers wird doch schon empfindlich genug ge-
schädigt, wenn unfertige, missglückte Studien unter seinem
Namen in den Handel kommen, bloße Versuche und Skizzen,
die er selbst nicht für würdig hielt, seinen Namen zu tragen.
Der Gerichtshof hat also dem neugeschaffenen Begriff des
„Sammelvermerkes" auf der Aversseite eines Bildes seine
Sanktion erteilt. Dem gegenüber steht aber fest: Wenn
jemand auf der Vorderseite eines Bildes, an der Stelle, wo
das Autogramm des Künstlers zu stehen pflegt, ruit dem
Material, das der Künstler angewendet hat. also auf Ölbildern
in Ölfarbe, auf Pastellbildern mit dem Pastellstift und noch
dazu in einer dem Bilde entsprechenden Farbe (bei braunem
Grundton braun u. s. w.) den Namenszug eines Künstlers
anbringt und zwar in solchen Zügen, duss man ihn ohne
sehr genaue Prüfung für das echte Autogramm des Künst-
lers halten kann und muss, so ist nach der Meinung aller
Künstler und nach Maßgabe des im ehrlichen Kunsthandel
als selbstverständlich geltenden Brauches die Künstlerunter-
schrift gefälscht ! Gleichviel ob das Bild selber echt sei oder
falsch. Ein wirklicher Sammelvermerk wird nicht auf dem
Bild selbst angebracht, sondern auf dem Keilrahmen, dem
Passepartout, der Rückseite des Kartons., einem aufgeklebten
Zettelchen u. s. w. und zwar nicht mit dem vom Künstler
gebrauchten Material, sondern etwa.mit Bleistift oder Tinte
in dauerhafter Schrift und zwar in der Schrift des Sammlers.
Gewiss aber nicht mit der leicht verwischbaren Pastellkreide,
gewiss mit ängstlicher Vermeidung alles dessen, was die
Vermutung wachrufen könnte, der „Sammelvermerk" sei des
Künstlers eigene Handschrift. Als Thatsache hat der Pro-
zess ja ergeben, dass solche „Sammclvermerke" für die echte
Unterschrift des Herrn v. Lenbach gehalten wurden. Alle
als Zeugen vorgeladenen Künstler sprachen sich nach dieser
Richtung aus. Und das.Zeugnis aller dieser Herren hat der |
Gerichtshof als unwesentlich erklärt, indem er „das häufige
Vorkommen des Sammelvermerkes als nachgewiesen" an-
nahm. Das ist ein Irrtum des Gerichtshofes — der Begriff
eines Sammelvermerkes im Sinne des betreffenden Angeklag-
ten existirt unter Künstlern, ehrlichen Händlern und Samm-
lern nicht! Wer sich mit Kunstgeschichte beschäftigt, weiß,
welche Verwirrung in dieser Wissenschaft der früher sehr
lebhaft betriebene Unfug angerichtet hat, Bilder nach ober-
flächlicher Feststellung äußerer Anzeichen leichten Herzens
mit den Namen Rembrandt, Rubens u. s. w. zu signiren!
Noch auf Jahrhunderte hinaus werden die Kunstgelehrten
an diesen Sünden zu büßen haben, enorme Summen wurden
im Laufe der Zeit verloren oder widerrechtlich gewonnen
durch die „Sammelvermerke" unberufener Pfuscher.
Die Grabplatte aus Sakkara, die das Grab von Heinrich
Brut/seil schmücken soll, ist in Berlin eingetroffen. Die
Platte ist aus dem Jahre 4000 v. Chr. und schloss das Grab
einer königlichen Prinzessin ab. Die mächtige Granitplatte
im Gewicht von etwa dreißig Centnern ist der Marmorwaren-
fabrik von Camillo Stoevesandt übergeben worden. Der
Stein, der in zwei runde Zapfen hing und das Grabgewölbe
thürenartig verschloss, ist marmorirter rosafarbiger Granit,
2,3 m lang, 93 cm breit und 20 cm hoch. Die obere Seite
wird polirt; auf ihr werden Inschriften und das Medaillon-
bild des verstorbenen Brugsch Pascha nach seiner letzten
Photographie eingraviit. Auch kommen Messingplatten mit
ägyptischen Inschriften hinzu. Als Unterlage dient ein
Marmorsockel. —:—
VOM KUNSTMARKT.
Die Kunsthandlung von Franz Meyer in Dresden sendet
uns einen neuen Lagerkatalog (No XXI). In der Haupt-
sache umfasst er Radierungen, Kupferstiche und Holzschnitte
alter und neuer Meister und in der zweiten Abteilung noch
eine kleine Sammlung von Original-Aquarellen und Zeich-
nungen moderner Künstler. Der Katalog scheint sorgfältig
gearbeitet zu sein und mannigfache Leckerbissen (z. B. Rem-
brandts Drei Bäume in prachtvollem Abdruck) darzubieten.
Beim Durchblättern vermisst man keinen berühmten Namen.
Die Verlagsanstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach
steht im Begriffe ihre umfassende Kollektion von Photogra-
phien nach Gemälden alter Meister durch Aufnahme einer
hochbedeutenden Sammlung trefflich zu bereichern: die
Berliner Gemäldegalerie will sie in 369 Blättern veröffent-
lichen und dieser Publikation einen erläuternden Text von
Wilhelm Bode beigeben. Wir werden Gelegenheit nehmen,
über diese wichtige Erscheinung des Kunsthandels später des
Genaueren zu berichten.
ZEITSCHRIFTEN.
Architektonische Rundschau. 1896. Heft 2.
Tafel 9. Geschäftshaus J. C. Schmidt, Berlin. Unter den Linden lß;
erbaut von Hans Grisebach & G. Dinklage, Architekten daselbst.
— Tafel in. Villa Menzer in Neckargemünd; erbaut von Archi-
tekt Leonh. Schäfer in Darmstadt. — Tafel 11. Diele im Land-
haus des Herrn Dr. Holtz in Eisenach. — Halle im Schloss
Mengelsdorf; erbaut von Baurat Otto March in Charlottenburg.
— Tatel 12. Turmhelme; aufgenommen von Architekt Jos. Rank
in München. — Tafel. 13. Wohnhaus des Herrn Baumeister ,T. G.
vv olf in Graz; entworfen von Professor Leopold Theyer, erbaut
von Baumeister J. G. Wolf daselbst. — Tafel 14. Das Reichs-
tagshaus; erbaut vom Geh. Baurat Prof. Dr. P. Wallot. 17.
Portal im Nord- uud Südvestibiil (Bayern). — Tafel 15. Villa in
Schönberg im Taunus; erbaut von Architekt Alfred Günther in
Frankfurt a. M. Tafel 16. — Rathaus und Carner in Mödling,
N.-Ost.; aufgenommen von Architekt Josef Schubauer in Baden
b. Wien.
Zeitschrift für christliche Kunst. VIII. Jahrg. Heft 8.
1. Abhandlungen: Wilhelm von Heile und Hermann Wynrich von
Wesel. III. Von E. Finnenich-Kicuartz. Mit Lichtdruck —
Die Turnustafel im Dome zu Chur. Von W. Effmann. Mit 2 Ab-
bildungen. — 2. Bücherschau.
Vom Kunstmarkt. — Zeitschriften.
94
strafen. Aber in der Urteilsbegründung ist ein Passus, der
sehr dazu angetban ist, die Interessen der Künstler und des
ehrlichen Kunsthandels in empfindlichster Weise zu schädigen,
ein Passus, der, wie wir wissen, einen wahren Sturm der
Erregung in hiesigen Künstler- und Sammlerkreisen hervor-
gerufen hat. Es ist ein Urteil gefällt — der Wortlaut liegt
uns nicht vor, er kann aber den thatsächlichen Effekt der
Sache nicht irritiren — ein Urteil, das es als straflos, als
harmlosen Sammelvermerk erklärt, wenn jemand die Unter-
schrift eines Künstlers unter ein Bild setzt in einer Weise,
die andere zum Glauben verleiten kann, der Künstler selber
habe unterschrieben. Von wie weittragender Bedeutung der
so geschaffene Präzedenzfall für Kunst- und Kunsthandel
werden kann, das lässt sich auf den ersten Blick noch gar
nicht übersehen. Natürlich haben die Herren Richter nicht
erklärt, man dürfe die Handschrift eines Künstlers auch unter
ein unechtes Bild setzen ! Wenn aber der betreffende Händ-
ler von der Sache nichts versteht, an die Echtheit des Bil-
des glaubt und den betreffenden Namen darunter schreibt,
dann muss der Künstler zusehen, wie ungestraft eine Pfuscher-
arbeit unter seinem Namen in die Welt geschickt wurde.
Wie leicht das möglich ist, wie verständnislos manchmal
Kunsthandel getrieben wird, das hat denn doch ein Prozess
gezeigt, in dem klar wurde, dass die kindliche Arbeit eines
Schneiders für einen echten Lenbach ging. Aber wenn auch
die Arbeit echt ist, die der Künstler nicht signirt hat, wer
hat das Recht, den Namen desselben darauf zu setzen? Der
Ruf eines Künstlers wird doch schon empfindlich genug ge-
schädigt, wenn unfertige, missglückte Studien unter seinem
Namen in den Handel kommen, bloße Versuche und Skizzen,
die er selbst nicht für würdig hielt, seinen Namen zu tragen.
Der Gerichtshof hat also dem neugeschaffenen Begriff des
„Sammelvermerkes" auf der Aversseite eines Bildes seine
Sanktion erteilt. Dem gegenüber steht aber fest: Wenn
jemand auf der Vorderseite eines Bildes, an der Stelle, wo
das Autogramm des Künstlers zu stehen pflegt, ruit dem
Material, das der Künstler angewendet hat. also auf Ölbildern
in Ölfarbe, auf Pastellbildern mit dem Pastellstift und noch
dazu in einer dem Bilde entsprechenden Farbe (bei braunem
Grundton braun u. s. w.) den Namenszug eines Künstlers
anbringt und zwar in solchen Zügen, duss man ihn ohne
sehr genaue Prüfung für das echte Autogramm des Künst-
lers halten kann und muss, so ist nach der Meinung aller
Künstler und nach Maßgabe des im ehrlichen Kunsthandel
als selbstverständlich geltenden Brauches die Künstlerunter-
schrift gefälscht ! Gleichviel ob das Bild selber echt sei oder
falsch. Ein wirklicher Sammelvermerk wird nicht auf dem
Bild selbst angebracht, sondern auf dem Keilrahmen, dem
Passepartout, der Rückseite des Kartons., einem aufgeklebten
Zettelchen u. s. w. und zwar nicht mit dem vom Künstler
gebrauchten Material, sondern etwa.mit Bleistift oder Tinte
in dauerhafter Schrift und zwar in der Schrift des Sammlers.
Gewiss aber nicht mit der leicht verwischbaren Pastellkreide,
gewiss mit ängstlicher Vermeidung alles dessen, was die
Vermutung wachrufen könnte, der „Sammelvermerk" sei des
Künstlers eigene Handschrift. Als Thatsache hat der Pro-
zess ja ergeben, dass solche „Sammclvermerke" für die echte
Unterschrift des Herrn v. Lenbach gehalten wurden. Alle
als Zeugen vorgeladenen Künstler sprachen sich nach dieser
Richtung aus. Und das.Zeugnis aller dieser Herren hat der |
Gerichtshof als unwesentlich erklärt, indem er „das häufige
Vorkommen des Sammelvermerkes als nachgewiesen" an-
nahm. Das ist ein Irrtum des Gerichtshofes — der Begriff
eines Sammelvermerkes im Sinne des betreffenden Angeklag-
ten existirt unter Künstlern, ehrlichen Händlern und Samm-
lern nicht! Wer sich mit Kunstgeschichte beschäftigt, weiß,
welche Verwirrung in dieser Wissenschaft der früher sehr
lebhaft betriebene Unfug angerichtet hat, Bilder nach ober-
flächlicher Feststellung äußerer Anzeichen leichten Herzens
mit den Namen Rembrandt, Rubens u. s. w. zu signiren!
Noch auf Jahrhunderte hinaus werden die Kunstgelehrten
an diesen Sünden zu büßen haben, enorme Summen wurden
im Laufe der Zeit verloren oder widerrechtlich gewonnen
durch die „Sammelvermerke" unberufener Pfuscher.
Die Grabplatte aus Sakkara, die das Grab von Heinrich
Brut/seil schmücken soll, ist in Berlin eingetroffen. Die
Platte ist aus dem Jahre 4000 v. Chr. und schloss das Grab
einer königlichen Prinzessin ab. Die mächtige Granitplatte
im Gewicht von etwa dreißig Centnern ist der Marmorwaren-
fabrik von Camillo Stoevesandt übergeben worden. Der
Stein, der in zwei runde Zapfen hing und das Grabgewölbe
thürenartig verschloss, ist marmorirter rosafarbiger Granit,
2,3 m lang, 93 cm breit und 20 cm hoch. Die obere Seite
wird polirt; auf ihr werden Inschriften und das Medaillon-
bild des verstorbenen Brugsch Pascha nach seiner letzten
Photographie eingraviit. Auch kommen Messingplatten mit
ägyptischen Inschriften hinzu. Als Unterlage dient ein
Marmorsockel. —:—
VOM KUNSTMARKT.
Die Kunsthandlung von Franz Meyer in Dresden sendet
uns einen neuen Lagerkatalog (No XXI). In der Haupt-
sache umfasst er Radierungen, Kupferstiche und Holzschnitte
alter und neuer Meister und in der zweiten Abteilung noch
eine kleine Sammlung von Original-Aquarellen und Zeich-
nungen moderner Künstler. Der Katalog scheint sorgfältig
gearbeitet zu sein und mannigfache Leckerbissen (z. B. Rem-
brandts Drei Bäume in prachtvollem Abdruck) darzubieten.
Beim Durchblättern vermisst man keinen berühmten Namen.
Die Verlagsanstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach
steht im Begriffe ihre umfassende Kollektion von Photogra-
phien nach Gemälden alter Meister durch Aufnahme einer
hochbedeutenden Sammlung trefflich zu bereichern: die
Berliner Gemäldegalerie will sie in 369 Blättern veröffent-
lichen und dieser Publikation einen erläuternden Text von
Wilhelm Bode beigeben. Wir werden Gelegenheit nehmen,
über diese wichtige Erscheinung des Kunsthandels später des
Genaueren zu berichten.
ZEITSCHRIFTEN.
Architektonische Rundschau. 1896. Heft 2.
Tafel 9. Geschäftshaus J. C. Schmidt, Berlin. Unter den Linden lß;
erbaut von Hans Grisebach & G. Dinklage, Architekten daselbst.
— Tafel in. Villa Menzer in Neckargemünd; erbaut von Archi-
tekt Leonh. Schäfer in Darmstadt. — Tafel 11. Diele im Land-
haus des Herrn Dr. Holtz in Eisenach. — Halle im Schloss
Mengelsdorf; erbaut von Baurat Otto March in Charlottenburg.
— Tatel 12. Turmhelme; aufgenommen von Architekt Jos. Rank
in München. — Tafel. 13. Wohnhaus des Herrn Baumeister ,T. G.
vv olf in Graz; entworfen von Professor Leopold Theyer, erbaut
von Baumeister J. G. Wolf daselbst. — Tafel 14. Das Reichs-
tagshaus; erbaut vom Geh. Baurat Prof. Dr. P. Wallot. 17.
Portal im Nord- uud Südvestibiil (Bayern). — Tafel 15. Villa in
Schönberg im Taunus; erbaut von Architekt Alfred Günther in
Frankfurt a. M. Tafel 16. — Rathaus und Carner in Mödling,
N.-Ost.; aufgenommen von Architekt Josef Schubauer in Baden
b. Wien.
Zeitschrift für christliche Kunst. VIII. Jahrg. Heft 8.
1. Abhandlungen: Wilhelm von Heile und Hermann Wynrich von
Wesel. III. Von E. Finnenich-Kicuartz. Mit Lichtdruck —
Die Turnustafel im Dome zu Chur. Von W. Effmann. Mit 2 Ab-
bildungen. — 2. Bücherschau.