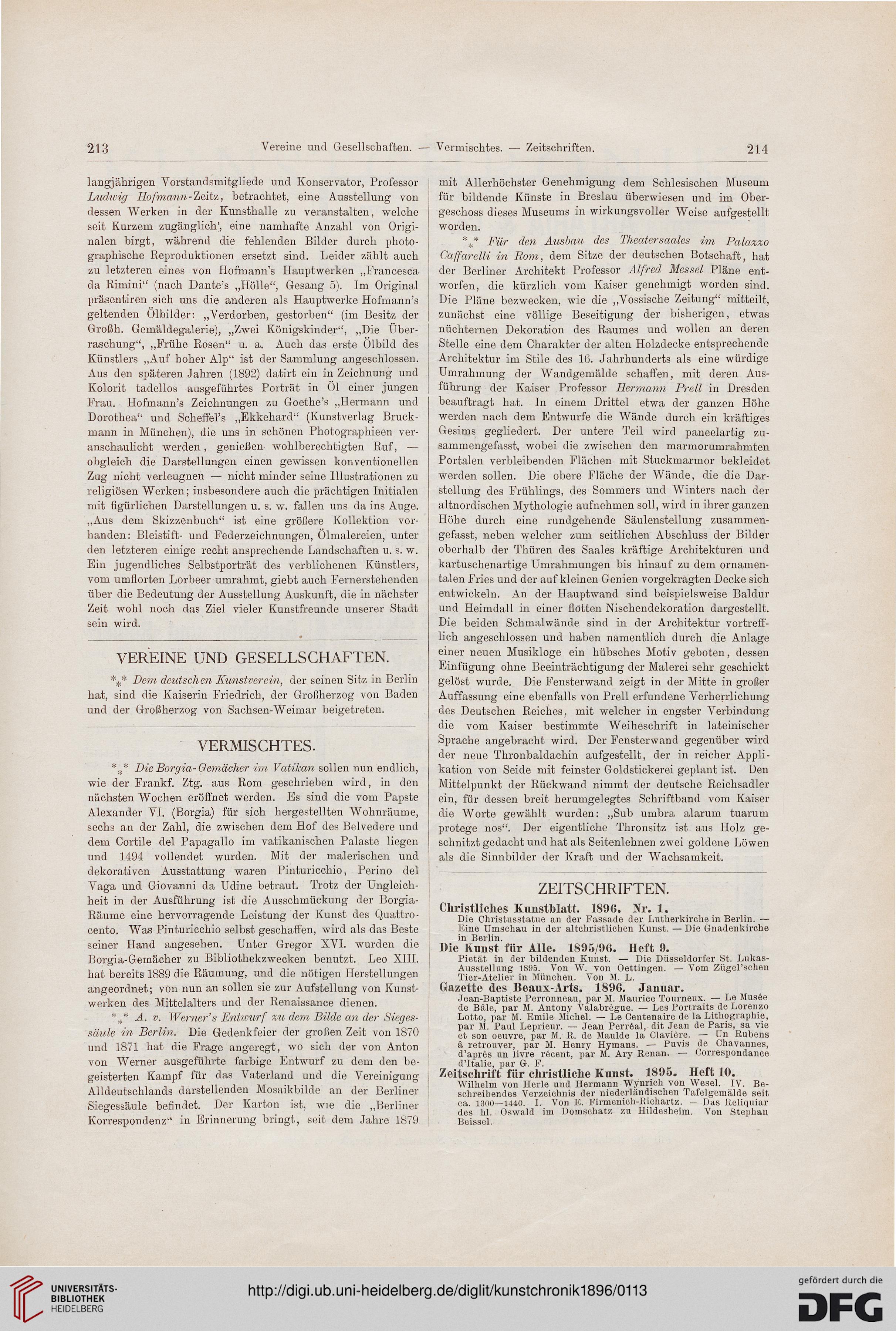21 3 Vereine und Gesellschaften. —
langjährigen Vorstandsmitgliede und Konservator, Professor
Ludwig Hofman?i-Ze\tz, betrachtet, eine Ausstellung von
dessen Werken in der Kunsthalle zu veranstalten, welche
seit Kurzem zugänglich', eine namhafte Anzahl von Origi-
nalen birgt, während die fehlenden Bilder durch photo-
graphische Reproduktionen ersetzt sind. Leider zählt auch
zu letzteren eines von Hofmann's Hauptwerken „Franeesca
da Rimini" (nach Dante's „Hölle", Gesang 5). Im Original
präsentiren sich uns die anderen als Hauptwerke Hofmann's
geltenden Ölbilder: „Verdorben, gestorben" (im Besitz der
Großh. Gemäldegalerie), „Zwei Königskinder", „Die Über-
raschung", „Frühe Rosen" u. a. Auch das erste Ölbild des
Künstlers „Auf hoher Alp" ist der Sammlung angeschlossen.
Aus den späteren Jahren (1892) datirt ein in Zeichnung und .'
Kolorit tadellos aasgeführtes Porträt in Öl einer jungen
Frau. Hofmann's Zeichnungen zu Goethe's „Hermann und
Dorothea" und Scheffel's „Ekkehard" (Kunstverlag Bruck-
mann in München), die uns in schönen Photographieen ver-
anschaulicht werden, genießen wohlberechtigten Ruf, —
obgleich die Darstellungen einen gewissen konventionellen
Zug nicht verleugnen — nicht minder seine Illustrationen zu
religiösen Werken; insbesondere auch die prächtigen Initialen
mit figürlichen Darstellungen u. s. w. fallen uns da ins Auge.
„Aus dem Skizzenbuch" ist eine größere Kollektion vor-
banden: Bleistift- und Federzeichnungen, Ölmalereien, unter
den letzteren einige recht ansprechende Landschaften u. s. w.
Ein jugendliches Selbstporträt des verblichenen Künstlers,
vom umflorten Lorbeer umrahmt, giebt auch Fernerstehenden
über die Bedeutung der Ausstellung Auskunft, die in nächster
Zeit wohl noch das Ziel vieler Kunstfreunde unserer Stadt
sein wird.
VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.
*#* Dem deutschen Kunstverein, der seinen Sitz in Berlin
hat, sind die Kaiserin Friedrich, der Großherzog von Baden
und der Großherzog von Sachsen-Weimar beigetreten.
VERMISCHTES.
*,„* Die Borgia-Gemächer im Vatikan sollen nun endlich,
wie der Frankf. Ztg. aus Rom geschrieben wird, in den
nächsten Wochen eröffnet werden. Es sind die vom Papste
Alexander VI. (Borgia) für sich hergestellten Wohnräume,
sechs an der Zahl, die zwischen dem Hof des Belvedere und
dem Cortile del Papagallo im vatikanischen Palaste liegen
und 1494 vollendet wurden. Mit der malerischen und
dekorativen Ausstattung waren Pinturicchio, Perino de]
Vaga und Giovanni da Udine betraut. Trotz der Ungleich-
heit in der Ausführung ist die Ausschmückung der Borgia-
Räume eine hervorragende Leistung der Kunst des Quattro-
cento. Was Pinturicchio selbst geschaffen, wird als das Beste
seiner Hand angesehen. Unter Gregor XVI. wurden die
Borgia-Gemächer zu Bibliothekzwecken benutzt. Leo XIII.
hat bereits 1889 die Räumung, und die nötigen Herstellungen
angeordnet; von nun an sollen sie zur Aufstellung von Kunst-
werken des Mittelalters und der Renaissance dienen.
*„,* A. v. Werner's Entwurf Xu dem Bilde an der Sieges-
säule in Berlin. Die Gedenkfeier der großen Zeit von 1870
und 1871 hat die Frage angeregt, wo sich der von Anton
von Werner ausgeführte farbige Entwurf zu dem den be-
geisterten Kampf für das Vaterland und die Vereinigung
Alldeutschlands darstellenden Mosaikbilde an der Berliner
Siegessäule befindet. Der Karton ist, wie die „Berliner
Korrespondenz" in Erinnerung bringt, seit dem Jahre 1879
Vermischtes. — Zeitschriften. 214
mit Allerhöchster Genehmigung dem Schlesischen Museum
für bildende Künste in Breslau überwiesen und im Ober-
geschoss dieses Museums in wirkungsvoller Weise aufgestellt
worden.
*„* Für den Ausbau des Theatersaales im Palaxxo
Caffarelli in Rom, dem Sitze der deutschen Botschaft, bat
der Berliner Architekt Professor Alfred Messel Pläne ent-
worfen, die kürzlich vom Kaiser genehmigt worden sind.
Die Pläne bezwecken, wie die „Vossische Zeitung" mitteilt,
zunächst eine völlige Beseitigung der bisherigen, etwas
nüchternen Dekoration des Raumes und wollen an deren
Stelle eine dem Charakter der alten Holzdecke entsprechende
Architektur im Stile des 10. Jahrhunderts als eine würdige
Umrahmung der Wandgemälde schaffen, mit deren Aus-
führung der Kaiser Professor Hermann Prell in Dresden
beauftragt hat. In einem Drittel etwa der ganzen Höhe
werden nach dem Entwürfe die Wände durch ein kräftiges
Gesims gegliedert. Der untere Teil wird paneelartig zu-
sammengefasst, wobei die zwischen den marmorumrahmten
Portalen verbleibenden Flächen mit Stuckmarmor bekleidet
werden sollen. Die obere Fläche der Wände, die die Dar-
stellung des Frühlings, des Sommers und Winters nach der
altnordischen Mythologie aufnehmen soll, wird in ihrer ganzen
Höhe durch eine rundgehende Säulenstellung zusammen-
gefasst, neben welcher zum seitlichen Abschluss der Bilder
oberhalb der Thüren des Saales kräftige Architekturen und
kartuschenartige Umrahmungen bis hinauf zu dem ornamen-
talen Fries und der auf kleinen Genien vorgekragten Decke sich
entwickeln. An der Hauptwand sind beispielsweise Baidur
und Heimdali in einer flotten Nischendekoration dargestellt.
Die beiden Schmalwände sind in der Architektur vortreff-
lich angeschlossen und haben namentlich durch die Anlage
einer neuen Musikloge ein hübsches Motiv geboten, dessen
Einfügung ohne Beeinträchtigung der Malerei sehr geschickt
gelöst wurde. Die Fensterwand zeigt in der Mitte in großer
Auffassung eine ebenfalls von Prell erfundene Verherrlichung
des Deutschen Reiches, mit welcher in engster Verbindung
die vom Kaiser bestimmte Weiheschrift in lateinischer
Sprache angebracht wird. Der Fensterwand gegenüber wird
der neue Thronbaldachin aufgestellt, der in reicher Appli-
kation von Seide mit feinster Goldstickerei geplant ist. Den
Mittelpunkt der Rückwand nimmt der deutsche Reichsadler
ein, für dessen breit herumgelegtes Schriftband vom Kaiser
die Worte gewählt wurden: „Sub umbra alarum tuarutn
protege nos". Der eigentliche Thronsitz ist aus Holz ge-
schnitzt gedacht und hat als Seitenlehnen zwei goldene Löwen
als die Sinnbilder der Kraft und der Wachsamkeit.
ZEITSCHRIFTEN.
Christliches Kunsthlatt. 189«. Nr. 1.
Die Christusstatue au der Fassade der Lutlierkirche in Berlin. —
Eine Umschau in der altchristlichen Kunst. — Die Gnadenkirche
in Berlin.
Die Kunst für Alle. 1895/i)(S. Heft 9.
Pietät in der bildenden Kunst. — Die Düsseldorfer St. Lukas-
Ausstellung 18!)5. Von W. von Oettingen. — Vom Zügel'schen
Tier-Atelier in München. Von M. L.
Gazette des Beaux-Arts. 1896. Jauuar.
Jean-Baptiste Perronneau, par M. Maurice Tourneux. — Le Musee
de Bäle, par M. Antony Valabregue. — Les Portraits de Lorenzo
Lotto, par M. Emile Michel. — Le Centenaire de la Lithographie,
par M. Paul Leprieur. — Jean Perreal, dit Jean de Paris, sa vie
et son Oeuvre, par M. R. de Maulde la Claviere. — Un Rubens
ä retrouver, par M. Henry Hymans. — Puvis de Chavannes,
d'apres un livre rfecent, par M. Ary Renan. — Correspondance
d'Italie, par G-. F.
Zeitschrift für christliche Kunst. 1895. Heft 10.
Wilhelm von Heile und Hermann Wynrich von Wesel. IV. Be-
schreibendes Verzeichnis der niederländischen Tafelgemälde seit,
ca. 1300—1440. I. Von E. Firmeuieh-Kicbartz. — Das Reliquiar
des hl. Oswald im Domschatz zu Hildesheim. Von Stephan
Beissel.
langjährigen Vorstandsmitgliede und Konservator, Professor
Ludwig Hofman?i-Ze\tz, betrachtet, eine Ausstellung von
dessen Werken in der Kunsthalle zu veranstalten, welche
seit Kurzem zugänglich', eine namhafte Anzahl von Origi-
nalen birgt, während die fehlenden Bilder durch photo-
graphische Reproduktionen ersetzt sind. Leider zählt auch
zu letzteren eines von Hofmann's Hauptwerken „Franeesca
da Rimini" (nach Dante's „Hölle", Gesang 5). Im Original
präsentiren sich uns die anderen als Hauptwerke Hofmann's
geltenden Ölbilder: „Verdorben, gestorben" (im Besitz der
Großh. Gemäldegalerie), „Zwei Königskinder", „Die Über-
raschung", „Frühe Rosen" u. a. Auch das erste Ölbild des
Künstlers „Auf hoher Alp" ist der Sammlung angeschlossen.
Aus den späteren Jahren (1892) datirt ein in Zeichnung und .'
Kolorit tadellos aasgeführtes Porträt in Öl einer jungen
Frau. Hofmann's Zeichnungen zu Goethe's „Hermann und
Dorothea" und Scheffel's „Ekkehard" (Kunstverlag Bruck-
mann in München), die uns in schönen Photographieen ver-
anschaulicht werden, genießen wohlberechtigten Ruf, —
obgleich die Darstellungen einen gewissen konventionellen
Zug nicht verleugnen — nicht minder seine Illustrationen zu
religiösen Werken; insbesondere auch die prächtigen Initialen
mit figürlichen Darstellungen u. s. w. fallen uns da ins Auge.
„Aus dem Skizzenbuch" ist eine größere Kollektion vor-
banden: Bleistift- und Federzeichnungen, Ölmalereien, unter
den letzteren einige recht ansprechende Landschaften u. s. w.
Ein jugendliches Selbstporträt des verblichenen Künstlers,
vom umflorten Lorbeer umrahmt, giebt auch Fernerstehenden
über die Bedeutung der Ausstellung Auskunft, die in nächster
Zeit wohl noch das Ziel vieler Kunstfreunde unserer Stadt
sein wird.
VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.
*#* Dem deutschen Kunstverein, der seinen Sitz in Berlin
hat, sind die Kaiserin Friedrich, der Großherzog von Baden
und der Großherzog von Sachsen-Weimar beigetreten.
VERMISCHTES.
*,„* Die Borgia-Gemächer im Vatikan sollen nun endlich,
wie der Frankf. Ztg. aus Rom geschrieben wird, in den
nächsten Wochen eröffnet werden. Es sind die vom Papste
Alexander VI. (Borgia) für sich hergestellten Wohnräume,
sechs an der Zahl, die zwischen dem Hof des Belvedere und
dem Cortile del Papagallo im vatikanischen Palaste liegen
und 1494 vollendet wurden. Mit der malerischen und
dekorativen Ausstattung waren Pinturicchio, Perino de]
Vaga und Giovanni da Udine betraut. Trotz der Ungleich-
heit in der Ausführung ist die Ausschmückung der Borgia-
Räume eine hervorragende Leistung der Kunst des Quattro-
cento. Was Pinturicchio selbst geschaffen, wird als das Beste
seiner Hand angesehen. Unter Gregor XVI. wurden die
Borgia-Gemächer zu Bibliothekzwecken benutzt. Leo XIII.
hat bereits 1889 die Räumung, und die nötigen Herstellungen
angeordnet; von nun an sollen sie zur Aufstellung von Kunst-
werken des Mittelalters und der Renaissance dienen.
*„,* A. v. Werner's Entwurf Xu dem Bilde an der Sieges-
säule in Berlin. Die Gedenkfeier der großen Zeit von 1870
und 1871 hat die Frage angeregt, wo sich der von Anton
von Werner ausgeführte farbige Entwurf zu dem den be-
geisterten Kampf für das Vaterland und die Vereinigung
Alldeutschlands darstellenden Mosaikbilde an der Berliner
Siegessäule befindet. Der Karton ist, wie die „Berliner
Korrespondenz" in Erinnerung bringt, seit dem Jahre 1879
Vermischtes. — Zeitschriften. 214
mit Allerhöchster Genehmigung dem Schlesischen Museum
für bildende Künste in Breslau überwiesen und im Ober-
geschoss dieses Museums in wirkungsvoller Weise aufgestellt
worden.
*„* Für den Ausbau des Theatersaales im Palaxxo
Caffarelli in Rom, dem Sitze der deutschen Botschaft, bat
der Berliner Architekt Professor Alfred Messel Pläne ent-
worfen, die kürzlich vom Kaiser genehmigt worden sind.
Die Pläne bezwecken, wie die „Vossische Zeitung" mitteilt,
zunächst eine völlige Beseitigung der bisherigen, etwas
nüchternen Dekoration des Raumes und wollen an deren
Stelle eine dem Charakter der alten Holzdecke entsprechende
Architektur im Stile des 10. Jahrhunderts als eine würdige
Umrahmung der Wandgemälde schaffen, mit deren Aus-
führung der Kaiser Professor Hermann Prell in Dresden
beauftragt hat. In einem Drittel etwa der ganzen Höhe
werden nach dem Entwürfe die Wände durch ein kräftiges
Gesims gegliedert. Der untere Teil wird paneelartig zu-
sammengefasst, wobei die zwischen den marmorumrahmten
Portalen verbleibenden Flächen mit Stuckmarmor bekleidet
werden sollen. Die obere Fläche der Wände, die die Dar-
stellung des Frühlings, des Sommers und Winters nach der
altnordischen Mythologie aufnehmen soll, wird in ihrer ganzen
Höhe durch eine rundgehende Säulenstellung zusammen-
gefasst, neben welcher zum seitlichen Abschluss der Bilder
oberhalb der Thüren des Saales kräftige Architekturen und
kartuschenartige Umrahmungen bis hinauf zu dem ornamen-
talen Fries und der auf kleinen Genien vorgekragten Decke sich
entwickeln. An der Hauptwand sind beispielsweise Baidur
und Heimdali in einer flotten Nischendekoration dargestellt.
Die beiden Schmalwände sind in der Architektur vortreff-
lich angeschlossen und haben namentlich durch die Anlage
einer neuen Musikloge ein hübsches Motiv geboten, dessen
Einfügung ohne Beeinträchtigung der Malerei sehr geschickt
gelöst wurde. Die Fensterwand zeigt in der Mitte in großer
Auffassung eine ebenfalls von Prell erfundene Verherrlichung
des Deutschen Reiches, mit welcher in engster Verbindung
die vom Kaiser bestimmte Weiheschrift in lateinischer
Sprache angebracht wird. Der Fensterwand gegenüber wird
der neue Thronbaldachin aufgestellt, der in reicher Appli-
kation von Seide mit feinster Goldstickerei geplant ist. Den
Mittelpunkt der Rückwand nimmt der deutsche Reichsadler
ein, für dessen breit herumgelegtes Schriftband vom Kaiser
die Worte gewählt wurden: „Sub umbra alarum tuarutn
protege nos". Der eigentliche Thronsitz ist aus Holz ge-
schnitzt gedacht und hat als Seitenlehnen zwei goldene Löwen
als die Sinnbilder der Kraft und der Wachsamkeit.
ZEITSCHRIFTEN.
Christliches Kunsthlatt. 189«. Nr. 1.
Die Christusstatue au der Fassade der Lutlierkirche in Berlin. —
Eine Umschau in der altchristlichen Kunst. — Die Gnadenkirche
in Berlin.
Die Kunst für Alle. 1895/i)(S. Heft 9.
Pietät in der bildenden Kunst. — Die Düsseldorfer St. Lukas-
Ausstellung 18!)5. Von W. von Oettingen. — Vom Zügel'schen
Tier-Atelier in München. Von M. L.
Gazette des Beaux-Arts. 1896. Jauuar.
Jean-Baptiste Perronneau, par M. Maurice Tourneux. — Le Musee
de Bäle, par M. Antony Valabregue. — Les Portraits de Lorenzo
Lotto, par M. Emile Michel. — Le Centenaire de la Lithographie,
par M. Paul Leprieur. — Jean Perreal, dit Jean de Paris, sa vie
et son Oeuvre, par M. R. de Maulde la Claviere. — Un Rubens
ä retrouver, par M. Henry Hymans. — Puvis de Chavannes,
d'apres un livre rfecent, par M. Ary Renan. — Correspondance
d'Italie, par G-. F.
Zeitschrift für christliche Kunst. 1895. Heft 10.
Wilhelm von Heile und Hermann Wynrich von Wesel. IV. Be-
schreibendes Verzeichnis der niederländischen Tafelgemälde seit,
ca. 1300—1440. I. Von E. Firmeuieh-Kicbartz. — Das Reliquiar
des hl. Oswald im Domschatz zu Hildesheim. Von Stephan
Beissel.