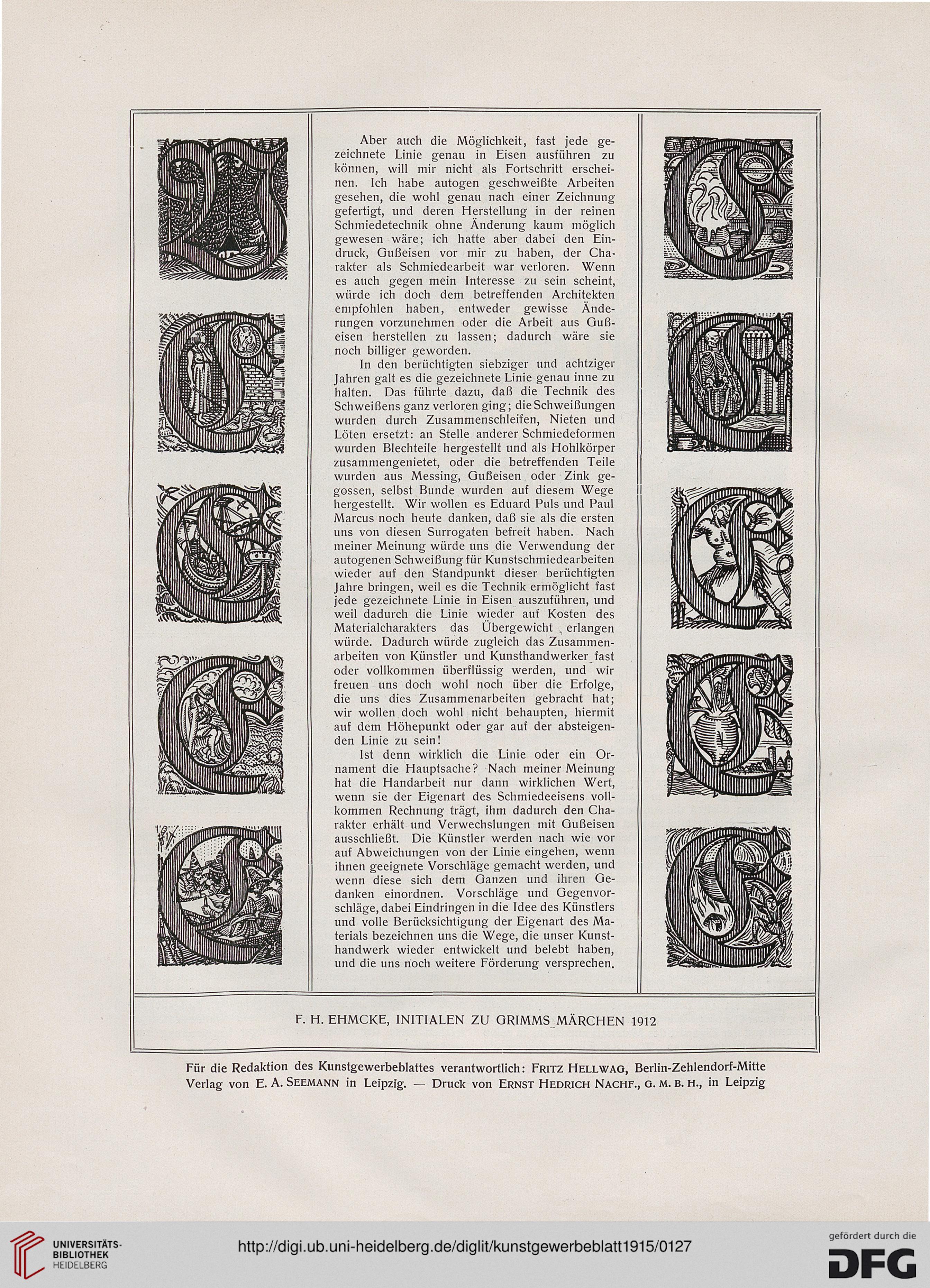Aber auch die Möglichkeit, fast jede ge-
zeichnete Linie genau in Eisen ausführen zu
können, will mir nicht als Fortschritt erschei-
nen. Ich habe autogen geschweißte Arbeiten
gesehen, die wohl genau nach einer Zeichnung
gefertigt, und deren Herstellung in der reinen
Schmiedetechnik ohne Änderung kaum möglich
gewesen wäre; ich hatte aber dabei den Ein-
druck, Gußeisen vor mir zu haben, der Cha-
rakter als Schmiedearbeit war verloren. Wenn
es auch gegen mein Interesse zu sein scheint,
würde ich doch dem betreffenden Architekten
empfohlen haben, entweder gewisse Ände-
rungen vorzunehmen oder die Arbeit aus Guß-
eisen herstellen zu lassen; dadurch wäre sie
noch billiger geworden.
In den berüchtigten siebziger und achtziger
Jahren galt es die gezeichnete Linie genau inne zu
halten. Das führte dazu, daß die Technik des
Schweißens ganz verloren ging; die Schweißungen
wurden durch Zusammenschleifen, Nieten und
Löten ersetzt: an Stelle anderer Schmiedeformen
wurden Blechteile hergestellt und als Hohlkörper
zusammengenietet, oder die betreffenden Teile
wurden aus Messing, Gußeisen oder Zink ge-
gossen, selbst Bunde wurden auf diesem Wege
hergestellt. Wir wollen es Eduard Puls und Paul
Marcus noch heute danken, daß sie als die ersten
uns von diesen Surrogaten befreit haben. Nach
meiner Meinung würde uns die Verwendung der
autogenen Schweißung für Kunstschmiedearbeiten
wieder auf den Standpunkt dieser berüchtigten
Jahre bringen, weil es die Technik ermöglicht fast
jede gezeichnete Linie in Eisen auszuführen, und
weil dadurch die Linie wieder auf Kosten des
Materialcharakters das Übergewicht , erlangen
würde. Dadurch würde zugleich das Zusammen-
arbeiten von Künstler und Kunsthandwerker fast
oder vollkommen überflüssig werden, und wir
freuen uns doch wohl noch über die Erfolge,
die uns dies Zusammenarbeiten gebracht hat;
wir wollen doch wohl nicht behaupten, hiermit
auf dem Höhepunkt oder gar auf der absteigen-
den Linie zu sein!
Ist denn wirklich die Linie oder ein Or-
nament die Hauptsache? Nach meiner Meinung
hat die Handarbeit nur dann wirklichen Wert,
wenn sie der Eigenart des Schmiedeeisens voll-
kommen Rechnung trägt, ihm dadurch den Cha-
rakter erhält und Verwechslungen mit Gußeisen
ausschließt. Die Künstler werden nach wie vor
auf Abweichungen von der Linie eingehen, wenn
ihnen geeignete Vorschläge gemacht werden, und
wenn diese sich dem Ganzen und ihren Ge-
danken einordnen. Vorschläge und Gegenvor-
schläge, dabei Eindringen in die Idee des Künstlers
und volle Berücksichtigung der Eigenart des Ma-
terials bezeichnen uns die Wege, die unser Kunst-
handwerk wieder entwickelt und belebt haben,
und die uns noch weitere Förderung versprechen.
F. H. EHMCKE, INITIALEN ZU GRIMMS MÄRCHEN 1912
Für die Redaktion des Kunstgewerbeblattes verantwortlich: Fritz Hell wag, Berlin-Zehlendorf-Mitte
Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. — Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., in Leipzig
zeichnete Linie genau in Eisen ausführen zu
können, will mir nicht als Fortschritt erschei-
nen. Ich habe autogen geschweißte Arbeiten
gesehen, die wohl genau nach einer Zeichnung
gefertigt, und deren Herstellung in der reinen
Schmiedetechnik ohne Änderung kaum möglich
gewesen wäre; ich hatte aber dabei den Ein-
druck, Gußeisen vor mir zu haben, der Cha-
rakter als Schmiedearbeit war verloren. Wenn
es auch gegen mein Interesse zu sein scheint,
würde ich doch dem betreffenden Architekten
empfohlen haben, entweder gewisse Ände-
rungen vorzunehmen oder die Arbeit aus Guß-
eisen herstellen zu lassen; dadurch wäre sie
noch billiger geworden.
In den berüchtigten siebziger und achtziger
Jahren galt es die gezeichnete Linie genau inne zu
halten. Das führte dazu, daß die Technik des
Schweißens ganz verloren ging; die Schweißungen
wurden durch Zusammenschleifen, Nieten und
Löten ersetzt: an Stelle anderer Schmiedeformen
wurden Blechteile hergestellt und als Hohlkörper
zusammengenietet, oder die betreffenden Teile
wurden aus Messing, Gußeisen oder Zink ge-
gossen, selbst Bunde wurden auf diesem Wege
hergestellt. Wir wollen es Eduard Puls und Paul
Marcus noch heute danken, daß sie als die ersten
uns von diesen Surrogaten befreit haben. Nach
meiner Meinung würde uns die Verwendung der
autogenen Schweißung für Kunstschmiedearbeiten
wieder auf den Standpunkt dieser berüchtigten
Jahre bringen, weil es die Technik ermöglicht fast
jede gezeichnete Linie in Eisen auszuführen, und
weil dadurch die Linie wieder auf Kosten des
Materialcharakters das Übergewicht , erlangen
würde. Dadurch würde zugleich das Zusammen-
arbeiten von Künstler und Kunsthandwerker fast
oder vollkommen überflüssig werden, und wir
freuen uns doch wohl noch über die Erfolge,
die uns dies Zusammenarbeiten gebracht hat;
wir wollen doch wohl nicht behaupten, hiermit
auf dem Höhepunkt oder gar auf der absteigen-
den Linie zu sein!
Ist denn wirklich die Linie oder ein Or-
nament die Hauptsache? Nach meiner Meinung
hat die Handarbeit nur dann wirklichen Wert,
wenn sie der Eigenart des Schmiedeeisens voll-
kommen Rechnung trägt, ihm dadurch den Cha-
rakter erhält und Verwechslungen mit Gußeisen
ausschließt. Die Künstler werden nach wie vor
auf Abweichungen von der Linie eingehen, wenn
ihnen geeignete Vorschläge gemacht werden, und
wenn diese sich dem Ganzen und ihren Ge-
danken einordnen. Vorschläge und Gegenvor-
schläge, dabei Eindringen in die Idee des Künstlers
und volle Berücksichtigung der Eigenart des Ma-
terials bezeichnen uns die Wege, die unser Kunst-
handwerk wieder entwickelt und belebt haben,
und die uns noch weitere Förderung versprechen.
F. H. EHMCKE, INITIALEN ZU GRIMMS MÄRCHEN 1912
Für die Redaktion des Kunstgewerbeblattes verantwortlich: Fritz Hell wag, Berlin-Zehlendorf-Mitte
Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. — Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., in Leipzig