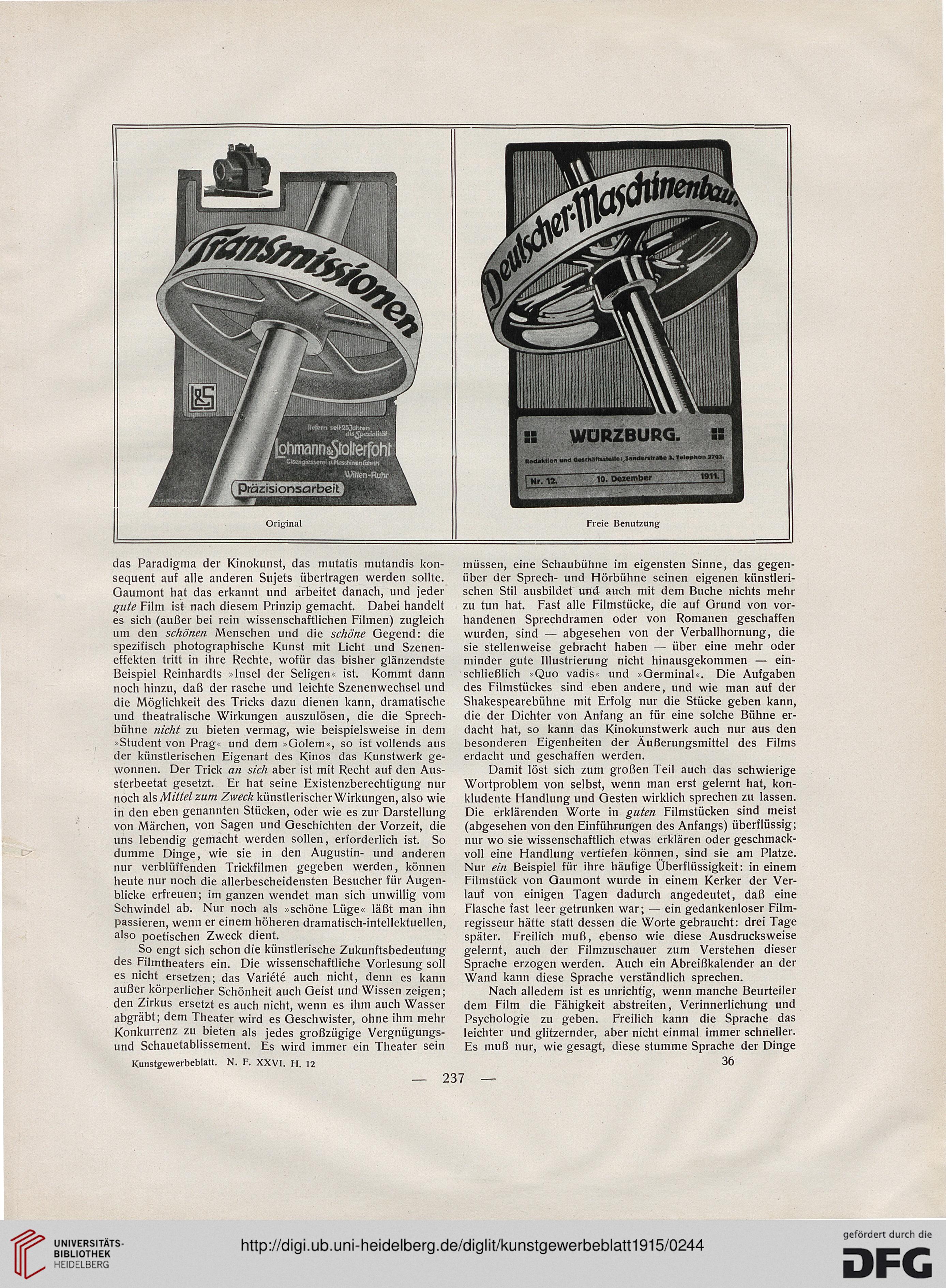Original
Freie Benutzung
das Paradigma der Kinokunst, das mutatis mutandis kon-
sequent auf alle anderen Sujets übertragen werden sollte.
Gaumont hat das erkannt und arbeitet danach, und jeder
gute Film ist nach diesem Prinzip gemacht. Dabei handelt
es sich (außer bei rein wissenschaftlichen Filmen) zugleich
um den schönen Menschen und die schöne Gegend: die
spezifisch photographische Kunst mit Licht und Szenen-
effekten tritt in ihre Rechte, wofür das bisher glänzendste
Beispiel Reinhardts »Insel der Seligen« ist. Kommt dann
noch hinzu, daß der rasche und leichte Szenenwechsel und
die Möglichkeit des Tricks dazu dienen kann, dramatische
und theatralische Wirkungen auszulösen, die die Sprech-
bühne nicht zu bieten vermag, wie beispielsweise in dem
»Student von Prag« und dem »Golem«, so ist vollends aus
der künstlerischen Eigenart des Kinos das Kunstwerk ge-
wonnen. Der Trick an sich aber ist mit Recht auf den Aus-
sterbeetat gesetzt. Er hat seine Existenzberechtigung nur
noch als Mittel zum Zweck künstlerischer Wirkungen, also wie
in den eben genannten Stücken, oder wie es zur Darstellung
von Märchen, von Sagen und Geschichten der Vorzeit, die
uns lebendig gemacht werden sollen, erforderlich ist. So
dumme Dinge, wie sie in den Augustin- und anderen
nur verblüffenden Trickfilmen gegeben werden, können
heute nur noch die allerbescheidensten Besucher für Augen-
blicke erfreuen; im ganzen wendet man sich unwillig vom
Schwindel ab. Nur noch als »schöne Lüge« läßt man ihn
passieren, wenn er einem höheren dramatisch-intellektuellen,
also poetischen Zweck dient.
So engt sich schon die künstlerische Zukunftsbedeutung
des Filmtheaters ein. Die wissenschaftliche Vorlesung soll
es nicht ersetzen; das Variete auch nicht, denn es kann
außer körperlicher Schönheit auch Geist und Wissen zeigen;
den Zirkus ersetzt es auch nicht, wenn es ihm auch Wasser
abgräbt; dem Theater wird es Geschwister, ohne ihm mehr
Konkurrenz zu bieten als jedes großzügige Vergnügungs-
und Schauetablissement. Es wird immer ein Theater sein
Kunstgewerbeblatt. N. F. XXVI. H. 12
müssen, eine Schaubühne im eigensten Sinne, das gegen-
über der Sprech- und Hörbühne seinen eigenen künstleri-
schen Stil ausbildet und auch mit dem Buche nichts mehr
zu tun hat. Fast alle Filmstücke, die auf Grund von vor-
handenen Sprechdramen oder von Romanen geschaffen
wurden, sind — abgesehen von der Verballhornung, die
sie stellenweise gebracht haben — über eine mehr oder
minder gute Illustrierung nicht hinausgekommen — ein-
schließlich »Quo vadis« und »Germinal«. Die Aufgaben
des Filmstückes sind eben andere, und wie man auf der
Shakespearebühne mit Erfolg nur die Stücke geben kann,
die der Dichter von Anfang an für eine solche Bühne er-
dacht hat, so kann das Kinokunstwerk auch nur aus den
besonderen Eigenheiten der Äußerungsmittel des Films
erdacht und geschaffen werden.
Damit löst sich zum großen Teil auch das schwierige
Wortproblem von selbst, wenn man erst gelernt hat, kon-
kludente Handlung und Gesten wirklich sprechen zu lassen.
Die erklärenden Worte in guten Filmstücken sind meist
(abgesehen von den Einführungen des Anfangs) überflüssig;
nur wo sie wissenschaftlich etwas erklären oder geschmack-
voll eine Handlung vertiefen können, sind sie am Platze.
Nur ein Beispiel für ihre häufige Überflüssigkeit: in einem
Filmstück von Gaumont wurde in einem Kerker der Ver-
lauf von einigen Tagen dadurch angedeutet, daß eine
Flasche fast leer getrunken war; — ein gedankenloser Film-
regisseur hätte statt dessen die Worte gebraucht: drei Tage
später. Freilich muß, ebenso wie diese Ausdrucksweise
gelernt, auch der Filmzuschauer zum Verstehen dieser
Sprache erzogen werden. Auch ein Abreißkalender an der
Wand kann diese Sprache verständlich sprechen.
Nach alledem ist es unrichtig, wenn manche Beurteiler
dem Film die Fähigkeit abstreiten, Verinnerlichung und
Psychologie zu geben. Freilich kann die Sprache das
leichter und glitzernder, aber nicht einmal immer schneller.
Es muß nur, wie gesagt, diese stumme Sprache der Dinge
36
— 237
Freie Benutzung
das Paradigma der Kinokunst, das mutatis mutandis kon-
sequent auf alle anderen Sujets übertragen werden sollte.
Gaumont hat das erkannt und arbeitet danach, und jeder
gute Film ist nach diesem Prinzip gemacht. Dabei handelt
es sich (außer bei rein wissenschaftlichen Filmen) zugleich
um den schönen Menschen und die schöne Gegend: die
spezifisch photographische Kunst mit Licht und Szenen-
effekten tritt in ihre Rechte, wofür das bisher glänzendste
Beispiel Reinhardts »Insel der Seligen« ist. Kommt dann
noch hinzu, daß der rasche und leichte Szenenwechsel und
die Möglichkeit des Tricks dazu dienen kann, dramatische
und theatralische Wirkungen auszulösen, die die Sprech-
bühne nicht zu bieten vermag, wie beispielsweise in dem
»Student von Prag« und dem »Golem«, so ist vollends aus
der künstlerischen Eigenart des Kinos das Kunstwerk ge-
wonnen. Der Trick an sich aber ist mit Recht auf den Aus-
sterbeetat gesetzt. Er hat seine Existenzberechtigung nur
noch als Mittel zum Zweck künstlerischer Wirkungen, also wie
in den eben genannten Stücken, oder wie es zur Darstellung
von Märchen, von Sagen und Geschichten der Vorzeit, die
uns lebendig gemacht werden sollen, erforderlich ist. So
dumme Dinge, wie sie in den Augustin- und anderen
nur verblüffenden Trickfilmen gegeben werden, können
heute nur noch die allerbescheidensten Besucher für Augen-
blicke erfreuen; im ganzen wendet man sich unwillig vom
Schwindel ab. Nur noch als »schöne Lüge« läßt man ihn
passieren, wenn er einem höheren dramatisch-intellektuellen,
also poetischen Zweck dient.
So engt sich schon die künstlerische Zukunftsbedeutung
des Filmtheaters ein. Die wissenschaftliche Vorlesung soll
es nicht ersetzen; das Variete auch nicht, denn es kann
außer körperlicher Schönheit auch Geist und Wissen zeigen;
den Zirkus ersetzt es auch nicht, wenn es ihm auch Wasser
abgräbt; dem Theater wird es Geschwister, ohne ihm mehr
Konkurrenz zu bieten als jedes großzügige Vergnügungs-
und Schauetablissement. Es wird immer ein Theater sein
Kunstgewerbeblatt. N. F. XXVI. H. 12
müssen, eine Schaubühne im eigensten Sinne, das gegen-
über der Sprech- und Hörbühne seinen eigenen künstleri-
schen Stil ausbildet und auch mit dem Buche nichts mehr
zu tun hat. Fast alle Filmstücke, die auf Grund von vor-
handenen Sprechdramen oder von Romanen geschaffen
wurden, sind — abgesehen von der Verballhornung, die
sie stellenweise gebracht haben — über eine mehr oder
minder gute Illustrierung nicht hinausgekommen — ein-
schließlich »Quo vadis« und »Germinal«. Die Aufgaben
des Filmstückes sind eben andere, und wie man auf der
Shakespearebühne mit Erfolg nur die Stücke geben kann,
die der Dichter von Anfang an für eine solche Bühne er-
dacht hat, so kann das Kinokunstwerk auch nur aus den
besonderen Eigenheiten der Äußerungsmittel des Films
erdacht und geschaffen werden.
Damit löst sich zum großen Teil auch das schwierige
Wortproblem von selbst, wenn man erst gelernt hat, kon-
kludente Handlung und Gesten wirklich sprechen zu lassen.
Die erklärenden Worte in guten Filmstücken sind meist
(abgesehen von den Einführungen des Anfangs) überflüssig;
nur wo sie wissenschaftlich etwas erklären oder geschmack-
voll eine Handlung vertiefen können, sind sie am Platze.
Nur ein Beispiel für ihre häufige Überflüssigkeit: in einem
Filmstück von Gaumont wurde in einem Kerker der Ver-
lauf von einigen Tagen dadurch angedeutet, daß eine
Flasche fast leer getrunken war; — ein gedankenloser Film-
regisseur hätte statt dessen die Worte gebraucht: drei Tage
später. Freilich muß, ebenso wie diese Ausdrucksweise
gelernt, auch der Filmzuschauer zum Verstehen dieser
Sprache erzogen werden. Auch ein Abreißkalender an der
Wand kann diese Sprache verständlich sprechen.
Nach alledem ist es unrichtig, wenn manche Beurteiler
dem Film die Fähigkeit abstreiten, Verinnerlichung und
Psychologie zu geben. Freilich kann die Sprache das
leichter und glitzernder, aber nicht einmal immer schneller.
Es muß nur, wie gesagt, diese stumme Sprache der Dinge
36
— 237